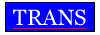 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
Februar 2010 |
|
| Sektion 2.11. |
Ordnung im Übergang. Zur Verwendung des Farbwortes Blau im dichterischen Feld der
Lyrik der Moderne
Sektionsleiter | Section Chair: Hartmut Cellbrot ( Herford, Deutschland)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
Ordnung im Übergang. Zur Verwendung des Farbwortes Blau
im dichterischen Feld der Lyrik der Moderne
Hartmut Cellbrot (Herford, Deutschland) [BIO]
Email: Hartmut.Cellbrot@gmx.de
Die Geschichte der besonderen Symbolik der Farbe Blau reicht bis in die Anfänge der Weltkulturen zurück. Die Konjunktion von Blau und Transzendenz in der Tradition der religiösen europäischen Malerei erscheint bereits in der Spätantike. Die Karriere des Farbwortes in der neueren deutschsprachigen Literatur beginnt um 1800 und ist dort vor allem mit dem Namen Novalis, aber auch Goethe und Schiller verknüpft. Es wird Gegenstand ästhetischer Reflexion wie Medium der „Potenzierung“. Im 20. Jahrhundert gewinnt der Gebrauch des Farbwortes in der Lyrik eine eigene textkonstituierende Dynamik, wodurch es - nach dem "Tod Gottes", Nietzsche - zum multiplen Zeichen wie Anzeichen purer Grenzphänomene wird. Diese Funktion erhält Blau aber nicht durch einen ihm anhängenden semantischen Wert - eher figuriert es als semantische Kategorie, unter der etwas fraglich wird -, sondern primär aufgrund der Verwendung im dichterischen Feld. Dies führt zum Begriff der Topographie, der hier besagen soll, dass alles, was ist, nicht von seiner Gegebenheits- und Zugangsweise, mithin seiner Örtlichkeit zu trennen ist. Die Frage nach der Topographie des Farbwortes Blau im modernen Gedicht fragt daher nach der spezifischen Situierung im Textzusammenhang. Verbunden mit der jeweiligen topographischen Verwendung wiederum ist die Realisierung von Ordnungszusammenhängen wie deren Überschreitung. Dem Farbwert Blau eignete dann die Funkion einer Schwelle, Grenze oder Passage. Im Folgenden richtet sich anhand ausgewählter Beispiele moderner Lyrik das Augenmerk darauf, inwieweit sich in den Verwendungen des Farbwortes Blau textkonstituierende Phänomene wie das Verhältnis von Natur und Kultur, von Sinnlichem und Nichtsinnlichem, Eigenem und Fremden, überhaupt von Ordnungen und deren Überschreitung verdichten.
Vorausgeschickt werden soll ein Wort Merleau-Pontys über die Aufgabe moderner Kunst, das für die folgenden Überlegungen wegweisend zu sein vermag. Im Blick auf die moderne Malerei und die Dichtung der Moderne, wie hinzugefügt werden kann, vermerkt er, dass es in ihr darauf ankomme, die „Äquivalenzsysteme zu vermehren“. Denn es gehe nicht darum, sich irgendwelcher Ähnlichkeiten zu bedienen, also zu irgendeiner Nachbildung zu kommen, sondern das Problem ist, wie man Verborgenes, bisher nicht Gesehenes zum Ausdruck bringen kann, etwas, das nicht mit irgendeinem vorfindbaren Zeichensystem äußerbar ist. Ähnlich lässt sich Paul Klee vernehmen, wenn er zu bedenken gibt: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.“
▲
I
Um die skizzierten Vorgaben textlich einzuholen, soll mit der Interpretation eines Gedichts von Georg Trakl begonnen werden, der wie kaum ein anderer Lyriker durch den Einsatz von Farbwörtern, insbesondere des Farbwortes Blau, ein radikal gewandeltes Selbst- und Weltverhältnis gestaltet. Das 1913 entstandene Gedicht „Kindheit“ ist ein subtiles Beispiel für Grenzüberschreitungen, die die Selbstzeitigung des Ich und seines In-der-Welt-Seins betreffen.
Kindheit
Voll Früchten der Hollunder; ruhig wohnte die Kindheit
In blauer Höhle. Über vergangenen Pfad,
Wo nun bräunlich das wilde Gras saust,
Sinnt das stille Geist; das Rauschen des Laubs
Ein gleiches, wenn das blaue Wasser im Felsen tönt.
Sanft ist der Amsel Klage. Ein Hirt
Folgt sprachlos der Sonne,
die vom herbstlichen Hügel rollt.
Ein blauer Augenblick ist nur mehr Seele.
Am Waldsaum zeigt sich ein scheues Wild und friedlich
Ruhn im Grund die alten Glocken und finsteren Weiler.
Frömmer kennst du den Sinn der dunklen Jahre,
Kühle und Herbst in einsamen Zimmern;
Und in heiliger Bläue läuten leuchtende Schritte fort.
Ein erster Blick auf das Gedicht lässt sofort eine Häufung des Farbwortes Blau erkennen. Inwieweit dessen Verwendung dazu beiträgt eine bestimmte Form der Selbstzeitigung zu generieren, kann hier nur an einzelnen Textausschnitten aufgezeigt werden. Zunächst scheinen sich die Erwartungen, die der nicht ungewöhnliche Titel Kindheit weckt – man denke nur an das gleichnamige, wenige Jahre früher, 1906, geschriebene Gedicht Rilkes - gleich zu Beginn des Gedichts zu bestätigen. Das Thema Kindheit wird nach einer deutlichen Zäsur im zweiten Halbvers der ersten Zeile wörtlich angeschlagen. Die Kindheit wird genannt als etwas Gewesenes. Demgegenüber ist das vorhergehende Naturbild "Voll Früchten der Hollunder", das der elliptische Einsatz beruft, zeitlich nicht einzugrenzen.
Der zweite Halbvers "ruhig wohnte die Kindheit" bildet mit dem folgenden Präpositionalobjekt "In blauer Höhle“ im zweiten Vers grammatikalisch einen vollständigen Satz. Mit dem Übergreifen des Satzzusammenhangs von der ersten Verszeile über deren Ende in die nächste drängt die zweite Halbzeile aufgrund des Enjambements aber auch über sich hinaus. Das abgetrennte "In blauer Höhle" schafft mit seiner bildhaften Sprechweise eine semantische Offenheit, die nicht nur auf das ruhige Wohnen der Kindheit zurückwirkt, sondern auch auf den Früchte tragenden Hollunderstrauch. Die"blaue Höhle", in der die Kindheit ruhig wohnte, signalisiert einen Zeitraum der Geborgenheit: Verräumlicht als Höhle der Zeit des geschützten Wohnens der Kindheit lässt sie sich mit dem Hollunder assoziieren, der mit seinen dunkelblauen Beeren für ein spielendes Kind eine Höhle zu bilden vermag."Voll Früchten der Hollunder" wäre demnach auf derselben Zeitebene wie"in blauer Höhle" anzusiedeln und als Erinnerung des Sprechenden an die Kindheit zu lesen. Der Hollunderstrauch ist hier folglich ein gewesener.
Die elliptische Sprechweise von "Voll Früchten der Hollunder" erlaubt aber auch eine gleichberechtigte zweite Lesart. Nach dieser beruft die Ellipse eine intensive in der Gegenwart des poetischen Sprechens sich vollziehende sinnliche Anschauung. Im Anblick des Hollunderstrauches springt die Gegenwartsperspektive unvermittelt um zu der Erinnerung"ruhig wohnte die Kindheit". Hier bedeutete die Zäsur in temporaler Hinsicht eine Kluft, die die Gegenwart der Hollunderwahrnehmung und die Erinnerung an die behütete Kindheit scheidet.
Will man nicht eine der beiden Lesarten unterschlagen, so sind in der Eingangsellipse "Voll Früchten der Hollunder" Gegenwart und Vergangenes miteinander verschränkt. Die Dimension des Präsentischen wie die des Gewesenen überlagern sich wechselseitig, wobei kraft der gezeigten semantischen Assoziationsmöglichkeit der Zeitraum "In blauer Höhle" in das Interferenzgeschehen miteinbezogen wird.
Zugleich aber bleiben die beiden Zeitdimensionen getrennt, da sie sich nicht widerspruchsfrei in eins setzen lassen. Dieses ist deshalb nicht möglich, weil es sich in den beiden Lesarten nicht um denselben Hollunderstrauch handeln kann. Denn der gewesene der Kindheit ist nicht identisch mit dem in der zweiten Lesart in der Gegenwart des Sprechens genannten. Widerspruchsfreiheit ergäbe sich nur, wenn allein die zweite Lesemöglichkeit gälte, die lautete: Angesichts eines präsentischen Hollunders erinnert sich das Ich an die Kindheit. Aber infolge der elliptischen Konstruktion gilt genauso, dass der Hollunder ein anderer ist, der in der Vergangenheit und nur dort existiert hat.
Zusammen betrachtet ergibt sich folgender Sachverhalt: Der gegenwärtige Hollunder vermag zwar den gewesenen zu berufen, aber nur so, dass dieser als der vergangene selbst dasteht, wodurch der gegenwärtige verdrängt wird; es sich also um zwei verschiedene Hollunder handelt. Das heißt, das Vergangene selbst taucht auf-, es ist nicht Ergebnis eines Erinnerungsaktes. Temporal gesehen repräsentiert das Wort „Hollunder“ zwei Zeitdimensionen, eine des Gegenwärtigen und eine des Vergangenen, die nicht als solche mehr von einem Subjekt her als Akte des Vergegenwärtigens ausgehen, sondern den Sprechenden bzw. das lyrische Ich treffen, indem die beiden Zeitebenen es temporal spalten und zugleich verflechten.
Diese temporale Kluft geht mitten durch das Ich (den Sprechenden) hindurch. Sie hat es gleichsam zeitlich auseinander gerissen, aber so, dass es diesen Riss als etwas erfährt, das dasjenige, was der Riss trennt, es selbst ist. Insofern als es die Gegenwart und die Vergangenheit selbst sind, die das Ich in seiner Zeitigung treffen, kann man in diesem doppelten Sinn von `selbst´ von einer Selbstzeitigung sprechen, in der sich das Ich temporal als die Verflechtung von Gegenwart und Vergangenheit erfährt.
Die temporale Kluft bekräftigt noch der formale Aufbau des Verses. Die beiden Halbzeilen stehen gleichgewichtig — sie verfügen über dieselbe Anzahl von Silben — nebeneinander. Da der temporale Spalt — aufgrund der beiden Lesarten — bereits in "Voll Früchten der Hollunder" wirkt, handelt es sich, genau besehen, um eine doppelte temporale Kluft, die die Gegenwart der Selbstzeitigung des Sprechenden in Gegenwärtiges und Vergangenes und die Beziehung des gespaltenen Gegenwärtigen zum Gewesenen betrifft. Das verkürzte elliptische Sprechen antwortet auf die Eindringlichkeit dessen, was im Augenblick als die Verflechtung von Gegenwärtigem und Vergangenem erfahren wird. In ihm sucht eine Erfahrung Sprache zu gewinnen, die dem lyrischen Ich keine Distanzierungsmöglichkeit erlaubt, die es vielmehr überwältigt. Der sodann in der ersten Reflexion vom Standpunkt der Kindheit unternommene Versuch des sprechenden Ich, sich seiner selbst über die Vergegenwärtigung der Kindheit zu versichern, gelingt freilich nicht. Was im Anblick des Hollunderstrauches genannt werden kann — das ruhige Wohnen der Kindheit — ist mit "blauer Höhle" überschritten. Der Versuch, den Ort des geborgenen Wohnens räumlich und zeitlich zu benennen, scheitert, da die blaue Höhle in Verbindung mit Hollunder auch Gegenwärtiges in der gezeigten Verflochtenheit mit Vergangenem beruft.
Nach dem Satzende im zweiten Vers und einer erneuten Zäsur wird allein das Gewesene der Kindheit nun ausdrücklich in ein Verhältnis zur Gegenwart gesetzt. . „Über vergangenen Pfad, /.../ Sinnt das stille Geäst“. Das Geäst „sinnt“ „über“ kann in der Bedeutung von nachdenken über gefaßt werden, wobei hier allerdings, linguistisch gesprochen, ein Verstoß gegen Selektionsbeschränkungen vorliegt. Eine Pflanze kann in der Regel nicht Subjekt eines Denkvorgangs sein. Die menschliche Bewußtseinseinstellung dominiert den räumlichen Aspekt des Naturraums Pfad mit dem darüber sich befindenden Baumgeäst. Doch insgesamt erhält sich die Schwebe von Natur- und Denkeinstellung. In der Präposition „über“ vereinigen sich der lokale Aspekt des Naturbildes mit dem des zeitlichen Nachsinnens, so dass sich ein präreflexiver Vorgang ohne aktive Ichbeteiligung abzeichnet. Das Nachdenken über vergangenen Pfad vollzieht sich in der Stille des Vegetativen, welches, weil mit bestimmtem Artikel versehen, als vorausgesetz erscheint. Die Stille und Unbewegtheit stehen in auffallendem Kontrast zu dem Sausen des wilden Grases der dritten Zeile. Der Gliedsatz „Wo nun bräunlich das wilde Gras saust“ ist zwischen vergangenem Pfad und dem gegenwärtigen Sinnen eingefügt. Es bildet eine Barriere, auch topographisch, indem er den ganzen Vers einnimmt. Zeitlich ist der „nun“ bewachsene Weg unzweideutig in der Gegenwart anzusiedeln. Der vergangene Pfad ist also noch da, aber eben als nicht mehr begangener. Um im Bild zu bleiben: ein Weg, der mit Gras bewachsen ist, wird nicht mehr benutzt; er dient nicht mehr seinem Wesen als Weg. In zeitlicher Hinsicht unterstreicht „bräunlich“ innerhalb dieser Bildsequenz das Abgestorbene, Abgelebte, während in dem Sausen des wilden Grases das Moment der Verwilderung mitschwingt.
Bezieht man die etymologische Herkunft des Verbs “sinnen“ in die Auslegung mit ein, so lässt sich die Bedeutung der Bewegung des Sinnens vertiefen. „sinnen“ leitet sich her von ahd. „sinnan“ „reisen, streben, gehen“. Das Sinnen über vergangenen Pfad ist demnach ein Denken, das noch nicht an sein Ziel angelangt ist; es ist noch auf dem Wege, unterwegs. Diese Bewegung des Sinns, in der das Ich sucht in ein Selbstverhältnis zu gelangen, findet seinen Ausdruck bzw. sprachliche Realisation in der besonderen Verwendung des Farbwortes Blau, wie sich später zeigen wird. Doch zunächst ist das Sinnen unmittelbar thematisch, es hat die Vergangenheit noch nicht erreicht. Es muß erst das Sausen des wilden Grases durchdringen, um das Gewesene überhaupt vernehmen zu können. Ob dies möglich ist, bleibt offen. Das ruhige Wohnen der Kindheit ist anwesend, jedoch im Modus der Abwesenheit.
Aber auch hier erlaubt das Gedicht eine weitere, umfassendere Lesart, sobald die Unbestimmtheit von „vergangenen Pfad“ bedacht wird. Das Nachdenken über Gewesenes meinte dann weniger einen bestimmten vergangenen Zeitraum der eigenen Biographie als vielmehr die Phänomenalität des Phänomens Vergangenheit überhaupt, - mithin die Zeitlichkeit des menschlichen Lebens. In den Blick gerät das In-der-Zeit-Sein des menschlichen Selbstverhältnisses, das erfahren wird als temporaler Entzug im Selbstbezug.
Nach der Zäsur hinter „Geäst“ schließt sich die Ellipse „das Rauschen des Laubs“ an. Das Laub verweist auf das Geäst, wobei das Rauschen mit der Stille kontrastiert. Ähnlich der Eingangsellipse sind hier keine starren Zeitbezüge festzuschreiben. Das Rauschen ist ausschließlich weder der Gegenwart noch der Vergangenheit zuzuordnen. Kraft dieser Unbestimmtheit vermag es beide Zeiten zu umfassen; das Rauschen hält die Dimensionalität offen für die Verspannung von Vergangenem und Gegenwärtigem. Da hinter der Ellipse zum Strophenausgang ein Satzzeichen fehlt, treibt sie über sich hinaus und verbindet sich mit dem ersten Vers der zweiten Strophe. „Ein gleiches“ bezieht sich somit gleichwertig sowohl auf das Rauschen des Laubs als auch auf den nachfolgenden Gliedsatz „wenn das blaue Wasser im Felsen tönt.“ Das Rauschen des Laubs nimmt die zuvor genannte Differenz zwischen gegenwärtigen Sinnen und Vergangenem auf, indem es sie umgreift; zugleich hebt mit der zweiten Bezugsmöglichkeit ein neues Sprechen an. „Ein gleiches“ ist das Tönen des blauen Wassers im Felsen wie das Rauschen des Laubs, was wiederum ein gleiches ist wie das Sinnen über Vergangenheit, das eine Kluft trennt. Zum anderen lässt sich das blaue Wasser im Felsen mit „blauer Höhle“ in Zusammenhang bringen. Wohnte die Kindheit in blauer Höhle, so tönt jetzt das blaue Wasser im Felsen.
In den beiden letzten Versen zwei und drei der zweiten Strophe erfährt der gebrochene Selbstbezug eine Ausdehnung und zwar in zweifacher Hinsicht. Neben dem Klagemotiv der Amsel wird mit der Figur des Hirten der einzelmenschliche Aspekt ins Mythisch-Archaische hinaus überschritten. Auf das Thema Kindheit bezogen, was der Titel des Gedichts vorgibt, beruft Trakl ein frühes Stadium der Menschheitsgeschte. Zudem wird nun ausdrücklich der Mensch-Natur-Bezug als ein gestörter thematisch. Die Sonne, das Leben spendende Gestirn, rollt, gleichsam aus seiner Bahn geworfen, vom herbstlichen Hügel. Der "sprachlos" — nicht schweigend — der vom Hügel rollenden Sonne folgende Hirt ist, sofern zum Wesen des Menschen sein Sprachlichsein gehört, seinem Wesen verlustig gegangen. Ein Mensch, der sprachlos etwas tut, verfügt nicht mehr über Bedeutungszusammenhänge.
Die im Herbst, in der Periode des Absterbens, vom Hügel rollende Sonne, deren Bewegung am Himmel als Ursymbol der Zeit und der kosmischen Ordnung gilt, signalisiert die Erschütterung des Kosmos. Das nicht Gelingen des Kindheitsbezugs ist kein ausschließlich perönliches Schicksal, es entspricht der Erschütterung der kosmischen Ordnung und damit auch der der Sprache als Ordnung stiftende Instanz.
Die dritte Strophe bildet als mittlere des fünfstrophigen Gedichts eine Schwelle und zeitigt einen Übergang. Der Versuch einer Selbstaneignung ist gescheitert — nicht zuletzt infolge einer zerbrochenen allumfassenden Ordnung. Dergestalt erfährt sich das Ich als Epizentrum einer es übersteigenden weltweiten Erschütterung. Auf der im Grunde im dichterischen Feld nur abstraktiv zu isolierenden Ebene der Selbstzeitigung des Sichzusichverhaltens bewirkt das u. a. von "In blauer Höhle" ausgelöste Interferenzgeschehen, dass sich das "ruhige Wohnen der Kindheit" weder näher bestimmen noch objektivieren lässt, auch vermag das Ich es nicht zu integrieren.
Doch verharrt das Scheitern des präreflexiven, vegetativen Sinnens über das Vergangene der Kindheit nicht im schlechthin Negativen. Das Sinnen ist zwar nicht an ein Ziel einer gelungenen Selbstaneignung gelangt, wohl aber an die Grenze eines Übergangs, wo es sich selbst durchsichtig wird. Der Übergang vollzieht eine Wende, wodurch die gestörten wie interferierenden intra- und extrasubjektiven Bezugsstrukturen (die gespaltene Selbstzeitigung) anders thematisch verwendet werden. Der den Übergang markierende erste Vers der dritten Strophe lautet: "Ein blauer Augenblick ist nur mehr Seele." Vorausgeschickt sei, dass Trakl mit "nur mehr" einen Austriazismus gebraucht, der in der Bedeutung von "nur noch" zu lesen ist. Um diesen semantisch polyvalenten Satz zu erhellen, seien vorerst zwei Bedeutungsaspekte genannt. Der Satz impliziert ein Zeitverhältnis und dies auf doppelte Weise, je nachdem, ob der Akzent auf den Farbwert oder auf das Substantiv "Augenblick" gelegt wird. Bei der ersten Möglichkeit wäre der Satz wie folgt zu verstehen: Ein blauer Augenblick — und nicht ein anders gearteter Augenblick, wie es vielleicht früher einmal der Fall war — ist jetzt nur noch Seele. Die zweite Möglichkeit würde besagen, dass ein Augenblick nur noch Seele ist, d. h. keinem anderen Zeitverhältnis und keiner Substanz kommt mehr die Qualität der Seele zu, wie es hier ebenfalls einmal der Fall gewesen sein könnte. Das, was Seele genannt wird, ist nichts anderes als ein Augenblick.
Auffallend ist, dass das Farbadjektiv "blau" mit den Substantiven "Höhle", "Wasser" und "Augenblick" eine Sequenz herstellt, der eine Richtung eingeschrieben ist. Ein Vorgang der Entstofflichung und ein Hervortreten des Farbwertes kann verzeichnet werden. Weder ein anders gearteter Augenblick noch etwas anderes als ein Augenblick ist nur noch Seele. Man könnte vermuten, das Sinnen sei in der Weise an sein Ziel gelangt, dass sich der doppelte Spalt, der die Selbstzeitigung bislang mehrfach durchkreuzt hat, ohne sie zu trennen, nun im blauen Augenblick geschlossen habe. Der blaue Augenblick wäre dann die zeitliche Dimension als Seele, innerhalb derer sich erst so etwas wie die Selbstzeitigung des Sichzusichverhaltens (das sich zu seiner eigenen Geschichte Verhalten) ereignete. Dergestalt wäre die Seele nichts anderes als zeitliche Ausdehnung, vergleichbar der "distentio" des Augustinus.
Das Sinnen wäre demzufolge an ein Ziel gelangt, insofern es nicht mehr in den Bahnen einer durch temporalen Entzug gekennzeichneten Selbstzeitigung verliefe, sondern in einem es ermöglichenden Zeitigungsgeschehen – dem blauen Augenblick – aufginge. Das würde allerdings bedeuten, in dem Aufeinanderbezogensein von Augenblick und Seele käme es überdies zu einer präsentischen Identität in Form eines nunc stans, wo die Weisen des Selbstentzugs verschwänden: indessen erhält sich in dem blauen Augenblick das Differenzgeschehen der Selbstzeitigung, wenngleich das Sich-Entziehende nicht mehr explizit thematisch bleibt. Das Differenzgeschehen wirkt dabei nicht innerhalb des Augenblicks, wie in einer temporalen Hülle, vielmehr eignet dem Augenblick die Struktur des Differenzgeschehens. Denn die semantische Vielwertigkeit des Farbwortes blau hält in temporaler Hinsicht zumindest zwei Zeitformen offen: die der genannten Gegenwart und die der Vergangenheit. Beide erscheinen im Zusammenhang des dichterischen Feldes als möglich.
Ein blauer und nicht ein anders gearteter Augenblick, der nun nur noch Seele ist, kann sich durchaus auf das Vergangene der Kindheit beziehen: Seele ist allein noch der vergangene Augenblick, wo die Kindheit ruhig in blauer Höhle wohnte. Gemeinsam mit dem Gegenwartsaspekt zeitigt sich auf dieser Stufe des Gedichts somit der blaue Augenblick als das Diferenzgeschehen, das Trakl als Seele denkt. Aufgrund dieser Verflechtung von Präsentischem und Vergangenem, die das Ich selbst ist, ohne dabei einen Standpunkt einnehmen zu können, der sich außerhalb dieser Verflechtung befände, bezeichnet das Differenzgeschehen den wesentlichen Selbstentzug des Ich. Er scheidet nicht nur das gegenwärtige Ich vom vergangenen, sondern durchzieht als Spalt auch das präsentische Ich. Dieses das Ich zweifach dezentrierende Differenzgeschehen verdichtet sich in dem blauen Augenblick: In ihm findet sich das Ich im Anderen (der Kindheit) und den Anderen (der Kindheit) in sich . Das Sinnen ist sich als Effekt des Differenzgeschehens selbst durchsichtig geworden. Kraft der unaufhebbaren Absenz in der Gegenwart des Sinnens vermag es nicht an das Ziel einer Selbstaneignung zu gelangen.
Der blaue Augenblick ist somit ein in sich mehrfach verspannter Zeitraum, der weder innerhalb der Zeit noch außerhalb ihrer anzusiedeln ist, mit dem sich vielmehr erst so etwas wie Selbst- und Weltbezug in der aufgezeigten Weise konstituiert.
▲
II
In der modernen Dichtung findet sich vielfach eine herausgehobene Zeit, die mit der Farbe Blau belegt ist. Erwähnt sei nur die „Blaue Stunde“ bei Stefan George oder Gottfried Benn. Bekanntermaßen fungiert für Benn das Farbwort Blau als das „Südwort schlechthin“ und Dichtung als „Zusammenhangsdurchstoßung“, wobei Blau die Farbe ist, die diese vornehmlich bewirkt. Hier ließen sich Linien zum Benn-Leser Rolf Dieter Brinkmann ziehen, dem wichtigen Vermittler der amerikanischen Underground- und Pop-Literatur der späten sechziger Jahre. Dessen Dichtung, die unterwegs ist auf ein „anderes Blau“, das für einen Bereich steht, der ebenfalls analog zu Benn erst zugänglich wird durch die Durchstoßung von habituellen Zusammenhängen. Dieses andere Blau wird Brinkmann zufolge gerade in jenen Gegenbildern evoziert, wie sie ihm singuläre Alltagsdetails,kulturelle Diversität und gewisse Naturphänomene und nicht zuletzt Rockmusik vermitteln.
Auch in den titelgleichen Gedichten bei Benn und George handelt es sich um eine Form der Selbstzeitigung, wobei der in dem Wort ´Selbst´ liegende Doppelsinn ausdrücklich mitzuhören ist: „selbst“ meint einmal das Wesen einer Sache oder Sachverhalts, zum anderen aber auch das Fürsichsein dessen, was in der Subjektphilosophie mit Ichbewußtsein bezeichnet wird. Auf die Selbstzeitigung bezogen, wäre das einmal die objektive Zeit und zum anderen die subjektive, das Zeiterleben; beides greift hier ineinander.
In Georges Gedicht „Blaue Stunde“ eignet der blauen Stunde ein Schwellencharakter. Ihre Gegenwart ist Übergang und ihr Erleben vollzieht sich an der Schwelle von gegenwärtiger Wahrnehmung und Erinnerung: Wenn es zum Gedichtausgang von der blauen Stunde heißt:“Wie eine tiefe weise/ Die uns gejubelt und gestöhnt/ In neuem paradeise/ Noch lockt und rührt wenn schon vertönt“, so ist ihr zum einen eine Nachträglichkeit eingeschrieben, das heißt die Unmittelbarkeit ihres Erleben ist allein im Modus der Nachträglichkeit zugänglich, zum anderen zeigt sie deutlich den Doppelsinn, der in der Selbstzeitigung liegt. Die Zeit der blauen Stunde ist es, die die Gestimmtheit des „Jubelns“ hervorbringt, die ihrerseits im erlebenden Ich im Entschwinden erst sagbar wird.
Das Motiv der blauen Stunde erscheint explizit zum ersten Mal in der Malerei 1890 in Max Klingers Gemälde „Blaue Stunde“. Fortan wird mit der tageszeitlichen Dämmerung oftmals ein seelisches Dämmern verbunden. Fernwirkung und Transparenz des Blau lassen es zur Farbe von Seelenräumen werden. In diesem Sinne stellt sich die Verwendung des Farbwortes Blau in der Lyrik bei Georg Heym vor. Der wichtigste Unterschied zu Trakls Verfahren besteht in dem Grad, wie der sinnlich-optischen Qualität der Farbe eine ungleich stärkere Bedeutung zukommt. Damit hängt zusammen, dass bei Heym das im Gedicht gestaltete Geschehen zumeist von einem festen Blickpunkt aus erfasst wird. Der Blickpunkt fungiert dabei als Kompositionsmittel, indem die Komponenten eines Phänomens von einem gemeinsamen Punkt aus ihre Ordnung erfahren. Der Umstand des Blickpunkts ist es auch, der bewirkt, dass bei Heym auch bei vom Substantiv losgelösten Farbwörtern immer eine raum-zeitlich zu verortende Sinnlichkeit des Farbwertes mitschwingt. Das Gedicht „Träumerei in Hellblau“ macht das deutlich.
Träumerei in Hellblau
Alle [Landschaften] haben
Sich mit Blau gefüllt.
Alle Büsche und Bäume des Stromes,
Der weit in den Norden schwillt.
Blaue Länder der Wolken,
Weiße Segel dicht,
Die Gestade des Himmels in Fernen
Zergehen in Wind und Licht.
Wenn die Abende sinken
Und wir schlafen ein,
Gehen die Träume, die schönen,
Mit leichten Füßen herein.
Zymbeln lassen sie klingen
In den Händen licht.
Manche flüstern, und halten
Kerzen vor ihr Gesicht.
Das in den ersten beiden Strophen berufene Landschaftsbild vermag von einem Betrachter widerspruchfrei sinnlich vorgestellt zu werden. In den beiden Schlussstrophen wendet sich der Blick und eröffnet eine innere Landschaft. Die äußere und innere Landschaft verbindet das substantivierte Blau des zweiten Verses, was rückwirkend der Gedichtanfang „Alle Landschaften“ zum Ausdruck bringt. Auch wenn sich das Gedicht vordergründig einer übersichtlichen Ordnung unterstellt, so bewirkt die isolierte Stellung des Farbwortes Blau eine nicht zu hintergehende Verspannung von Subjektivem und Objektivem.
▲
III
Zum Schluss sollen noch einmal Verwendungsmöglichkeiten des Farbwortes Blau bei Trakl anhand des Gedichts „Nachtseele“ kurz aufgezeigt werden. Gerade vor dem Hintergrund des Gedichts Heyms vermag sich das Spezifische des dichterischen Feldes abzuheben. Das Augenmerk richtet sich auf die Eingangsstrophe des Gedichts in der Gestalt der Druckfassung, sie besteht aus drei Versen und wird von einem einzige Satz geformt:
Schweigsam stieg vom schwarzen Wald ein blaues Wild
Die Seele nieder,
Da es Nacht war, über moosige Stufen ein schneeiger Quell.
Temporal wird er getragen von der Präteritumsform des egrissiven Verbs ´niedersteigen´ Dem einen Prädikat des Eingangssatzes sind indes drei parallele Subjekte zugeordnet. Die Mehrfachbezüge , die "blaues Wild", "Seele" und "schneeiger Quell" mit dem Verb eingehen, schaffen aufgrund dieser syntaktischen Offenheit semantische Überlagerungen, die mit dem Begriff der Metapher nicht zu erfassen sind.
Indem das Verb niedersteigen die drei Substantive zusammenbindet, sich gleichermaßen auf sie bezieht, verweisen diese aufeinander, so dass es zu einer umlaufenden kreisenden Sinnbewegung kommt. Nun fächert sich nicht allein die Antwort auf die Frage: Wer oder was niederstieg? dreifach auf, sondern der Vorgang des Niedersteigens empfängt von dein Verweisungsgeschehen Rückwirkungen. Seinerseits nimmt er die verschiedenen Bedeutungsaspekte der drei Subjekte auf. Z. B. ist das Niedersteigen der Seele ein anderes als das des schneeigen Quells.
Innerhalb dieser parallelen Dreigliedrigkeit lassen sich Differenzierungen vornehmen. Die "Seele" steht in einer appositionellen Nähe zu "blaues Wild". Das Farbwort blau in der Verbindung mit "Wild" entstofflicht das Substantiv. Eine Isotopie zu "Seele" stellt sich ein. Zugleich erhält sich das Körperhafte im Rückverweis auf den Kontext Natur, den der"schwarze Wald" hervorruft. In dem vergangenen Niederstieg sind das Sinnliche und Nichtsinnliche, das Wörtliche und Bildliche miteinander verschränkt, verflochten. Im Naturvorgang des herabkommenden Quells ist die "Seele" mit anwesend, wie umgekehrt im Niederstieg der "Seele" die Natur. Nun ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich die genannte wechselseitige An- und Abwesenheit nicht zu einem Gesamtgeschehen vereinigen lässt. Eine Bezugsbahn realisiert sich, indem eine mögliche andere unterdrückt, überlagert wird, welche aber dennoch, wenngleich verdeckt, als verdeckte durchscheint. Die besagte Störung der Kongruenz in „niedersteigen“ und "Quell" verhindert die Ineinsbildung von "Seele" und "Quell". Zugleich sind beide Subjekte über dasselbe Verb miteinander verbunden. Das Naturbild des Baches ist nur zu realisieren, wenn die Bedeutungsaspekte, die sich mit `niedersteigen´, und "Seele" verbinden, vernachlässigt werden und umgekehrt, wobei "Stufen" und `niedersteigen´ kongruieren.
Sofern sich die Strophe sowohl zu einem Naturbild als auch — traditionell gesprochen — zu einem metaphysischen Geschehen ordnen kann, so bedeutet das Zugleich hier eine wechselseitige Verdeckung. Das Naturhafte wie das Metaphysische, oder vorsichtiger gesagt: Sinnliches und Nichtsinnliches überlagern sich gegenseitig, da sie sich jeweils über verschiedene Beziehungsbahnen herstellen-, das heißt: es liegt weder ein Naturbild noch ein transzendentes metaphysisches Geschehen vor. Eine bildliche Repräsentation einer transzendenten Bezugsdimension oder eines anders gearteten höherstufigen Ordnungszusammenhangs vermag sich nicht durchzusetzen.
Insofern in keiner der Relationen Selektionsbeschränkungen nicht verletzt werden, eignet dem Verb ein Sinnüberschuß, der sich über die ganze Strophe legt. In keinem der drei Verbindungen ganz aufgehend, behält es qua Sinnüberschuß eine Buchstäblichkeit oder, wie noch treffender zu sagen wäre, einen Eigenstand. Das Verb ist niedersteigen ist nur imstande, die Mehrfachbezüge zu den drei Substantiven einzugehen, weil es in keiner einzelnen Relation zur Kongruenz konmt. Das nicht ganz Aufgehen, infolge der Abweichungen, bewirkt, dass sich weder eine wörtliche noch eine metaphorische Bedeutung festschreibt. Dieses gilt ebenso für die Substantive: "blaues Wild", "Seele" und "schneeiger Quell" ergeben zusammen eine Sequenz, gewissermaßen einen dissonanten semantischen Dreiklang. Keiner der Ausdrücke gelangt zur Kongruenz mit dem Verb. „Quell" und "Seele" verweisen auf Sinnliches und Nichtsinnliches; in "blaues Wild" berühren sich beide Bereiche in der Weise einer Überkreuzung. Es ist der Ort, wo sich beide Ebenen verschränken, daher eignet ihm keine höhenstufige Repräsentation, es liegt diesseits eines Stufungsgefüges. Man kann auch sagen, das Schema Sinnliches-Nichtsinnliches ist in "blaues Wild" überwunden, aber nicht spannungslos. Stiege allein ein "blaues Wild" nieder, es bliebe bloß bei einer zeichenhaften Behauptung.
Hier wird einsehbar, wie die Topographie des dichterischen Feldes erst das Widerspiel von Beziehungen eröffnet, darin "blaues Wild" als der thematische Ort einer Schwelle anzusehen ist. Sinnliches und Nichtsinnliches überkreuzen sich in der Weise, dass im Übergang das Sinnliche des Naturbildes, das sich in "Wild" artikuliert, auf das im Farbwert Blau konnotierte Nichtsinnliche der Seele deutet und umgekehrt. Wird das eine aufgelichtet, entzieht sich das andere, bleibt aber als solches anwesend. Im Übergang der einen Sinnbeziehung zur anderen, die beide nicht unter einer übergreifenden Ordnung subsumierbar sind, befindet man sich nicht mehr in der einen und noch nicht in der anderen Ordnung.
Dergestalt eine Schwelle bezeichnend, kommt im "blaue[n] Wild" das Fremde zur Sprache. Wenn es kennzeichnend für das Fremde ist, als ein Anderes, das sich entzieht, ein Dieses hervortreten zu lassen, so konzentriert sich in der für sich genommen wohl rätselhaftesten Wortfügung der Strophe sichtbar das Fremde. Denn im Feldzusanimenhang eingebunden weist "blaues Wild" stets auf ein Anderes, das sich topographisch als ein Anderswo zeigt, je nachdem, ob der Bezug zu "Seele" oder zum Naturbild des "schwarzen Wald[es]" aufgelichtet wird. Da sich allerdings im Feld die in Frage stehenden pluralen Ordnungen wechselseitig abheben wie verdrängen, tauscht das Fremde mit den sich verändernden Ordnungen seinen Platz. Es erscheint überall dort, wo die aufgezeigten Überlagerungsphänomene stattfinden. Das "blaue[ ..] Wild" ist kondensierter Ausdruck dessen, was in dem zur Sprache Gelangenden wie ein Schatten mitläuft.
Deutlich geworden ist, wie infolge der besonderen Verwendung des Farbwortes Blau im dichterischen Feld eine Destruktion von Seinsbegriffen, kategorialen Hierarchien und Zuordnungen erfolgt, die aus dem Bereich der abendländischen Metaphysik entstammen. Die textkonstituierende Dynamik des Farbwortes Blau ist da am stärksten und nimmt eine nicht zu ersetzende Funktion ein, wo es strukturell verwendet wird, weniger dort, wo es Thematisches beruft. Seine Dynamik zeigt sich hier vor allem darin, dass es die metaphysikgeschichtlich wirkungsmächtige Unterscheidung von Sinnlichem und Nichtsinnlichem aufhebt zugunsten einer schwellenförmigen Verspannung, die einhergeht mit mit einer Entmetaphorisierung. Beides unterläuft die Entgegensetzung von Subjektivem und Objektivem, Eigenem und Fremden, erlebter Zeit und objektiver Zeit. An die Stelle einer solchen Scheidung tritt das dichtersiche Feld als Ort einer Selbstermöglichung, die das Entstehungsgeschehen nach Maßgabe der Verwendung des Farbwortes Blau gegenwärtig hält.
▲
Anmerkungen:
2.11.Ordnung im Übergang. Zur Verwendung des Farbwortes Blau im dichterischen Feld der
Lyrik der Moderne
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Hartmut Cellbrot:
Ordnung im Übergang. Zur Verwendung des Farbwortes Blau im dichterischen Feld der Lyrik der Moderne-
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/2-11/2-11_cellbrot.htm
Webmeister: Branko Andric last change: 2010-02-09