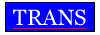 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
September 2008 |
|
| Sektion 7.12. |
Eliten als Orientierungsgeber oder als ‚Sozialschmarotzer’? Zur soziokulturellen Bedeutung von Elitehandeln in gesellschaftlichen Transformationsprozessen
Sektionsleiterin | Section Chair: Jens Aderhold (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ISInova – Institut
für Sozialinnovation e.V. Berlin)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
Selbstbild und Selbstinszenierung der ökonomischen Elite
in autobiographischen Selbstdarstellungen
Renate Liebold (Universität Erlangen-Nürnberg) [BIO]
Email: RLiebold@t-online.de
Spitzenmanager und Unternehmer greifen gern zur Feder und es liegt eine Vielzahl von – auch aktuellen – autobiographischen Darstellungen vor, in denen das Phänomen des eigenen Lebenswerks und Karriere-Erfolgs mitsamt einer Erfolgs-Persönlichkeit veröffentlicht wird. Um solche Selbst-Veröffentlichungen von Top-Managern soll es in den folgenden Ausführungen gehen.(1) Dabei steht die Frage im Zentrum, wie sich die verschiedenen Autoren in einem spezifischen Kontext medialer Öffentlichkeit, nämlich in Autobiographien selbst entwerfen und thematisieren. Welche (Selbst-)Deutungen und Wissensrepertoires werden bemüht, um die Vorstellungen einer Leserschaft über Top-Manager zu bedienen und zu nähren? Kurzum, es geht darum, die Inszenierungsformen und Selbstdarstellungsgebärden der Wirtschaftselite in autobiographischen Veröffentlichungen zu rekonstruieren.
Die Fragestellung erfordert zunächst einen Blick auf das literarische Genre und so soll kurz bestimmt werden, was unter einer Autobiographie zu verstehen ist (Pkt. 1). Danach wird es um einen Überblick über die Entwicklung der unterschiedlichen Möglichkeiten der Selbstpräsentation und -thematisierung gehen (Pkt. 2). Im empirischen Vergleich aktueller top-managerialer Autobiographien wird deutlich, dass die Erinnerungstexte heldenhafte Erfolgsgeschichten dokumentieren, mit denen u.a. das eigene Geltungsbedürfnis auf Dauer gesichert werden kann (Pkt. 3). Als Kompositionselemente dieses wirtschaftlichen Heldentums teilen die Autobiographien eine ganz spezifische Formensprache und Rhetorik, über die es gelingt, die jeweiligen Berufskarrieren und erreichten Positionen als außergewöhnlich, unplanbar und unerlernbar zu präsentieren und darüber hinaus die gesellschaftliche Relevanz der Lebenswerke zu dokumentieren (Pkt. 4). Schließlich kann die empirische Analyse zeigen, dass die Autobiographie von den Autoren auch dazu genutzt wird, sich gewissermaßen in die Elite hineinzuschreiben: Über eine wirtschaftsbürgerliche Herkunft samt Familientradition versuchen die Autoren, Reputation zu demonstrieren und auch nachzuholen (Pkt.5). Schließlich werden die Ergebnisse noch einmal gebündelt resümiert.
1. Was ist eine Autobiographie – eine Genrebestimmung
Die Autobiographie kann zunächst einmal ganz allgemein als die "Beschreibung (graphia) des Lebens (bios) eines Einzelnen durch diesen selbst (auto)“ definiert werden (Georg Misch (1907/1989, 33). Trotz des hybriden und fließenden Charakters der Gattung gegenüber anderen Genreformen (Memoiren, Tagebücher, Hauschroniken, Selbstverständigungsliteratur) sind Selbst-Erfahrung, Selbstauslegung, Verständigung mit Anderen feste Größen, in denen sich autobiographisches Schreiben vollzieht. Das formale Gerüst der Autobiographie ist, so Michaela Holdenried (2000), trotz historischer Veränderungen im Kern unverändert geblieben: „Ein Mensch beschreibt sein eigenes Leben, in der Regel von den ersten Erinnerungen bis zum Schreibzeitpunkt oder zu einem anderen zäsurbildenden Zeitpunkt“ (ebd., S. 12). Als Orientierungsrahmen dient der Lebenslauf, mit Hilfe dessen die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit, die Geschichte eines Werdens und einer Bildung, eines Hineinwachsens in die Gesellschaft beschrieben wird. Die literarischen Wurzeln der Autobiographie reichen dabei zurück auf die Confessiones des Augustinus (397). Für die jüngere Zeit gelten Rousseaus Bekenntnisse (1782 - 1787) und Goethes Dichtung und Wahrheit (1811 - 1833) als Vorbilder der Gattung.
2. Entwicklung und Möglichkeiten (auto-)biographischer Selbstthematisierung
Die (Auto-)Biographie ist nun keineswegs ein historisch universales Phänomen. Eine der zentralen Erkenntnisse der historisch interessierenden (Auto-)Biographieforschung ist, dass „jenes Format, das wir auch heute noch mit der Idee der modernen Biographie verbinden, erst relativ jung ist und an die Entstehung der europäischen Moderne gebunden bleibt (Ahlheit und Brand (2006, S. 11). Dabei ist keineswegs nur die literarische Form der Autobiographie gemeint, sondern allgemein eine „spezifische Konfiguration der Selbst- und Weltreferenz“ bzw. „ein sich allmählich veränderndes Verhältnis von ‚Außen’ und ‚Innen’ der Selbstwahrnehmung“ (ebd., S.11). Gewiss ist die Vorstellung, dass Menschen eine Biographie haben, nicht ausschließlich an die Moderne gebunden – so gibt es etwa in der griechisch römischen Antike eine gewisse Tradition der Lebensbeschreibung (Plutarch) und auch im Mittelalter werden Hagiographien oder ‚säkulare’ Darstellungen (z.B. die Confessiones Augustins) angefertigt, trotzdem steht fest, dass in diesen vormodernen biographischen Schilderungen nicht die Entwicklung konkreter Individuen, nicht die Entfaltung subjektiver Einzigartigkeit – einer „Identität-Für-Sich“, wie dies Alois Hahn genannt hat (Hahn 1988, S. 93) – im Vordergrund steht, sondern die Präsentation möglichst idealer Charaktertypen. Biographien dienten in der Regel der Unterhaltung, der Belehrung oder der Herrschaftslegitimation. Die Idee der persönlichen Entwicklung und damit einhergehend das klassisch-moderne Format der Autobiographie entsteht zumindest in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts und verbreitet sich zunehmend im 19. Jahrhundert. Das Zentrum der Lebensgeschichte ist dann nicht mehr das traditionelle Sinnuniversum wie Religion oder Wertewelt, sondern eben „die Idee einer in ihrer Entwicklung und Einzigartigkeit unverwechselbaren Persönlichkeit“ (Ahlheit / Brand 2006, S. 17). Von daher lässt sich die dominante Konstruktionslogik als ein „innerer Modus“ bestimmen, eine selbstreferenzielle Aktivität – eine persönliche Semantik, „mit der das moderne Individuum neue Erfahrungen aufschließt und sie zu seinen je eigenen macht“ (ebd., 17ff.)
Insgesamt verliert die (auto-)biographische Selbstthematisierung im Laufe der Zeit immer mehr den Status der biographischen Dokumentation gesellschaftlichen (und auch ökonomischen) Erfolgs und gewinnt stattdessen den Rang eines Mediums der Selbstverständigung (vgl. Holdenried 2000). Im Hinblick auf ihre Formen und Formvorstellungen lässt sich ein Prozess der Individuation sowohl im Selbstbewusstsein der Autobiographen als auch in der Form ihrer Lebensbeschreibungen beobachten (vgl. Niggl 1998, S. 15). Ein Beispiel für das moderne autobiographische Schreiben (z.B. bei Sartre) ist dann etwa die „existenziell reflektierende“ Autobiographie (Picard 1998), in der die Retrospektive, anders als bei der traditionellen Autobiographie, nicht die errungene und gelungene Identität bezeugt, sondern einem unabschließbaren Selbstentwurf des gegenwärtig Schreibenden dokumentiert. Zudem gilt mittlerweile die unhintergehbare „literarische Emanzipation der Autobiographik vom Zweckformstatus“ (Holdenried 2000, S. 23). Gemeint ist damit ein Paradigmenwechsel vom „Erzählen über die Identitätsfindung zum Finden der Identität durch das Erzählen“ (Neumann 1991, 99). In diesem Kontext wird auch diskutiert, ob Identität weiterhin das Ziel autobiographischen Erzählens sein kann oder ob nicht vielmehr aktuelle autobiographische Formen dieses teleologische Muster weit hinter sich lassen. Dies führt zu Debatten um Gattungsaffinitäten der Autobiographie zu Roman, Biographie und Memoiren, wobei der Roman für die „adäquate Darstellungsform der sich herausbildenden Individualitätskonzeption“ (Holdenried 2000, S. 28) gilt. Demgegenüber seien Memoiren die bevorzugte Form der Selbstdarstellung von Personen des öffentlichen Lebens geworden. Sie übernähmen verstärkt die „klassischen Aufgaben der Autobiographie aufgrund ihres an lebensgeschichtlich-biographischen Ganzheitsvorstellungen orientierten Individualitätsverständnisses“ (ebd., S. 33), das grundlegende Strukturmerkmale der Autobiographie aufgreift, nämlich die Offenheit zum Ende hin sowie die lebensgeschichtliche Rundung und eine gewisse Geschlossenheit (es handelt sich typischerweise um Alterswerke).
3. Die Autobiographien der Topmanager als Selbst-Darstellungsform von wirtschaftlichem Heldentum
Instruktiv für unser Thema erweisen sich die Überlegungen, dass sich Biographie als geradezu „neue soziale Wissensform“ (Ahlheit und Brand 2006, S. 15) darstellt. Darauf verweisen insbesondere die Arbeiten von Alois Hahn, der zwischen historisch universalen Formen der Selbstidentifikation (also den Biographien der Könige und Heiligen) und der biographischen Selbstreflexion als explizit verzeitlichter Form der Selbstthematisierung, also einem eindeutig modernen Phänomen, unterscheidet, das sich, wie bereits erwähnt, eben unter ganz bestimmten historisch-gesellschaftlichen Bedingungen herausgebildet hat. In diesem Kontext spricht Alois Hahn dann auch von „Biographiegeneratoren“ und meint damit, dass Selbstthematisierung in sozialen Institutionen stattfindet, die eine lebensgeschichtliche Form der „Rückbesinnung auf das eigene Dasein gestatten“ (Hahn 1987, S. 93). Es handelt sich bei diesen Generatoren also um Einrichtungen, in denen „Personen in sozial mehr oder weniger standardisierter Form sich selbst über ihr Leben Rechenschaft abgeben, um soziale Inszenierungen, in denen die eigene Vergangenheit thematisch und rekonstruiert wird, in denen der ‚Lebenslauf’ in eine Biographie transformiert wird“ (Hahn 2003, 14f.). In verschiedenen Gesellschaften existieren unterschiedliche Biographiegeneratoren und es spielt beispielsweise eine Rolle, welche Darstellungsformen für den biographischen und autobiographischen Diskurs zur Verfügung stehen. Historisch gesehen gilt die Beichte im europäischen Raum als die repräsentative Form der Autothematisierung. Sie hat die Geschichte des christlichen Abendlandes geprägt und ist bedeutsam gewesen für die Entstehung eines Menschenbildes und das vorherrschende Selbstbewusstseins. Und sie hat Modellcharakter für andere Biographiegeneratoren – beispielsweise für therapeutische, medizinische oder gerichtliche Bekenntnis- und Geständnisformen. Ob Beichte, Autobiographie oder Psychoanalyse, in allen Fällen geht es darum, dass „eine soziale Institution auf ganz bestimmte Weise die Individuen zur Befassung mit sich selbst bringt und die im jeweiligen Kontext erzeugten Selbstbilder dann verpflichtend werden lässt“ (Hahn 1987, S. 18). Auch die hier zur Debatte stehenden Autobiographien der Wirtschaftelite lassen sich in dieser Lesart als eine ganz bestimmte Form der Erinnerungsdarstellung lesen, mit der sich die Autoren nach bestimmten Gattungsregeln des Erzählens coram publico inszenierenund sich dabei mit ihrer Vergangenheit identifizieren. Die Auswahlkriterien, denen solche erinnerten Darstellungen folgen, sind allerdings jeweils andere. Im Falle der Beichte ist es, folgt man Hahn, die eigene Schuld, im Falle der massenmedialen autobiographischen Selbst-Thematisierung von Wirtschafts-Managern ist es der Ruhm oder das Heldentum. Das eigene Leben wird in Form eines exzeptionellen Karriereverlaufs, einer herausragenden Lebensleistung und im Hinblick auf außergewöhnliche Persönlichkeitseigenschaften inszeniert und auf Dauer gesichert. Durch die Beichte wird vor allem (lassen wir die Möglichkeit der Ablasszahlung einmal beiseite) die Hoffnung auf jenseitiges Heil durch die bereuten Sünden genährt, im Falle der autobiographischen Erinnerung der Wirtschaftselite scheint der Gewinn neben einem Geltungsbedürfnis auch über das eigene Ableben hinaus vor allem im Diesseits zu liegen, in der öffentlichen Präsenz und Anerkennung der zur Schau gestellten Leistungen.
Wie dieses ‚wirtschaftliche Heldentum’ empirisch zum Ausdruck kommt, soll im Folgenden sowohl im Rekurs auf die ganz spezifische Formensprache als auch an den jeweiligen Darstellungsgebärden gezeigt werden.
4. Die Kompositionselemente wirtschaftlichen Heldentums
Helden sind ‚ohne Gleichen’; sie verkörpern die Ausnahme, die erst die Regel schafft. Sie sind nur jenseits der engen Grenzen des Alltagslebens denkbar, voller Verachtung für Routine und Konvention (Giesen 1999). Da sie jenseits der sozialen Ordnung stehen, sondern da, wo weder Eigennutz oder Rat der anderen gelten, sind sie einsam und schaffen das Unvergleichliche und Unvorhergesehene. „In diesem schöpferischen Akt konstituieren sie jene überlegene Subjektivität und Individualität, welche die Bewunderung und das Staunen gewöhnlicher Menschen hervorrufen“ (ebd., S. 438f.).
Auf unseren Gegenstand bezogen, nämlich die Autobiographien von Top-Managern, gelingt den Autoren die Darstellung ihrer (heroischen) Erfolgs-Biographie über eine Besonderung qua Unterscheidung, wobei die Relevanzkriterien für die Auswahl der erinnerungswerten Ereignisse des eigenen Lebens meist an behaupteten Eigenschaften ansetzen, von denen die Autoren meinen, sie seien ihnen persönlich eigentümlich, und zwar im Gegensatz zu anderen Personen. In den Autobiographien der Top-Manager sind dies in der Regel ‚gewöhnliche Menschen’, ‚gewöhnliche Angestellte’, ‚gewöhnliche Manager’ und ‚gewöhnliches Führungspersonen’. Die Exzeptionalität der eigenen Karriere, die öffentliche Präsenz und der hinlängliche Bekanntheitsgrad der Personen sind der Ausgangspunkt, die Gewöhnlichkeit hingegen ist der Vergleichshorizont, vor dem die autobiographische Selbst-Darstellung der Top-Manager erfolgt.
Von daher sind die Autobiographien deutscher Top-Manager nicht mit einer spezifischen Fachliteratur zu verwechseln, wie sie etwa in Buchläden internationaler Flughäfen gerne unter dem Genre Berater- und Managerliteratur vermarktet wird; eher lassen sich die Selbst-Darstellungen der deutschen Top-Manager als eine Art Prominenten-Autobiographie charakterisieren, in denen sie ihr wirtschaftliches Heldentum fundieren, legitimieren, zementieren und zelebrieren und in denen sie, wie noch gezeigt werden kann, Reservate wirtschaftsbürgerlicher Exklusivität (Pohlmann u.a. 2007) demonstrieren. Dabei stellt sich dann natürlich die Frage, ob es einen Unterschied zwischen Elite und Prominenz gibt und wenn ja, wo die Demarkationslinie zwischen beiden verläuft. Elite, so Münkler (2006), konstituiere sich über persönlich zurechenbare Leistung, Prominenz über Bekanntheit. Erfolg spiele in beiden Fällen eine Rolle, aber – und darauf kommt es an – über ihn wurde auf unterschiedlichen Bühnen und vor einem verschiedenen Publikum entschieden: „Mit der Inversion der unterschiedlichen Bühnen und der Mischung des Publikums, die zwangsläufige Begleiterscheinungen des Erfolgs und seiner Kriterien sind, wird die Unterscheidung von Prominenz und Elite schwieriger.“ (a.a.O., S. 38). Für den Fall der Top-Manager ließe sich vermuten, dass ihre selbstrepräsentative Wendung in Form von Erinnerungstexten nur deshalb gelingt, weil sie bereits als bekannte Figuren der Wirtschaft zum Gegenstand öffentlicher Aufmerksamkeit, Bewunderung und Kritik geworden sind. Erfolg und öffentliche Anerkennung stehen im Zentrum ihres eigenen Elitehandelns. Während frühere Autobiographen aus Unternehmerschaft und Management – man lese nur Henry Ford – Weltanschauungen und Leistungsprinzipien in den Mittelpunkt ihrer Autobiographie stellten – zumindest den Mythos bedienten (vgl. dazu auch Hansen 1992), rückt in den heutigen, uns vorliegenden Autobiographien die ‚profanisierte’ Lebensgeschichte in die öffentliche Aufmerksamkeit. Sie ist – zumindest vordergründig - nicht mehr mit dem Anspruch eines Lehrstückes geschrieben, besitzt keine Vorbildfunktion und enthält sich des Diskurses über Lebens-, Organisations- und Produktionsprinzipien als dem strukturierenden Element ihrer Erzählungen. Gleichwohl wird die geneigte Leserschaft durch die Hintertür mit einem Wertehimmel und dem dazugehörigen Lebensführungskonzepten konfrontiert, sprich: mit Lebensstilvorlieben, demonstrativen Konsumgewohnheiten, Geschlechter- und Familienbildern u.ä.. Die Autoren erinnern dabei in mancherlei Hinsicht auch an die „Freizeithelden“, wie sie Dreitzel bereits 1962 beschrieben hat. Diese Film- und Theaterstars, Modeschöpfer, Literaten und zuweilen auch Philosophen und Kulturkritiker haben mit anderen Eliten gemeinsam, dass sie mit ihren Werten und ihrem Lebensstil Orientierungspunkte für ‚richtiges’ Handeln repräsentieren oder, mit den Worten Dreitzels, durch ihr „bestimmtes, durch Persönlichkeit und Werk geprägtes Gehabe, ihre Anschauungen, Gesten Moden und Stimmungen, kurz ihr charakteristisches Sosein“ (Dreitzel 1962, S. 148) im öffentlichen Raum sichtbar sind.
Die Autobiographen der Top-Manager sind – auch dies ist ein gemeinsames Strukturmerkmal ihrer heldengleichen Erzählungen, nicht für Nachahmungszwecke geschrieben. Ihre Einzigartigkeit entspricht dem Ausnahmecharakter ihrer Lage. Zwar kann man an den Lebensdarstellungen der Wirtschaftseliten sehen, welche Leistungen, welches Handeln und welches Sein gesellschaftlich anerkannt und prämiert wird, gleichwohl werden in den Autobiographien exzeptionelle Karrieren vorgeführt, die an ihre Träger gebunden sind. Sie lesen sich nachgerade als Dokumente für deren Unplanbarkeit und Unerlernbarkeit.Im Kern wird damit auch Einzigartigkeit und Außergewöhnlichkeit vorgetragen, die einer Wiederholung per se entgegenstehen. Unausgesprochen und ausgespart bleibt in allen Werken, was an ‚gewöhnliche Berufskarrieren’ erinnert: Eifer und Anstrengung, Leistungsverausgabung, Fleiß und Strebsamkeit – alles Tugenden und Sittsamkeiten der oberen Dienstklasse, des höher qualifizierten Angestellten im ‚Gehäuse betrieblicher Herrschaft’ (Max Weber). Die Selbstveröffentlichungen der Top-Manager beglaubigen hingegen nachdrücklich ein Persönlichkeitsprofil, das Charakter und Eigenart voraussetzt: Mut und Entschlossenheit, Abenteuerlust, Hingabe, Intuition, Wissbegierde, Schaffenslust – allesamt Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften, die den Trägern dieser exzeptionellen Karrieren zueigen sind und die man(n) sich nicht erarbeiten kann. Gerade dadurch wird auch die soziale Konstruktion der Wirtschaftsheroen sichtbar. Die Autobiographien (re)produzieren nachgerade ein Spiegelbild kultureller Vorstellungen überlegener Individualität, kollektiver Projektionen souveräner Subjektivität. Sie sind in ihrer Fiktionalisierung allmächtig, in ihrer alltäglichen Präsenz jedoch nicht vorhanden. „Kein Held hält den Blick aus der Nähe aus“ (Giesen 1999, S. 439), denn gerade die Distanz und Unnahbarkeit bleibt die Voraussetzung der Einzigartigkeit.
 Beispielhaft soll ein Blick auf die autobiographische Textproduktion des Wirtschaftsmanagers Hans-Olaf Henkel geworfen werden, der als einer der populärsten Top-Manager Deutschlands gilt. Bis 1993 war er Europachef bei IBM, von 1995 bis 2000 fungierte er als Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, seit 2000 lehrt der Ehrendoktor der TU Dresden als Honorarprofessor an der Universität Mannheim. Im Jahr 2002 veröffentlicht Henkel seine Autobiographie mit dem Titel „Die Macht der Freiheit“ seine Lebenserinnerungen.
Beispielhaft soll ein Blick auf die autobiographische Textproduktion des Wirtschaftsmanagers Hans-Olaf Henkel geworfen werden, der als einer der populärsten Top-Manager Deutschlands gilt. Bis 1993 war er Europachef bei IBM, von 1995 bis 2000 fungierte er als Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, seit 2000 lehrt der Ehrendoktor der TU Dresden als Honorarprofessor an der Universität Mannheim. Im Jahr 2002 veröffentlicht Henkel seine Autobiographie mit dem Titel „Die Macht der Freiheit“ seine Lebenserinnerungen.
Ich beschränke mich bei der Interpretation hier zunächst auf den Titel (‚Die Macht der Freiheit’) sowie die Umschlaggestaltung der Autobiographie. Beide liefern als Textdokumente bereits bemerkenswerte Einsichten, denn mit beiden Aussagen wird die Erwartung inszeniert, es handle sich hierbei um eine unkonventionelle und individualistische Denkart und Weltanschauung eines mächtigen Mannes. Zunächst zum Umschlagbild, das den Autor fotographisch porträtiert: Das Bild lebt von Hell-Dunkel-Kontrasten. Im Vordergrund das be’sonn’ene Gesicht und die Cordjacke, das mit dem Dahinter und ‚Darunter’, nämlich einem tiefschwarzes Polohemd und schwarze Hose kontrastiert. Der Körper bleibt im Schwarzen (ist eher unsichtbar) und vereinigt sich mit dem dunklen Bildhintergrund, der aus Blättern und Tannenzweigen besteht. Das Bild zeichnet einen Spannungsbogen auf verschiedenen Ebenen: Neben den Kontrastierungen mit hell/dunkel sowie der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit fällt vor allem der Stilbruch in der Inszenierung des Outfits auf. Die legere Cordjacke, die auch an die Kluft wandernder Zimmerleute zu erinnern vermag zum einen und das tiefschwarze Polohemd samt Bundfaltenhose zum anderen. Das Lässige und Legere steht neben dem Seriösen und Gediegenen. Die randlose Brille dokumentiert Intellektualität, Tatkraft versprechen die Hände in den Hosentaschen. Eine erste Interpretation dieser Komposition durch Kontrastierung ist, dass in der Selbstdarstellung der Person diese verschiedenen Dimensionen eine Rolle spielen, zur Gesamtheit gehören. Die Jacke verbürgt, dem ersten Eindruck erliegend, Authentizität – zumindest aber Understatement. Er hat es möglicherweise nicht nötig und es ist auch nicht intendiert, die herausragende Berufsposition eines Top-Managers über Kleidung zu inszenieren. Obwohl die Vorstellung vom seriösen Dresscode eines Topmanagers nicht erfüllt wird und das Bild eines Mannes in lebensweltlicher Atmosphäre zeigt, markiert die Cordjacke kontrafaktisch einen Stilbruch oder: sie ist wie eine Attitüde, die, so eine weitere Interpretation - ein Grenzgängertum zum Ausdruck bringen soll. Nicht Understatement, sondern ein inszeniertes Spiel mit unterschiedlichen Zugehörigkeiten und deren Bedeutungen besondert den Darsteller.
Das Motto der Autobiographie („Die Macht der Freiheit“) klingt wie eine Losung und erweckt den Eindruck, dass die Vorlage der Lebenserinnerungen in der Tradition großer liberaler Denker steht. Die Fotographie unterstreicht diese Lesart. Sie rahmt die Botschaft, die im Titel anklingt, nämlich die Selbst-Darstellung eines Individualisten und Intellektuellen, der die Spiele der Macht und der Mächtigen durchschaut und sich aufgrund dieser Einblicke als kongenialer Sparringspartner erweist. Titelbild und Motto verheißen also, dass hier ein ‚widerständiger’ Freigeist spricht, der evtl. auch mit den Umständen, die er qua Position erfahren hat, abrechnen kann. Aufmachung und Duktus legen die Vermutung nahe, dass das Werk an eine gebildete Öffentlichkeit adressiert ist. Diese Leserschaft aus dem Feuilleton ist weder an einem wirtschaftspolitischen oder gar wirtschaftstheoretischen Spezialdiskurs interessiert ist, sondern an bewanderter Unterhaltung. Und in der Tat erfüllt seine ‚gelehrige’ Erinnerung hier den weit gefassten sozialen Horizont. Wie bereits durch die Choreographie im Titelbild angedeutet, erhält der Leser bzw. die Leserin eine generöse Abhandlung über Leben und Werk des Autors. Dabei komponiert er sich als einen Solitär, der qua Genialität seinen hohen Status erreicht hat. Er verachtet die Routine, den Alltag und die Konvention, überwindet die Grenzen der Organisation und verkörpert damit die heroische Ausnahme.
Ein weiteres Strukturelement, das die autobiographischen Erinnerungstexte der Wirtschaftselite teilen, ist ein Schreibanlass, der die unterstellte und zugeschriebene gesellschaftliche Relevanz ihrer Lebenswerke dokumentiert. So (re-)konstruieren sich die verschiedenen Autoren allesamt als tragende Figuren der Wirtschaftsgeschichte oder anders gewendet: Mit ihren Lebenserinnerungen definieren sie sich gewissermaßen in die Geschichtsschreibung hinein, nämlich über ingenieurwissenschaftlichen Pioniergeist (wie dies z.B. Ferdinand Piëch in seiner Auto.Biographie tut) sowie über Aufbruchs- und Fortschrittsvisionen (vgl. dazu die Autobiographien von Carl H. Hahn und Hans-Olaf Henkel). Alle diese Autoren deuten ihre herausragenden Positionen als einen angemessenen Ausdruck ihres gestalterischen Wirkens in einer Epoche der bundesrepublikanischen Industrie und Wirtschaftsgeschichte. Carl H. Hahn, einige Jahre Vorstandsvorsitzender bei VW, beginnt seine Autobiographie beispielsweise mit einer großen Geste:
„Warum greife ich in meinem Alter noch zur Feder? Über ein halbes Jahrhundert hatte ich das Glück, Industriegeschichte mitzuerleben und mitzugestalten. Volkswagen, als dessen Teil ich mich fühle, stieg in dieser Zeit aus dem Nichts zum viertgrößten Automobilhersteller der Welt auf. Über ein Jahrzehnt stand ich als Vorstandsvorsitzender an seiner Spitze. Da ich prinzipiell keine ‚vertraulichen Background-Unterhaltungen’ mit der Presse geführt habe und nie die Öffentlichkeit suchte, wenn ich angegriffen wurde, würde manches mit mir zu Grabe getragen, was zur Chronik von VW und der Nachkriegswelt gehört.“ (Carl H. Hahn 2005, S. 7)
Abgesehen davon, dass die große Rahmung seiner beruflichen Erfolgsgeschichte hier im Detail Aufdeckungsjournalismus ankündigt, in der der Autor auch gegen eine Rufschädigung anschreibt, wird hier gleich zu Beginn über die historische Relevanz seiner Person aufgeklärt: Er hat die Konzern- und mithin Industriegeschichte wesentlich (mit)geschrieben. Der Schreibanlass, der hier etwas ‚altväterlich’ daherkommt, ist also nichts weniger als die Identität von großer Weltunternehmung und persönlichem Engagement. Neben dieser (Selbst-)Zuschreibung einer historischen Rolle liegt die Vermutung nahe, dass der Autor hier auch gegen die prinzipielle Austauschbarkeit seiner Person rsp. seiner Position im Unternehmen anschreibt oder anders gewendet: Durch die schriftliche Dokumentation seines Schaffens kann er die Bedeutsamkeit seiner Person und die Geltungsdauer seines individuellen Wirkens sichern.
Bis hierher lässt sich also festhalten: Autobiographien sind massenmediale Selbst-Darstellungen im öffentlichen Raum. Durch sie wird ein außergewöhnliches Lebensbild produziert, das für andere zugänglich ist. Sie dokumentieren damit auch einen spezifischen Typus von Kommunikation, in der eine historisch und sozial bestimmte Subjektivität im Hinblick auf soziale Positionierung, Sprachform, Selbstdarstellung, aber auch in Begriffen und Grenzen der Selbstinterpretation hergestellt und interpretiert wird (vgl. dazu auch Sloterdijk 1978). Insofern enthalten Autobiographien immer auch kulturelle Vorgaben, die auf den jeweiligen Kontext des autobiographischen Schreibens verweisen. Um vom Eigenen öffentlich reden zu dürfen, müssen autobiographische Selbst-Darstellungen einen sozialen Erwartungshorizont bedienen und an kollektiven Relevanzen anschließen – für die hier zur Debatte stehenden Top-Manager ist dies – wie bereits gesagt - die soziale Prämisse des Karriere-Erfolgs - eine Melange aus Karriere und (persönlich zurechenbarer) Leistung, die durch öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung zum Erfolg wird und über eine repräsentative Apologie aufrecht erhalten werden kann und muss (vgl. Krais 2001). Das allein aber scheint nicht genug. Die Autobiographien geben darüber hinaus auch Auskunft über ein (wirtschafts-)bürgerliches Bekenntnis. Damit, so soll im Folgenden noch kurz gezeigt werden, werden die Autobiographien auch als Plattform für elitäre Statusdemonstration genutzt.
5. Elitäre Selbstvergewisserung über eine bürgerliche Herkunft
In allen Autobiographien werden die Herkunftsfamilien porträtiert und der oder die Leserin erfährt etwas über die soziokulturellen Erfahrungsräume und frühen Sozialisationsbedingungen in einem wirtschaftbürgerlichen Milieu und ein über die Eltern vermitteltes traditionelles Familienarrangements, das bisweilen an den bürgerlichen Geschlechterdiskurs des 19. Jahrhunderts erinnert. Alle Autoren beschreiben sich als gut-situiert oder gar vermögend. Sie veranschaulichen sich als Söhne aus Unternehmerfamilien und gar -dynastien und entsprechen in ihrer (fast stereotypen) Darstellung den Ergebnissen verschiedener sozialwissenschaftlicher Untersuchungen, die sich mit der Reproduktion der Wirtschaftselite und den nach wie vor geltenden Selektionsmechanismen und exklusiven Rekrutierungsstrategien beschäftigt haben (vgl. dazu Hartmann 2001, 2002, 2003). Nicht Leistung, sondern die soziale Herkunft verschaffe dem Nachwuchs der „besseren Kreise“ einen „uneinholbaren Vorsprung, wenn es um die Besetzung von Spitzenpositionen in der deutschen Wirtschaft geht“ (Hartmann 2003, S. 50). In den verschiedenen Autobiographien der Top-Manager wird zunächst einmal dieses Bild einer ‚besseren’ und auch ‚geschlossenen’ Gesellschaftsschicht bestätigt, die über die Möglichkeiten verfügt, über die soziokulturellen Reproduktionsbedingungen zu wachen und diese mit auszugestalten.
Zugleich – und damit öffnet die Analyse der vorliegenden autobiographischen Texte einen weiteren Horizont im Kontext der Elitendiskussion – zeichnen die Top-Manager in ihren Selbst-Darstellungen ihre je eigene Sicht auf den Zusammenhang zwischen Herkunft und späterem (Berufs-)Erfolg. In allen autobiographischen Selbst-Darstellungen informieren die Autoren nachdrücklich über den Wertehorizont ihrer Herkunftsfamilien und nutzen damit die Autobiographie als Bühne, sich in der Tradition einer wirtschaftsbürgerlichen Herkunft samt Ahnengalerie zu entwerfen und auch zu stilisieren. Damit wird die symbolische Repräsentation der traditionsreichen – oder zumindest als solche prätendierten – Herkunft auch zum Medium ständischer (modern ausgedrückt: elitärer) Selbstvergewisserung.
Diese Rückversicherung qua (wirtschafts-)bürgerlicher Herkunft soll im Folgenden empirisch unterfüttert werden. Noch einmal möchte ich dabei auf die (bereits vorgestellte) Autobiographie des Hans-Olaf Henkel (2002) eingehen, in dessen Lebenserinnerungen die Ausführungen über sein Herkunftsmilieu einen breiten Raum einnehmen. Als Gemeinsamkeit mit anderen Autobiographien aus dem Milieu der Top-Manager teilt der Autor das Bemühen, sich als Kenner der bürgerlichen Kultur auszuweisen. Dabei erfahren wir, dass der Vater für den Autor das großstädtische Bürgertum verkörpert die Mutter hingegen, die aus „einfachen Verhältnissen“ kommt, muss sich die Zugehörigkeit zur guten Gesellschaft erst erarbeiten. Während der Vater verehrt wird, wird die Mutter in ihrem Distinktionsbemühen vom Autor kritisch vorgeführt. Sie ist für ihn die klassische Figur des Emporkömmlings, da sie ‚naturwüchsig’ nicht dazugehört. Beide Elternteile sind allerdings, so der Autor, an einem späteren Erfolg beteiligt: Der frühe Tod des Vaters führt zur frühen Selbständigkeit, die Mutter hingegen provoziert Rebellion und eine autonome Persönlichkeit – Eigenschaften und ein Selbst-Bewusstsein, die sich in späteren Etappen seiner ‚Erfolgstour’ als hilfreich erweisen werden. Trotz der durchaus ambivalenten Ausgangsbedingungen legt der Autor über weite Strecken seiner Autobiographie großen Wert darauf, seine Herkunftsfamilie als Stätte bürgerlicher Wohlsituiertheit zu porträtieren. Er malt ein geradezu barockes Gemälde einer Familienidylle, in dem die gesamte Klaviatur bürgerlicher Gepflogenheiten, die distinktive Kultur mit ihrem Hochkulturschema vorgeführt und nachgeahmt wird. Hierzu möchte ich eine Passage zitieren:
„Im Jahr 1940, als Hitlers Luftwaffe die englische Industriestadt Coventry bombardierte und von allen Fronten Siegesmeldungen einliefen, filmte mein Vater ein weiteres Stück seines idealisierten Privatlebens. Klassische Musik gehörte zu den Liebhabereien, die meine Eltern teilten, und gelegentlich setzten sie sich mit Freunden zu gemeinsamer Kammermusik zusammen. „Hausmusik“, so lautet der Titel des Films, und als Erklärung fügte Vater an, dass „in der deutschen Familie seit Jahrhunderten Hausmusik gepflegt wurde. Deutsche Meister schufen Musik von unvergänglicher Schönheit und Tiefe, ihre Werke sind unsterblich.“
„Hausmusik“ beginnt mit einem Blick in unser Speisezimmer. Die Familie sitzt beim Kaffee, auf einer langstieligen Porzellanschale ist Obst arrangiert wie auf einem niederländischen Stilleben. Die Haustüre wird geöffnet, Freunde treffen ein und betreten das Musikzimmer, in dem geschnitzte Notenständer bereitstehen. Mutter, ein blonder Engel im Seidenkleid, legt behutsam Notenblätter auf, entzündet dann einen Kerzenleuchter. Licht fällt auf die Noten, und die Kamera zeigt, dass ein Klaviertrio von Joseph Haydn auf dem Programm steht. Mutter schlägt auf dem Flügel einen ton an, nach dem Geige und Cello gestimmt werden“. (Henkel 2002, S. 15.f.)
Der Einblick in das Elternhaus des Autobiographen, der über das Stilmittel ‚Filmaufnahme’ zunächst distanziert daherkommt aber nichtsdestotrotz gerade eben deshalb auch Authentizität verspricht, ist bemerkenswert: Zunächst einmal ist der kritische Unterton des Autobiographen nicht zu überhören. Während die Welt untergeht (es ist Krieg!), dokumentiert der Vater sein „idealisiertes Privatleben“. Es liegt die Interpretation nahe, dass uns der Autor hier die Weltfremdheit einer Hamburgischen Unternehmerfamilie vorführt, die trotz des Weltkriegs im sozialen Binnenraum verharrt. Bemerkenswert ist aber zugleich die Detailverliebtheit, mit der die Szenerie beschrieben wird. Es liegt die Vermutung nahe, dass er sich dabei vor allem als Eingeweihter dieser bürgerlichen Lebensart zu erkennen geben kann oder anders ausgedrückt: mit der er seine profunden bürgerlichen Grundkenntnisse zu rekonstruieren vermag. Die an dieser Stelle eher distanziert vorgetragenen Einlassungen über sein Elternhaus werden im Verlauf seiner Autobiographie durch Hinweise auf eigene demonstrative Gepflogenheiten ersetzt, die die Interpretation nahe legen, dass auch er dem Zugzwang einer distinkten Selbstdarstellung unterliegt (Segeljacht, Jachtclub, Bauhaus-Repliken, Vorliebe für Cohibas u.ä.).
Insgesamt ist diese Passage seiner Autobiographie auch dazu bestimmt, seine exzeptionelle Karriere über seine Herkunft zu rahmen. Er ist eben seiner Ansicht nach kein Parvenü, sondern Spross einer Bürgersfamilie mit Tradition, die ihm Ressourcen in die Wiege gelegt hat, die er zu deuten weiß, mit denen er umgehen kann.
Zur Ergänzung möchte ich noch eine weitere kleine Passage zitieren, eine kleine Episode, mit der der Autor dem Leser seine ‚gute Kinderstube’ und letztlich seine legitime Zugehörigkeit zur Guten Gesellschaft unter Beweis stellt. Bevor der Autor studiert, absolviert er eine Lehre bei einer Speditionsfirma. Diese Jahre werden gewissermaßen als die lehrreichen Entwicklungsjahre des späteren Top-Managers vorgestellt. Sie dienen dazu, seine (große) Zukunft vorzubereiten. Bemerkenswert ist die Art und Weise, wie der Autor die Welt der Speditionsfirma beschreibt, denn darin dokumentiert sich bereits, dass er ‚eigentlich’ zur anderen Seite gehört und gehören möchte. Arbeitskollegen kommen in seinen Schilderungen nicht vor, Vorgesetzte werden nicht genannt. Erinnert werden Situationen, in denen er den Reichen und Mächtigen begegnet. Beispielhaft für diese Erinnerungen ist dann eben folgende kleine Begebenheit, in der der Autobiograph als Lehrjunge in einem noblen Hotel für seine Botentätigkeiten ein Trinkgeld erhält und diesen Botenlohn als Demütigung erfährt:
„Das Geldstück brannte in meiner Hand. Mit rotem Kopf erinnerte ich mich an den Rat meiner Mutter, niemals Trinkgeld anzunehmen, es aber immer reichlich zu geben. Ich eilte, von Peinlichkeit getrieben, zu dem nahe gelegenen Spezialgeschäft ‚Pfeifen Tesch’, um die verhasste Münze schnellstmöglich wieder loszuwerden. Seit langem hatte ich mir eine Pfeife gewünscht, und so tröstete ich mich über den unangenehmen Vorfall, was allerdings die Folge zeitigte, dass ich für einige Jahre Pfeifenraucher wurde.“ (Henkel 2002, S. 52)
Das Geben und Nehmen von Trinkgeld symbolisiert das gesellschaftliche ‚Oben’ und ‚Unten’ und wird zur Statusdemonstration solcherart sozialer Verkehrsformen. Die Mutter, die mit Argusaugen über die bürgerliche Ehre der Familie wacht, gab ihm diese Lebensmaxime mit auf den Weg. Auf jeden Fall widerfährt dem Autor hier ein stratifikatorisches Unrecht, das ihn ganz offensichtlich brandmarkt und ihn in ein Luxusgeschäft eilen lässt, wo er das Trinkgeld in ‚demonstrativen Konsum’ verwandelt.
Der „unangenehme Vorfall“ transportiert eine ganz spezifische Selbst-Deutung des Autors: Er hat als Top-Manager klein angefangen, trotzdem gehört er bereits in jungen Jahren ‚dazu’. Dass die Koketterie, die hier zum Ausdruck kommt, eher den Dünkel eines Emporkömmlings entlarvt, denn den Großbürger porträtiert, ist vom Autor so nicht intendiert, vermag das Argument aber auch nicht zu widerlegen. Im Gegenteil: Es bekräftigt die These, dass der Autor hier dem Zugzwang bürgerlicher Statusproduktion und -reproduktion unterliegt.
Resümee
Aus den lebensgeschichtlichen Beschreibungen und Erzählungen kann selbstverständlich nicht in einem Blow-up-Verfahren auf das tatsächlich gelebte Leben des Biographen oder die Historie seiner Zeit rückgeschlossen werden (vgl. dazu Hodenius/Liebold 2007). Vielmehr handelt es sich um Sinnkonstruktionen mit Modellierungen eines Ich-Erzählers und seines lebensgeschichtlichen Materials. Durch eine Autobiographie erfahren wir nicht, wie der Mensch war oder ist – noch nicht einmal, wie er sich tatsächlich sieht. Stattdessen erfahren wir, wie er sich und seine Biographie in einem spezifischen Kontext von medialer Öffentlichkeit darstellt. Und dies macht Autobiographien zu einer bemerkenswerten Datenquelle, mittels derer ein spezifischer Einblick in die Topographie symbolischer Sinnwelten und Ordnungen gelingt, nämlich die Elite über die Darstellung von Elite selbst zu rekonstruieren.
Am empirischen Material aktueller Autobiographien kann gezeigt werden, mit welcher Formensprache, mit welchen Strukturelementen und mit welchen Selbstdarstellungsgebärden sich die Wirtschaftselite entwirft und öffentlich präsentiert. Dabei geben die Autobiographien einen ganz spezifischen Einblick in die Architektur von Elitehandeln, das eben in erster Linie in einem Konsens des Verfahrens besteht, nämlich sich selbst nach bestimmten Regeln der Kunst coram publico zu veröffentlichen und zu vermarkten, nämlich über heldenhafte und statusbetonte Erfolgsgeschichten, die sich als außergewöhnlich, individualistisch, unplanbar und unnachahmbar charakterisieren lassen. Zu diesem Verfahren der Darstellung gehört auch, sich über eine Leistungsideologie hinwegzusetzen, denn die bürgerliche Herkunft und die dazugehörige Lebensführung werden nachgerade als distinktes Erkennungsmerkmal der Zugehörigkeit genutzt. Autobiographien sind zwar der Ausdruck einer bürgerlichen Karriere par excellence (vgl. dazu Pohlmann 2007). Zugleich erschöpft sich Bürgerlichkeit keineswegs in der Distinktion durch Karriere, d.h. darin, Unterschiede zu anderen sozialen Kreisen durch sozialen Aufstieg zu markieren und aufrecht zu erhalten. Vielmehr zeigt sich am Beispiel autobiographischer Textproduktion, dass im nachdrücklichen Rekurs auf die eigene Herkunft Erfolg gerahmt werden kann und muss. Das Herkunftsmilieu wird nachgerade zum Medium elitärer Selbstvergewisserung, zum Mittel der Statusproduktion und -reproduktion.
„Jede Selbstdarstellung praktiziert die Strategie unterschiedlicher Gewichtung“ (Hansen 1992, 14). An dieser Gewichtung lässt sich dann nicht nur die Art der gewünschten Aufwertung ablesen; vielmehr wird in dem, was man zu verkörpern, welche Rolle man zu spielen und welche Vorzüge man zu besitzen wünscht, ein spezieller Legitimationsbedarf sichtbar, der sich aus der gewünschten Zugehörigkeit ergibt: Das Selbst-Darstellungsbedürfnis der Wirtschaftselite lässt sich im Kontext medialer Öffentlichkeit insofern auch als ein Versuch interpretieren, sich gewissermaßen hineinzuschreiben in den Kreis derjenigen, zu denen man gerne gehören möchte.
▲
Literatur:
- Alheit, Peter /Brandt, Morten 2006: Autobiographie und ästhetische Erfahrung. Entdeckung und Wandel des Selbst in der Moderne, Bd. 4, Frankfurt/New York: Campus Verlag
- Dreitzel, Hans Peter 1962: Elitebegriff und Sozialstruktur. Eine soziologische Begriffsanalyse. Stuttgart: Enke
- Frevert, Ute 1995: „Mann und Weib, und Weib und Mann“. Geschlechter-Differenzen in der Moderne. München: Beck’sche Reihe
- Giesen, Bernhard 1999: Die Aura des Helden. Eine symbolgeschichtliche Skizze, in: Honer, Anne / Kurt, Ronald / Reichertz, Jo (Hg.): Diesseitsreligion. Zur Deutung der Bedeutung moderner Kultur, Konstanz: UVK, S. 437-444
- Hahn, Alois 1982: Zur Soziologie der Beichte und andere Formen institutionalisierter Bekenntnisse. Selbstthematisierung und Zivilisationsprozeß, in: KZfSS 34, S. 408-434
- Hahn, Alois und Volker Knapp 1987 (Hg.): Selbstthematisierung und Selbstzeugnis. Bekenntnis und Gedächtnis, Frankfurt a.M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft
- Hahn, Alois 1988: „Biographie und Lebenslauf“, in: Hanns-Georg Brose und Bruno Hildenbrand (Hg.): Vom Ende des Individuums zur Individualität ohne Ende, Opladen: Leske + Budrich, S. 91-105
- Hahn, Carl H. 2005: Meine Jahre mit Volkswagen. München: Signum Verlag
- Hansen, Klaus P. 1992: Die Mentalität des Erwerbs. Erfolgsphilosophien amerikanischer Unternehmer, Frankfurt/New York: Campus
- Hartmann, Michael 2001: Klassenspezifischer Habitus oder exklusive Bildungstitel als soziales Selektionskriterium? Die Besetzung von Spitzenpositionen in der Wirtschaft, in: Krais, Beate 2001 (Hg.), S. 157-210
- Hartmann, Michael 2002: Der Mythos von den Leistungseliten. Spitzenkarrieren und soziale Herkunft in Wirtschaft, Politik, Justiz und Wissenschaft. Frankfurt/New York: Campus
- Hartmann, Michael 2003: Soziale Homogenität und generationelle Muster der deutschen Wirtschaftselite seit 194, in: Berghahn, Volker R. /Unger, Stefan /Ziegler, Dieter (Hg.): Die deutsche Wirtschaftselite im 20. Jahrhundert. Kontinuität und Mentalität. Bochumer Schriften zur Unternehmens- und Industriegeschichte, Bd.11, Essen: Klartext Verlag, S. 31 - 50
- Hodenius, Birgit / Liebold, Renate 2007: Zum Verständnis (auto-)biographischer Erzählungen - ein methodisch-methodologischer Literaturbereicht (unveröffentlichtes Manuskript, Erlangen)
- Holdenried, Michaela 2000: Autobiographie. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co
- Misch, Georg 1989 (1907): Begriff und Ursprung der Autobiographie, in Günter Niggl (Hg.), S. 33 -55
- Henkel, Hans-Olaf 2002: Die Macht der Freiheit. Erinnerungen. München: Econ
- Krais, Beate 2001 (Hg.): Von Eliten und herrschenden Klassen. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft
- Krais, Beate 2001: Die Spitzten der Gesellschaft. Theoretische Überlegungen, in: ders. (Hg.):, S. 7 - 63
- Münkler, Herfried 2006: Vom gesellschaftlichen Nutzen und Schaden der Eliten, in: Münkler, H. / Straßenberger, G. / Bohlender, M. (Hg.): Deutschlands Eliten im Wandel, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 25 - 45
- Niggl, Günter 1977: Geschichte der deutschen Autobiographie im 18. Jahrhundert. Theoretische Grundlegung und literarische Entfaltung. Stuttgart
- Niggel, Günter (Hg.) 1998: Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung, 2. Auflage, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
- Picard, Hans Rudolf 1978: Autobiographie im zeitgenössischen Frankreich. Existentielle Reflexion und literarische Gestaltung. München
- Piëch, Ferdinand 2002: Auto. Biographie. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag
- Pohlmann, Markus/Bär, Stefan/Schanne, Sita 2007: Der diskrete Charme der Bourgeoisie (unveröffentlichtes Manuskript, Heidelberg)
- Sloterdijk, Peter 1978: Literatur und Organisation von Lebenserfahrung. Autobiographien der Zwanziger Jahre. München: Carl Hanser Verlag
1 Damit stelle ich erste Ergebnisse zur Diskussion, die in einem von der DFG geförderten Projekt über den ‚Generationenwandel der ökonomischen Elite’ erarbeitet werden. Neben der Autorin sind Stefan Bär, Birigt Hodenius und Sita Schanne als wissenschaftliche MitarbeiterInnen beteiligt. Antragsteller und Leitung obliegen Markus Pohlmann und Gert Schmidt (www.oekonomische-eliten.de).
▲
7.12. Eliten als Orientierungsgeber oder als ‚Sozialschmarotzer’? Zur soziokulturellen Bedeutung von Elitehandeln in gesellschaftlichen Transformationsprozessen
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Renate Liebold: Selbstbild und Selbstinszenierung der ökonomischen Elite in autobiographischen Selbstdarstellungen -.
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/7-12/7-12_liebold.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-01-26
 Beispielhaft soll ein Blick auf die autobiographische Textproduktion des Wirtschaftsmanagers Hans-Olaf Henkel geworfen werden, der als einer der populärsten Top-Manager Deutschlands gilt. Bis 1993 war er Europachef bei IBM, von 1995 bis 2000 fungierte er als Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, seit 2000 lehrt der Ehrendoktor der TU Dresden als Honorarprofessor an der Universität Mannheim. Im Jahr 2002 veröffentlicht Henkel seine Autobiographie mit dem Titel „Die Macht der Freiheit“ seine Lebenserinnerungen.
Beispielhaft soll ein Blick auf die autobiographische Textproduktion des Wirtschaftsmanagers Hans-Olaf Henkel geworfen werden, der als einer der populärsten Top-Manager Deutschlands gilt. Bis 1993 war er Europachef bei IBM, von 1995 bis 2000 fungierte er als Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, seit 2000 lehrt der Ehrendoktor der TU Dresden als Honorarprofessor an der Universität Mannheim. Im Jahr 2002 veröffentlicht Henkel seine Autobiographie mit dem Titel „Die Macht der Freiheit“ seine Lebenserinnerungen.