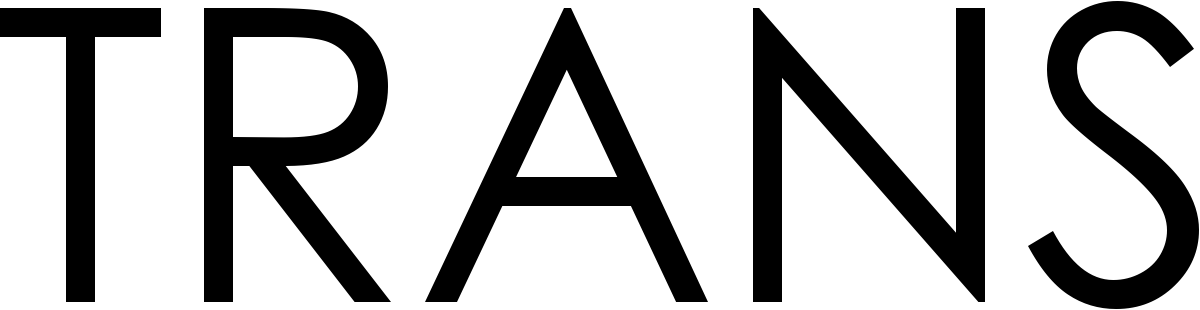Judit H. Ekler
(Westungarische Universität, Szombathely) [Bio]
Email: hekler@mnsk.nyme.hu
Abstract
Heutzutage arbeiten die Universitäten der meisten EU-Länder gemäß des Bologna- Systems.
Theoretisch dient das Bologna System als Mittel des Durchgangs zwischen den verschiedenen Studienprogrammen. Österreich und Ungarn gelten in dieser Hinsicht als Wissensregion. Allerdings sind aber die Studienprogramme sehr unterschiedlich und deswegen ist der Durchgang kaum möglich. In meinem Artikel möchte ich die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede des Lehramtsstudiums (Unterrichtsfach Sport) an beiden Seiten der Grenze (Ungarn-Österreich) vorstellen und analysieren.
Einleitung
Der Begriff Bologna-Prozess bezeichnet ein politisches Vorhaben – aufgrund der Gemeinsamen Erklärung zur Harmonisierung der Architektur der europäischen Hochschulausbildung vom 25. Mai 1998 (1) – zur Schaffung eines einheitlichen Europäischen Hochschulraums bis zum Jahr 2010. Er beruht auf einer 1999 von 29 europäischen Bildungsministern im italienischen Bologna unterzeichnete Erklärung (2).
Der Bologna-Prozess verfolgt drei Hauptziele: Die Förderung von Mobilität, internationaler Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit. Als Unterziele umfasst dies unter anderem:
-
die Schaffung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Bachelorschlüsse, auch durch die Einführung des Diplomzusatzes,
-
die Schaffung eines zweistufigen Systems von Studien (in Ungarn und Österreich als Bachelor und Master umgesetzt),
-
die Einführung eines Leistungspunktesystems, des European Credit Transfer System (ECTS) (3),
-
die Förderung der Mobilität durch Beseitigung von Mobilitätshemmnissen; gemeint ist nicht nur räumliche Mobilität, sondern auch kulturelle Kompetenzen und Mobilität zwischen Hochschulen und Ausbildungsgängen,
-
Förderung der europäischen Zusammenarbeit bei der Qualitätsentwicklung,
-
die Förderung der europäischen Dimension in der Hochschulausbildung,
-
das lebenslange bzw. lebensbegleitende Lernen,
-
die studentische Beteiligung (Mitwirken an allen Entscheidungen und Initiativen auf allen Ebenen).
Die Absichten der Bologna-Erklärung sind nicht nur ehrenswert, sondern sie schaffen auch die Rahmen der durchsichtbaren und durchgehbaren europäischen Wissensregion. Aber mindestens theoretisch ist es so. Nach den anziehenden Zielen zeigen sich nämlich immer mehr Probleme europaweit (4,5) Das eine, vielleicht allgemeinste von ihnen ist das Problem des Durchganges. Der Aufbau, die Gegenstandstruktur der nach der Schulausbildung gleichen Bildungen sind – den nationalen Charakterzügen gemäß – sehr unterschiedlich. Es könnte das Sammeln von vielseitigen Erfahrungen ermöglichen, es erschwert aber die Anerkennung der Gegenstände und die Anschaffung des Diploms im Mutterinstitut.
In Ungarn war der größte Fehlgriff des Systems die Einführung der zweizyklischen Pädagogenausbildung. Die Zurückstellung der Pädagogenausbildung ins einzyklische System ist bereits eine feste Tatsache, umso mehr, weil die Pädagogenausbildung – in den meisten europäischen Ländern – immer so funktionierte.
Ungarn und Österreich werden nicht nur vom Bologna-System und den gemeinsamen Grenzen verbunden, sondern von den historischen Traditionen des Unterrichts eng. So ist es sinnvoll – noch vor den Änderungen – das Bildungssystem der beiden Länder zu vergleichen und die Erfahrungen zu tauschen.
Das Ziel unserer Studie ist diese Gegeneinanderstellung auf dem Gebiet der Sportfachmannbildung, vor allem aber auf dem Gebiet der Sportlehrerausbildung.
Bildungsstätten in der Ausbildung der Sportfachleute (6,7)
Der institutionelle Hintergrund der Sportfachmannausbildung ist in Österreich und Ungarn im Grunde genommen gleich. Die Universitäten und Hochschulen haben in beiden Ländern das Recht auf die Ausbildung von Sportfachleuten sowohl mit Bachelor als auch mit Master Ausbildung. In Österreich gibt es an den vier großen Wissenschaftsuniversitäten (Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck), in Ungarn an fünf Universitäten (Eötvös Loránd Universität, Semmelweis Universität, Westungarische Universität, Wissenschaftsuniversität Pécs und Szeged) sportwissenschaftliche Ausbildungen.
In Ungarn haben die Hochschulen von Eger und Nyíregyháza eine gleiche Bildungsstruktur wie unsere Universitäten, an den österreichischen Fachhochschulen gibt es aber nur teilweise sportwissenschaftliche, größtenteils mit Sport, Sporttourismus und Sportbeziehungen der Gesundheit zusammenhängende wirtschaftswissenschaftliche Ausbildungen.
Das System und der Inhalt der Ausbildung des Sportfachmannes (8,9,10,11)
Alle drei Elemente des dreistufigen Ausbildungssystems (Bachelor 6 Semester, Master 4 Semester und PhD) sind in beiden Ländern zu finden. In Ungarn ist auch jedes Ausbildungsgebiet der Sport- und Bewegungswissenschaften so wie Gesundheitsport, Leistungssport, Sportmanagement und Lehramtsstudium in diesem System gegeben. Grundsätzlich unterscheidet sich davon die österreichische Praxis, wo das Lehramtssystem (Bewegung und Sport) in ungeteilter Ausbildung von 9 oder 10 Semestern stattfindet.
In Österreich sind die Ausbildungen für Gesundheitsport, Leistungssport und Sportmanagement, als vom Bachelor-Fach ausgehende Abzweigungen einer gemeinsamen Grundlage (Sport – und Bewegungswissenschaften) vorhanden. In Ungarn aber – bereits von Anfang der Bachelor-Ausbildung an – werden diese Ausbildungsgebiete als selbständige Fächer abgegrenzt, trotz der Tatsache, dass in jedem sportwissenschaftlichen Fach die gemeinsamen, grundlegenden sportwissenschaftlichen Wissenskreise zu finden sind. In diesem – national unterschiedlichen – System läuft auch die Master- Ausbildung.
Die Trainer-Ausbildung ist in beiden Ländern dreistufig (Instruktor, Trainer, Diplomtrainer). Die ersten beiden Ausbildungsstufen werden in Ungarn vom Hochschulsystem abgegrenzt von Ausbildungsstätten gewährleistet, die eine Berechtigung dazu erhalten haben. Die Ausbildung der Diplomtrainer ist ein Teil des oben vorgestellten dreistufigen Systems. In Österreich ist das ganze Vertikum der Diplomtrainer-Ausbildung vom ganzen Hochschulwesen getrennt. Die Ausbildungsorganisation ist die Bundessportakademie.
Das System und der Inhalt der Sportlehrerausbildung
Auf dem sportwissenschaftlichen Gebiet unterscheidet sich das System der Sportlehrerausbildung am deutlichsten in beiden Ländern. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass theoretisch Lehrer mit zwei Fächern an beiden Seiten der Grenze ausgebildet werden, mit insgesamt 300 gesammelten Kreditpunkten. In Österreich erfolgt die Ausbildung der Lehrer bereits vom Anfang an in zwei ungeteilten gleichrangigen Fächern mit 9-10 Semestern, in Ungarn findet es in einem zweistufigen System mit 6+5 Semestern statt, dessen Bachelor-Stufe den Beginn der Studien eines Faches bedeutet. Das zweite Fach müsste man in den verschiedenen Stufen der Ausbildung ans „Hauptfach“, d.h. an die Studien des in der Grundstufe angefangenen Faches „anschließen“. In der Praxis ist es schon klar geworden, dass dieses System nur Lehrer mit anderthalb Fächern ausbilden kann und das Funktionieren hat Probleme, sondern auch die im Hauptfach erworbenen Kenntnisse geringer sind, als im früheren Lehrerausbildungssystem.
Auch der Eintritt in die Ausbildung änderte sich in Ungarn mit der Einführung des Bologna-Systems. Die Aufnahmeprüfung an den Ausbildungsanstalten – die über die physikalischen Fähigkeiten hinaus auch die während der bisherigen Studien erlernten Sportartkenntnisse gemessen hat -, wurde von der Aufnahmepunktzahl aufgelöst, die aus den Maturaergebnissen ausgerechnet wird. Die institutionelle Aufnahme, die jedem die gleiche Beurteilung ermöglicht, wird auch zur Zeit in Österreich verwendet und auch in Ungarn ist die erneute Einführung aufgetaucht. Unseren Erfahrungen nach verstärkt die Fachaufnahmeprüfung den Kontakt zur Ausbildungsanstalt und sie ermöglicht eine einheitlichere, fachlich besser begründete Auswahl.
Der Inhalt der Ausbildung stimmt im Bezug auf die Grundfächer des Lehrergewerbes, bzw. die Gründung der Sport und Bewegungswissenschaften in Ungarn und in Österreich überein. In beiden Ländern befinden sich z.B. Sportmedizin, Trainingswissenschaften, Bewegungs- und Sportpädagogik, usw. in der Liste der Themenkreise. Das breite Gegenstandsangebot ist aber unterschiedlich. In Ungarn folgt auch das Ausbildungsmaterial der Sportlehrer den jahrhundertealten Sportarttraditionen: wir beschäftigen uns grundsätzlich mit den traditionellen Sportarten (anders genannt Grundsportarten wie Athletik, Gymnastik, usw.), weniger mit den Freizeit- und Rekreationssportarten im Themenkreis Theorie und Praxis von Bewegung und Sport. In den österreichischen Ausbildungsstätten wird ein anderes System befolgt. Bereits die Benennung und der Aufbau der Gegenstände weicht von den ungarischen ab. Das Material der einzelnen Fächer wird aus den Zielen und Aufgaben der schulischen Sportwissenschaft ausgehend aufgebaut: wie z.B. spielerische Bewegungshandlungen, gesundheitsorientierte und ausgleichende Bewegungshandlungen, gestaltende und darstellende Bewegungshandlungen, könnens- und leistungsorientierte Bewegungshandlungen, erlebnisorientierte Bewegungshandlungen. Der besonders betonte Teil der österreichischen Ausbildung ist auch die Gesundheitsförderung (Gesundheitsförderung und Prävention, Herz-Kreislauf auf Stoffwechsel, Haltung und Bewegung, usw.) neben der erlebnisreichen Sportaktivität.
Die für die Hochschulausbildung charakteristische Kursgliederung (obligatorische und wählbare Kurse) ist in der Ausbildung beider Länder typisch. Der Unterschied in der Proportion beider Kursarten ist aber in der Gesamtheit der Ausbildung bedeutend. Solange die Pflichtkurse in Ungarn die überwiegende Mehrheit des Ausbildungsmaterials ausmachen, gewährt die österreichische Sportlehrerausbildung viel größere Wahlfreiheit. Es strebt sich nicht nach dem Unterricht jeder Form der immer mehr verzweigenden Bewegung- und Sportformen, sondern ermöglicht die Wahl innerhalb des in Modul-System eingeordneten Lehrmaterials. Es wird akzeptiert, dass es unmöglich ist, ganz einfach wegen der hohen Zahl, besonders auf dem Gebiet des – fast täglich sich erneuernden – Freizeitsports das ganze Vertikum der Sportarten und der Bewegungsarten kennen zu lernen. Man rechnet auch damit, dass das Interesse und motorische Fähigkeit der Studenten unterschiedlich ist. Die Verwendung des Prinzips „weniger ist manchmal mehr“ ist auch deshalb begründet, weil sich so die Gelegenheit in den einzelnen Sportarten, Bewegungsgebieten ergibt, tiefere, verwendbarere Wissen und Praxis zu erwerben. Dieses modulartige Angebot ermöglicht das flexible Verfolgen der aktuellen Tendenzen (z.B. Trendsportarten), ohne dass man die Grundlage des Lehrmaterials zerreisen würde.
Der weitere anziehende Charakterzug der österreichischen Sportlehrerausbildung, der nicht typisch oder mindestens nicht markant genug in der ungarischen Ausbildung ist, ist das Basieren auf die nationalen Sporttraditionen und Sportgewohnheiten. Die zukünftigen Sportlehrer werden auf das Kennenlernen und Ausübung der Freizeit-Sportpraxis vorbereitet, die sich aus der geographischen Lage des Landes ergibt und die wirklich wirksam ist (Wintersport; Wandern – Bergsteigen – Klettern). Nach dem Charakter der ausgewählten Sportbewegungen richtet sich auch die didaktische und methodische Vorbereitung. Es wird auf die Leitung von Beschäftigungen im Rahmen einer Schulstunde ( 45 Min. lang) gleichmäßig vorbereitet, wie auf die Leitung von längeren Sportereignissen mit Sportprojekten, Tanz-, Bewegungs-, Selbstausdrucksformen und Abenteuersportarten.
Selbstverständlich ist es auch in der ungarischen Ausbildung empfohlen, je ein Semester in einem anderen Land, an einer anderen Universität zu absolvieren. Die Mobilität unserer Studenten wächst zum Glück immer mehr. Zugleich können wir das gewünschte Niveau, das die österreichischen Ausbildungsstätten schon erreicht haben, noch nicht aufweisen. Typisch ist für die österreichische sportwissenschaftliche Ausbildung (natürlich ist auch die Sportlehrerausbildung inbegriffen), dass die „Lehrzeit im Ausland“ fast obligatorisch ist.
Zusammenfassung, Empfehlungen
Der Überblick der sportwissenschaftlichen Ausbildungen an beiden Seiten der österreichisch –ungarischen Grenze erklärte Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Vorteile und Schwierigkeiten der einzelnen Ausbildungen kennen lernend, lohnt es sich, einige Standpunkte zu überlegen. Besonders deshalb, denn die Struktur des ungarischen Systems für Lehrerausbildung zu dieser Zeit um- oder eben zurückgestellt wird und es kann gleichzeitig eine inhaltliche Erneuerung ermöglichen. Welches Fach der sportwissenschaftlichen Ausbildung wir auch betrachten mögen, ist eine stabile, weite Begründung in Theorie und Praxis der Sport- und Bewegungswissenschaften unerlässlich. In Ungarn funktionieren die einzelnen Gebiete als selbständige Bachelor-Fächer. Wegen des Durchganges zwischen den Fächern und des rationelleren Unterrichts sollte man den Ausgang aus einem gemeinsamen Grundfach überlegen.
Die Lehrmaterialstruktur der Sportlehrerausbildung sollte auf jeden Fall erneuert werden. Die preussischen Traditionen der ungarischen Körperkultur könnten zwar eine systematische stabile, sich auf die Grundsportarten stützende Ausbildung geben, aber sie schaffen die Wissens- und Motivationsbasis der lebenslänglichen sportlichen Lebensweise nicht. Die schulische Körpererziehung und der Schulsport könnten nur mit modernen Inhalten und im modernen Organisations- und methodischen Rahmen anziehend sein. Darauf müssen die zukünftigen Sportlehrer vorbereitet werden. So muss ihre Ausbildung durch die Wahlmöglichkeit, durch die zielgerechte Gruppierung des Lehrmaterials, sowie über die stabilen Gründen hinaus durch die Erlebnisartigkeit charakterisiert werden.
Der vielleicht attraktivste Faktor des Bologna-Systems ist, dass die europäischen Universitäten eine Wissensregion bilden. Es eröffnet sich die Möglichkeit, die verschiedenen Kulturen, Systeme, Traditionen innerhalb je einer Wissenschaft oder eines Fachgebietes kennen zu lernen. Dazu muss man die Ausbildungen in größerem Maße als bisher in Einklang bringen, aber nicht mit dem „Erstarren“ der Inhalte, sondern eben mit der Vielfalt der Auswahlmöglichkeiten der Pflicht- und wählbaren Modulen soll es geschaffen werden.
Literatur
Sorbonne Joint Declaration http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Sorbonne_declaration.pdf (Letzter Zugriff am 2011-01-03)
Bolognai Nyilatkozat (Die Bologna-Erklärung) http://www.edupress.hu/dokumentumok (Letzter Zugriff am 2011-01-03 )
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm (Letzter Zugriff am 2011-01-03)
Konrad Paul Liessmann (2009): Kritik am Bologna-System: „Schimmelpilz überzieht Unis“ URL: www.http://derstandard.at/1250691357961/Alpbach-Kritik-am-Bologna-System-Schimmelpilz-ueberzieht-Unishttp://derstandard.at/1250691357961/Alpbach-Kritik-am-Bologna-System-Schimmelpilz-ueberzieht-Unis )Letzter Zugriff am 2011-01-03)
Marion von Osten (2010): Das Paradoxon von Bologna URL: http://www.eurozine.com/articles/2010-07-01-vonosten-de.html (Letzter Zugriff am 2011-01-03)
URL:http://www.felvi.hu/ (Letzter Zugriff am 2011-01-03)
URL:http://www.wegweiser.ac.at (etzter Zugriff am 2011-01-03)
URL:http://www.uni-graz.at/zvwww/miblatt.html (Letzter Zugriff am 2011-01-03)
URL:http://www.uibk.ac.at/service/c101/mitteilungsblatt (Letzter Zugriff am 2011-01-03)
URL:http://public.univie.ac.at/index.php?id=37 (Letzter Zugriff am 2011-01-03)
URL:http://www.uni-salzburg.at (Letzter Zugriff am 2011-01-03)