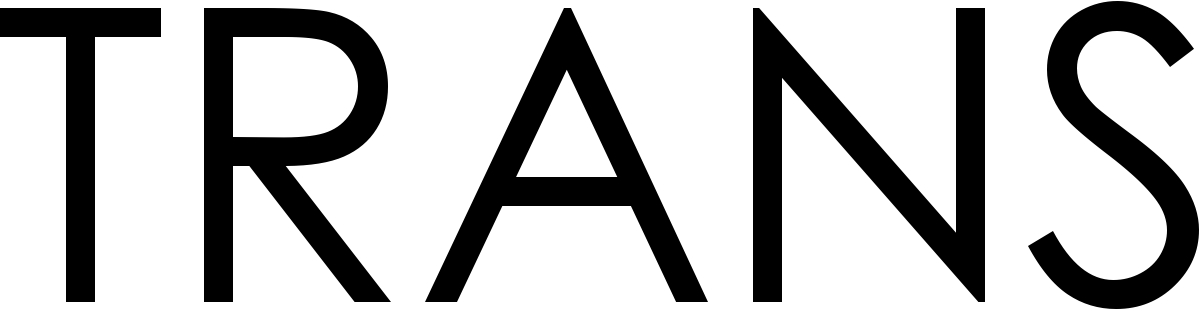Daniela-Elena VLADU [ Bio ] (Cluj Napoca | Klausenburg | Koloschwar)
Georg Dimas Leben und musikalisches Schaffen
Gheorghe (George, Georg) Dima war ein rumänischer Komponist, Dirigent, Sänger, Pianist und Lehrer, der durch sein besonderes musikalisches Schaffen einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der musikalischen Kultur zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Siebenbürgen ausübte, das bis 1918 Teil des Habsburgischen Reiches war.
Dima wurde am 10. Oktober 1847 in eine rumänische Händlerfamilie aus Braşov (Kronstadt) geboren. Von den fünf Söhnen des Ehepaars Nicolae und Zoe Dima überlebten nur vier, davon war Georg der jüngste. Im Kronstädter Elternhaus begann bereits die musikalische Ausbildung des Komponisten, als er Klavier- und Geigenunterricht beim Musiklehrer Binder nahm.
Ab dem vierzehnten Lebensjahr besuchte er die Sekundarschule in Wien mit der Absicht, eine Karriere als Ingenieur zu beginnen. Er schrieb sich in Karlsruhe zum Studium am Polytechnikum ein. Doch diese Richtung gab er sehr schnell auf, weil die Musik eine größere Anziehungskraft auf ihn ausübte als die Mathematik. Parallel zum Polytechnikum, in den Jahren 1866-1869, bekam er allerdings Gesangsunterricht vom Hofkirchenmusikdirektor Heinrich Giehne. Er setzte seine musikalische Ausbildung in Wien bei dem berühmten Musiker Otto Uffmann und in Graz bei Ferdinand Thieriot bis 1871 fort, wo er noch Harmonie und Kontrapunkt studierte.
Am 29. Februar 1869 erfolgte sein erster Auftritt in Karlsruhe als Sänger, wo er Lieder von Franz Schubert und Franz Abt interpretierte. Sein zweiter öffentlicher Auftritt fand am 7. August 1871 in Kronstadt statt, wo er im Rahmen eines Konzertes das Lied Der Wanderer von Franz Schubert sowie ein Duett für Tenor und Bass aus der Oper Belisario von Gaetano Donizetti interpretierte.
Weitere Studien (Klavier, Komposition, Harmonie, Kontrapunkt, Orgel, Gesang) unternahm Dima in den Jahren 1872 und 1873 am Leipziger Konservatorium und erschien oft in verschiedenen Solo-Programmen unter dem Namen Georg Dima aus Kronstadt, Siebenbürgen. Ein Jahr später erlebte Georg Dima eine kurze Karriere als Opernsänger in Klagenfurt und Zürich, wo er Marcel aus Die Hugenotten und Bertram aus Robert der Teufel von Giacomo Meyerbeer interpretierte.
Im Jahre 1874 kehrte er nach Kronstadt zurück und wurde zum Dirigenten des rumänischen Musikvereins in Kronstadt ernannt. Hier und in Sibiu (Hermannstadt) leitete er ab 1874 mehrere Kirchenchöre. Seine Tätigkeit als Dirigent und Komponist war sehr fruchtbar, seine ersten Kompositionen für Chöre sehr erfolgreich.
Trotzdem entschied er sich, ab 1879 sein Studium in Leipzig wieder aufzunehmen, um seine musikalische Ausbildung zu vertiefen. 1880 erlangte er einen doppelten Abschluss als Sänger und Komponist. Im selben Jahr wurde er mit dem 1. Preis der Mozart-Stiftung in Salzburg ausgezeichnet.
1899 kehrte die Familie Dima endgültig nach Kronstadt zurück, damit die Kinder eine rumänische Schule besuchen konnten. Für die nächsten achtzehn Jahre war Dima als Dirigent des rumänischen Musikvereins und des Kirchenchors in Kronstadt tätig sowie als Musiklehrer.
Kaum zu Hause angekommen, erhielt er auch das großzügige Angebot, als Dirigent des rumänischen Musikvereins in Hermannstadt tätig zu sein. Dieses Angebot nahm er an. 1881 wurde er zudem zum Seminarmusiklehrer und Kirchenmusikdirektor ernannt. Zahlreiche Kompositionen erschienen während seines achtzehnjährigen Aufenthalts in Hermannstadt: Lieder, Balladen, Chorlieder und Kantaten. Daneben wirkte er auch in Cluj (Klausenburg) als Lehrer für Chorensemble und Seminarmusiker.
1916 floh Dima aus Kronstadt nach Bukarest und war 15 Monate lang politischer Gefangener in Kronstadt, Târgu-Mureș (Neumarkt) und Klausenburg wegen seiner Kollaboration mit der Rumänischen Armee.
Im Jahre 1919 erhielt Dima das Angebot, das neu gegründete Musikkonservatorium in Klausenburg und den Chor zu leiten. Diesen Aufgaben ging er in den kommenden sechs Jahren mit Freude, Eifer und Hingabe nach.
1925 wurde bei ihm Magenkrebs diagnostiziert. Wenige Monate später starb er im Alter von 78 Jahren.
Im Jahre 2016 feiern wir das 97-jährige Bestehen der staatlichen Musikhochschule Klausenburg, die den Namen des Komponisten trägt. Die Musikakademie Gheorghe Dima wurde 1919 gegründet und nannte sich von 1931 an Musik- und Theaterakademie. 1950 wurde die Musikhochschule erneut in Konservatorium umbenannt und seit 1990 heißt sie Musikakademie Gheorghe Dima.
Dimas Vokalmusik enthält Werke für Soli, Chor und Orchester. Manchmal sind neben den rumänischen auch deutsche Varianten vorhanden (z.B. Hora / Der Reigen).
Georg Dima ist einer der Begründer des rumänischen Liedes, dem er mehr durch melodische als harmonische Mittel eine nationale Färbung verleiht. Das Klavier ist gleichberechtigt neben der Singstimme am musikalischen Ausdruck beteiligt. Der Einfluss von Robert Schumann ist zuweilen offensichtlich. Seine Lieder für Singstimme und Klavier wurden zu seinen Lebzeiten oder postum publiziert: 16 Lieder und Gesänge (deutsch und rumänisch), Leipzig 1889; 16 Lieder und Balladen, Wien 1906; 12 rumänische Volkslieder, Wien 1906; Drei Gedichte von Carmen Sylva, Bukarest 1951, 38 Lieder (deutsch und rumänisch) Klausenburg 1930; Din lumea copiilor [Aus der Welt der Kinder], Klausenburg 1931; Curcile [Die Puten], Bukarset 1967.
Dimas Chöre zeichnen sich durch ihren harmonischen Reichtum aus und meisterhafte polyphone Schreibweise aus.
Wie viele andere rumänische Komponisten jener Epoche, hat Dima volkstümliche und byzantinische Melodien bearbeitet, ohne deren modale Grundsprache zu imitieren. Ein charakteristischer Zug seines Schaffens bleibt die tonale Annäherung an die multikulturelle (rumänische, ungarische und deutsche) Folklore Siebenbürgens (Finscher 2001: 1047).
Beziehung der Musik zur Sprache[1]
Sowohl Musik als auch gesprochene Sprache sind akustische Phänomene in der Zeit. Musik entwickelt sich in der Zeit, strukturiert sich rhythmisch-metrisch und füllt sich mit tönenden Ereignissen. Musik in ihrer Makrostruktur gibt dem linearen kontinuierlichen Zeitablauf eine äußere Form und Hülle. Sprache entsteht mit Hilfe unseres Sprechapparats, mit dem wir rhythmisch-metrisch strukturierte akustische Muster produzieren, die uns zeichenhaft zur Kommunikation dienen. Der direkte Bezug der Sprache zur außersprachlichen Wirklichkeit ist evident, ein Bezug zur Welt muss im Falle der Musik sekundär bleiben und kann nur auf kognitive Weise hergestellt werden (vgl. Schmidt 2000: 131). Musik stellt keine Abbilder der Wirklichkeit dar, sondern sie suggeriert und symbolisiert metaphysisch und spricht Lebensansichten und Wirklichkeitstranszendenz aus.
Es gibt zwei fundamental verschiedene Auffassungen von der Musik, in denen gleichzeitig das Verhältnis von Musik zur Sprache bzw. dichterischer Sprache verschieden ausgeprägt ist. Musik wird in ihrer doppelten Natur als Rede gegründet, sie wird als das betrachtet, was sie ist, aber Musik wird auch in ihrer Wirkung betrachtet. Als Symbol dafür steht Orpheus, der mit seinem Gesang und Saitenspiel sogar das Totenreich und die unbelebte Materie in seinem Bann schlägt (Riethmann 1979: 194).
Sprache und Musik vermitteln sowohl Informationen als auch Empfindungen, allerdings mit unterschiedlicher Betonung. Sprache ist stärker als Träger von Informationen zu verstehen, Musik stärker von Empfindung. Je musikalischer Sprache ist, um so mehr vermag sie auch ohne die Unterstützung von Musik zur Seele vorzudringen, sie weckt Aufmerksamkeit und konzentriert die semantische Aussage auf wenige Worte. Die Bedeutung des Wortlautes in der lyrischen Sprache befindet sich in der Konnotation und nicht in der Denotation. Die lyrische Sprache wird als Variante der Umgangssprache verstanden, sie ist Norm und wirkt modellhaft. Musik bezieht sich auf begriffslose, ungegenständliche Symbole und Allegorien, die außermusikalisch Benennbares in Töne fassen (Dahlhaus 1979: 12ff).
Sprache und Musik zusammen bewirken offenbar viel mehr als jedes für sich. (vgl. Pahn 2000: 123). Der in der Musikwissenschaft Wort-Tonverhältnis genannte Sachverhalt zeigt, in welcher Weise poetisch-linguistische Strukturen und Inhalte im Gesang ihr Korrelat finden.
Sprache benennt und sagt aus, Musik indiziert und zeigt. Daher weist Sprache nur in besonderen Fällen, Musik aber immer ästhetischen Charakter auf (vgl. Vieregge 2000: 163ff). Sowohl das metrische Gerüst als auch der begrifflich-thematische Zusammenhalt zählen weniger als die rhythmisch-musikalisch motivierte Assoziation der evozierten Bilder, die logische Lücken und plötzliche Übergänge nicht ausschließt.
Mehrere Wörter kohärent und kohäsiv aneinandergefügt ergeben Texte, Musik besteht aus Tönen und Klängen, die für verschiedene Bedeutungen stehen können. „Diese Klänge erscheinen als Zusammenschluss von Möglichkeiten, als Kontext und bilden den Versuch, musikalisch eindeutig zu sein und sich auf die Vieldeutigkeit der Sache, der Musik einzulassen“ (Riethmüller 1979: 194f).
Interpretieren von Kunst durch Kunst
Dichten ist dem Komponieren verwandt, sofern die Klangkombination und Harmonik wichtiger ist als die Bedeutung, die in manchen Fällen sogar unbestimmt bleibt.
Die Berührungspunkte von Musik und Sprache bzw. Literatur ergeben sich in einer Wechselbeziehung, deren Orientierung sich in ständiger Bewegung befindet. Oft werden Termini der Sprachwissenschaft und Poesie auf den Musikbereich übertragen oder musikalische Begriffe finden Eingang in literaturwissenschaftliche und ästhetische Konstrukte.
Das vertonte Gedicht ist das Lied im Sinne des Kunstliedes Schubertscher Prägung, wo das Lied primär nicht durch eine intendierte Funktion, sondern durch den Anspruch bestimmt ist, Kunst zu sein. Der Begriff Lied kommt aus dem Althochdeutschen liod (= Gesungens) und bezeichnet ein Musikstück, das aus mehreren gleich strukturierten und gereimten Strophen oder einer auskomponierten variierenden Melodie für jede Strophe besteht. Das Lied stellt die ursprünglichste und schlichteste Form der Lyrik dar. Im Lied findet das menschliche Gefühl in seinen Stimmungen eine reine und intensive Ausdrucksmöglichkeit. Ein Lied kann von einem einzelnen Sänger, dem Solisten, einem Ensemble oder einem Chor a cappella oder von Musikinstrumenten begleitet vorgetragen werden.
Beim Zusammenkommen von Gedicht und Musik im Lied bringt die Musik in ihren kompositorischen Bildungen schon ihre Bedeutung mit, die als ästhetische Mitteilung zu verstehen ist. Auch das Gedicht ist
[…] eine ästhetische Mitteilung an und durch sich selbst und es verleiht der Musik im Lied jene Art des Aussprechens und Besagens von Begriffslosen, der sich die Musik entgegenstreckt, die aber nur so durch Sprache erreicht werden kann (Eggebrecht 1979: 63).
Beim Lied wird der Klang des Textes aufgespürt und der Kontext wird daraus hervorgeführt, letztlich wird er auf das zurückgeführt, womit der Gehalt der Komposition vom Text her organisch sich entwickelt. Der gesungene Text ist bereits Musik und Klangwert gewordener Text. Der Text ist nur noch Klangmaterial und nimmt als dieses am musikalischen Kontext teil.
Die romantische Lyrik wird als eine von der Prosa und dem Drama zu unterscheidende literarische Gattung angesehen, in der die poetische Sprache als Musik verstanden werden will. Die Forderung nach lyrischer Ausdrucksstärke verbindet sich mit derjenigen nach der Musikalität der Sprache. Der Mythos des gemeinsamen Ursprungs von Sprache und Musik steht in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor allem im Zeichen Rousseaus, der der Ansicht war, dass die Sprache in ihren Anfängen viel musikalischer, melodischer, akzentuierter und artikulierter war. Der allmähliche Verlust dieser ursprünglichen Musikalität kann als „Indiz für Entfremdung des Menschen als Folge des zivilisatorischen Fortschrittes angesehen werden“ (di Stefano 1995: 124). Laut dieser Auffassung tritt das Visuelle hinter das Akustische zurück, das Semantische hinter das Klangliche.
Das „Poetische“ der Musik in der Romantik bezeichnet etwas Ideelles, das mitteilungswürdig und mit Mitteln der Musik durchführbar, als „Seelensprache für Seelenzustände“ anzusehen ist (Gruber 1995: 21). Die lyrische Sprachmusikalität wird zu einem ästhetischen Problem in der Dichtungstheorie dieser Zeit, das Lied wird mit der Lyrik gleichgesetzt.
Um die Kunst durch Kunst zu gestalten und zu erklären, begann im Jahre 2008 eine rege Zusammenarbeit zwischen einigen Musikerinnen von der Musikadkademie in Klausenburg und einer Linguistin der Klausenburger Germanistik, die mehrere Jahre andauerte. Um dem rumänischen, nichtdeutschsprachigen Publikum die beliebten Lieder berühmter deutschsprachiger Komponisten näher zu bringen, hat das Team (Dr. Ligia Ghilea, Dr. Daniela Vladu und Graphiker Olimpiu Dociu) einen ersten Band 2009[2] zur Interpretation deutscher Lieder von Schumann, Schubert und Mozart herausgegeben, wobei auch die deutschen Ausgangsgedichte mit ihren poetischen rumänischen Übertragungen und den dazu suggestiven Illustrationen abgedruckt wurden. Ende 2009 erschien der Band auf dem Büchermarkt, es fand ein öffentliches Konzert mit Life-Aufnahme im Radio-Saal Klausenburg statt. Das Vorwort des Buches und die Klavierinterpretation im Konzert realisierte Dr. Ligia Ghilea. Es sangen Roxana Leahu und Alexandra Zaharia, die Rezitation der rumänischen Verse erfolgte durch den berühmten Klausenburger Schauspieler Petre Băcioiu.
Weil die Aufführung unerwartet großen Erfolg erlebte, fassten die Veranstalter den Entschluss, die Konzeption der Zusammenarbeit weiterzuführen, so dass im Dezember 2010 die Lieder von Georg Dima als Buchband[3] erschienen. Die offizielle Buchpräsentation und das Musikkonzert mit Gedichtrezitationen samt Projektion der begleitenden Illustrationen fanden ebenfalls Ende 2010 im Radio-Saal statt. Die vertonten deutschen und rezitierten rumänischen Gedichte waren: Armes Herz, du konntest wähnen? [Biată inimă-nșelată] – Carl Theodor Körner, Untreu [Despre trădare] – Peter Cornelius, Vorsatz [Hotărâre] – Robert Eduard Prutz, Wir drei [Noi trei] – Theodor Bakody, Das traurige Blümchen [Săraca floare] E. Kliemsch, Mein Himmel [Cerul meu] – Carmen Sylva, Die Primel [Ciuboţica cucului] – Nikolaus Lenau, Ich fühle deinen Odem [Îţi simt a ta suflare] – Fr. Martin von Bodenstedt, O, wende nicht den scheuen Blick [Hai, nu privi în jos sfioasă], Dein gedenk’ ich, Margaretha! [Cu tine-n gând, Margareta…] , Am wilden Klippenstrande [Pe un mal pustiu de mare], Mir ist’s zu wohl ergangen [Prea mare, fericirea-mi…], Wann vergess’ ich Dein? [Când te voi uita?] – Joseph Viktor von Scheffel. Gleichzeitig wurde auch auch das 91-jährige Bestehen der Musikakademie „Gheorghe Dima“ gefeiert.
Die Zusammenarbeit ergab 2013 einen weiteren Liederband[4], der Hugo Wolf gewidmet war. Dem Team schloss sich als Sopran-Sängerin die Tochter von Dr. Ligia Ghilea, Ligia Ghilea Jr., an.
Die Vertonung eines romantischen Gedichtes geht nicht am Gedicht entlang und tilgt Sprache nicht, sondern lässt sich auf das Gedicht als sprachliche Mitteilung ein. Das setzt ein Verstehen des Gedichtes voraus, das seine Vertonung prägt, also ein Verstehen von Kunst durch Kunst. Das Hören eines Liedes wird somit zum Verstehen eines Verstehens mit Hilfe des Komponisten. Die Vertonung als Interpretation, auch Uminterpretation der sprachlichen Form und Aussage, fügt dem Gedicht Dimensionen und Sinnhaltigkeiten hinzu und gibt dem Hörer zu verstehen, was möglich ist, der Komponist aber selbst offen lässt und nicht ausspricht. Zusätzlich erfolgt durch die Übersetzung der Gedichte ins Rumänische eine Verdoppelung der lyrischen Mitteilung für den rumänischen Rezipienten.
Auch das poetische Übersetzen ist ein Verstehens- und Interpretationsprozess, der mehrere Phasen durchläuft. Das Übersetzen aus einer Sprache und Kultur in eine andere ist eine wichtige Tätigkeit, die man ausübt, um verschiedene Kulturen aneinander zu bringen. Viele Sprachkritiker haben sich Gedanken über diese Tätigkeit gemacht, einige vertraten sogar die Auffassung, dass es nicht realisierbar sei, etwas in einer anderen Sprache genau so wiederzugeben, wie es im Ausgangstext erscheint. Schleiermacher sieht dieses Vorhaben als ein „törichtes Unternehmen“ und begründet seine Aussage damit, dass sich Denken und Schreiben gegenseitig bedienen und dass somit verschiedene Sprachen unterschiedliche Denkweisen implizieren.
Dieses Unternehmens bediente sich auch die Übersetzerin der Gedichte, die Georg Dima vertonte, einige Beispiele werden angeführt:
Armes Herz, du konntest wähnen?
(Carl Theodor Körner)
Armes Herz, du konntest wähnen?/ Ach, dein Glaube war so süß./
Doch umsonst nun war dein Streben/ Nach der Liebe Paradies./
Froh schlugst du mit tiefem Beben/ Für das eig’ne Wunderland./
Doch vernichtet war dein Streben,/ Und der schöne Traum verschwand./
Biată inimă-nșelată
(Übersetzung Daniela Vladu)
Biată inimă-nșelată,/ Crezul tău fu ca un vis./
Căci în van unda-ţi deșartă/ Rătăcea spre paradis./
Cum băteai bine dispusă/ Pentru-un vis din zori de zi./
Năzuinţa-ţi fu distrusă/ Şi frumosul vis pieri./
Vorsatz
(Robert Eduard Prutz)
Ich will’s dir nimmer sagen/ wie ich so lieb dich hab’./
Im Herzen will ich’s tragen,/ will still sein wie das Grab./
Kein Lied soll’s dir gestehen,/ soll flehen um mein Glück./
Du selber sollst es sehen,/ du selbst in meinem Blick!/
Und kannst du es nicht lesen/ was dort so zärtlich spricht,/
So ist’s ein Traum gewesen,/ dem Träumer zürne nicht./
Hotărâre
(Übersetzung Daniela Vladu)
N-aș vrea să-ţi spun vreodată/ cât te iubesc de mult./
Povara-i ferecată/ în inimă. Sunt mut./
Vreun cant mărturisească/ norocu-mi implorând?/
Tu singură vezi astă,/ în ai mei ochi privind!/
Ce-acolo-i candid scris,/ de tu nu poţi citi,/
Atunci fu doar un vis;/ te rog, nu mă stârni!/
Dein gedenk’ ich, Margaretha!
(Joseph Victor von Scheffel)
Sonne taucht in Meeresfluten,/ Himmel blitzt in letzten Gluten,/
Langsam will der Tag verscheiden,/ ferne Abendglocken läuten./
Haupt gelehnt an Felsenkante,/ fremder Mann in fremden Lande,/
Um den Fuß die Wellen schäumen,/ durch die Seele zieht ein Träumen./
Dein gedenk’ ich, Margaretha!…
Cu tine-n gând, Margareta…
(Übersetzung Daniela Vladu)
Soare-n mare asfinţește,/ ceru-n urmă licărește,/
Ziua-ncet stă să apună,/ clopote de sară sună./
Capu-o stâncă-l sprijină,/ om străin, ţară străină,/
Valurile glezna-mi spală,/ și prin cuget vise zboară./
Cu tine-n gând, Margareta!…
Die Sprachmusikalität ergibt sich aus der Analogiebildung von dichterischer und natürlicher Produktivität. Begrifflichkeit, Bildlichkeit, Klanglichkeit, Satzbau, Metrum, Reim und Rhythmus treten spannungsvoll in den Gedichten zusammen. Die Strophen der Gedichte haben einen unschuldigen, unbeschwerten Ton, der nicht belehren will. Die Lexik ist einfach und trotzdem reich, die drei Faktoren Natur, Mensch und Gott werden als Themenschwerpunkte herausgehoben.
Die Gedichte in ihrem ungezwungenen Ton zeigen ein enges Verhältnis zur Musik, das menschliche Gefühl findet in ihrer Sprache eine reine und intensive Ausdrucksmöglichkeit.
Anmerkungen
[1] siehe dazu auch Vladu, Daniela: Musik als poetisches Ideal im deutsch-rumänischen Kontext. Vertonungen der deutschen Romantik durch Gheorghe Dima. In: Gorgoi, Lucia / Codarcea, Emilia et. al.: Germanistik im europäischen Kontext, Bd. V, Cluj-Napoca: Editura Mega 2013, S. 29-38.
[2] Vladu, Daniela: Şirag de lieduri în germană și română [Liederkette in deutscher und rumänischer Sprache], Cluj-Napoca: Editura Echinox 2009.
[3] Vladu, Daniela/Ghilea, Ligia: Gheorghe Dima. Lieduri în germană și română [Georg Dima. Lieder in deutscher und rumänischer Sprache], Cluj-Napoca: Editura Mega 2010.
[4] Vladu, Daniela/Ghilea, Ligia: Hugo Wolf. Lieduri în germană și română [Hugo Wolf. Lieder in deutscher und rumänischer Sprache], Cluj-Napoca: Editura Mega 2013.
Bibliographie
Dahlhaus, Carl: Musik als Text. In: Schnitzler, Günter (Hrsg.): Dichtung und Musik. Kaleidoskop ihrer Beziehungen. Stuttgart: Klett 1979, S. 11-28.
di Stefano, Giovanni: Der ferne Klang. Musik als poetisches Ideal in der deutschen Romantik. In: Gier, Albert / Gruber, Gerold W. (Hg.): Musik und Literatur. Komparatistische Studien zur Strukturverwandtschaft. Frankfurt am Main: Peter Lang 1995, S. 121-144.
Eggebrecht, Hans H.: Vertontes Gedicht. Über das Verstehen von Kunst durch Kunst. In: Schnitzler, Günter (Hrsg.): Dichtung und Musik. Kaleidoskop ihrer Beziehungen, Stuttgart: Klett 1979, S. 36-69.
Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Fr. Blume, Personenteil 5. Kassel u.a.Stuttgart u.a.: Bärenreiter / Metzler 2001.
Gruber, Gerold W.: Literatur und Musik – ein komparatives Dilemma. In: Gier, Albert / Gruber, Gerold W. (Hg.): Musik und Literatur. Komparatistische Studien zur Strukturverwandtschaft. Frankfurt am Main: Peter Lang 1995, S. 19-33.
Pahn, Johannes: Musik in der Sprache – Sprache in der Musik. In: Pahn, Johannes / Lamprecht – Dinnesen, A. et. al. (Hg.); Sprache und Musik. Stuttgart: Steiner 2000, S. 123-126.
Riethmüller, Albrecht: Rilkes Gedicht „Gong“. An den Grenzen von Musik und Sprache. In: Schnitzler, Günter (Hrsg.): Dichtung und Musik. Kaleidoskop ihrer Beziehungen. Stuttgart: Klett 1979, S. 194-223.
Schmidt, Björn – Helmer: Vergleichende Betrachtung zur Sprache und Musik. In: Böhme, Tatjana / Mehner, Klaus (Hrsg.): Zeit und Raum in Musik und Bildender Kunst. Köln u.a.: Böhlau 2000. S. 131–138.
Vieregge, Wilhelm H.: Sprache und Musik. Ein Vergleich im Hinblick auf ihren semiotischen und ästhetischen Charakter. In: Pahn, Johannes / Lamprecht – Dinnesen, A. et. al. (Hrsg.): Sprache und Musik. Stuttgart: Steiner 2000, S. 163-172.
Vladu, Daniela: Musik als poetisches Ideal im deutsch-rumänischen Kontext. Vertonungen der deutschen Romantik durch Gheorghe Dima. In: Gorgoi, Lucia / Codarcea, Emilia et. al.: Germanistik im europäischen Kontext, Bd. V, Cluj-Napoca: Editura Mega 2013, S. 29-38.
Vladu, Daniela / Ghilea, Ligia: Gheorghe Dima. Lieduri în germanâ si română. [Georg Dima. Lieder in deutscher und rumänischer Sprache]. Cluj-Napoca: Mega 2010.
Vladu, Daniela/Ghilea, Ligia: Hugo Wolf. Lieduri în germană și română [Hugo Wolf. Lieder in deutscher und rumänischer Sprache]. Cluj-Napoca: Editura Mega 2013.
Vladu, Daniela: Şirag de lieduri în germană și română [Liederkette in deutscher und rumänischer Sprache]. Cluj-Napoca: Editura Echinox 2009.