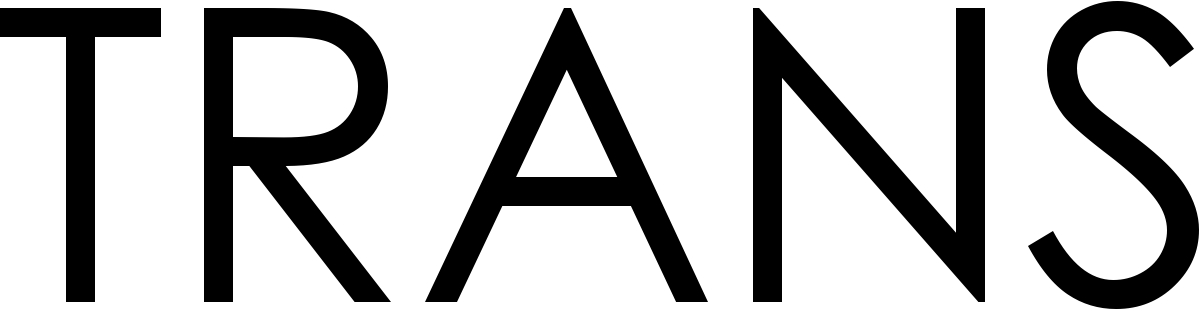David Simo
Kamerun
Der Titel meines Vortrags, gehalten im April 2014 in Lomé (Togo) bei einer Konferenz über Postcolonial Studies steht in intertextueller Beziehung zu dem berühmten Text von Spivak Can the Subaltern speak?. Spivak kommt zu einem Schluss, der sich radikal anhört: „The subaltern cannot speak“. Ihre implizite Position ist aber nicht so radikal wie der formulierte Schluss. Worum geht es bei Spivak? Ihre sehr komplexen philosophischen Überlegungen werden sehr unterschiedlich interpretiert. Einer der Gründe liegt darin, dass der Text in unterschiedlichen Versionen zirkuliert. Die meisten Versionen sind nur ein Kapitel eines viel längeren Textes, der darauf abzielt, den Standort des postkolonialen Sprechens zu konturieren und zu legitimieren. Der ursprüngliche Titel ihres Aufsatzes war Power, Desire and Interest. Macht und Begehren stellen zwei Grundkategorien dar, die das poststrukturalistische Denken in den 70er Jahren und danach strukturierte. Ihr ging es darum, sich mit avancierten Vertretern der „westlichen“ Intellektualität auseinanderzusetzen und zwar Foucault, Deleuze und Guattari. Vor allem die Bestimmung des Subjekts steht im Mittelpunkt ihrer Kritik. Sie rekuriert auf Marx und Derrida, um den Begriff Interesse wieder ins Spiel zu bringen, und somit die Interessengebundenheit des Denkens zu unterstreichen. Spivak zeigt, wie die Behauptung einer souveränen freien oder „transparenten“ Position des Wissenschaftlers oder des Intellektuellen durch viele europäischen und amerikanischen Wissenschaftler darin mündet, dass diese vielleicht unbewusst eine Vormachtstellung des Westen rekonstruieren. In ihren Worten heißt es: „And I will have recourse, perhaps surprisingly to an argument that Western intellectual production is, in many ways, complicit with Western economic interest”(S. 271). Dass sie hier einen gewissen Essentialismus das Wort spricht, kann nicht bestritten werden. Das macht ihre kritischen Anmerkungen nicht relevant. Gegenüber solchen Vorwürfen spricht sie gern vom strategischen Essentialismus.
Ich habe angedeutet, dass ihre Position nicht so radikal ist wie die formulierte Antwort auf die Frage „Can the subaltern speak?“ klingt. Sie selbst gibt an, worauf es ihr letzten Endes ankommt: „In the end, I will offer an alternative Analysis of the relations between the discourse of the West and the possibility of speaking of (for) the subaltern woman” (S. 271). Sie selber betrachtet sich als eine subalterne Frau. Sie weiß und zeigt, dass nicht alle subalternen Frauen die Möglichkeit und die Macht haben, wie sie ihre Belange und ihre Interessen zu artikulieren und sich Gehör zu verschaffen. Sie postuliert also ihr Recht für sie und über sie zu sprechen, da sie im Besitz der methodischen und begrifflichen Kompetenz der westlichen Akademia ist, zugleich aber das Potential hat, kritisch auf die gewohnten Spiele von Darstellung und Vertretungen zu blicken und die Mechanismen, durch die sie verfestigte asymmetrische Beziehungen in der Welt reproduzieren, aufzudecken. Sie bezeichnet diesen Gestus als prekär aber notwendig.
Auch mir geht es um das subalterne Subjekt und zwar das koloniale Subjekt. Ich gehe aber von einer anderen Feststellung aus und zwar von der Schwierigkeit, Spuren des kolonialen Subjekts in der Form von Aussagen oder Texten zu dokumentieren und zu besprechen. In der Literatur hat diese Situation dazu geführt, dass es weitgehend ein stummes Subjekt bleibt. In einem Roman wie Uwe Timms Morenga kommt paradoxerweise Morenga kaum selber zu Wort. Auch wenn der Roman seinen Namen als Titel trägt, werden ganz andere Quellen ausgiebig zitiert. Dies hat mit einem objektiven Tatbestand zu tun. Natürlich hat der historische Morenga gesprochen und gehandelt, aber es fehlen schriftliche Zeugnisse seiner Äußerungen. Sie können daher nur indirekt und das bedeutet oft in der Sprache der jeweils sie zitierenden Person wiedergegeben werden. Auch bei Uwe Timm kommen vor allem die Kolonisatoren zu Wort. Ihre Worte werden kritisch inszeniert, kontrastiert und gar in ihrer Logik ad absurdum geführt, weil sie in Dokumenten festgehalten werden und daher verfügbar sind. Dies kann man auch in verschiedenen Untersuchungen beobachten. Meistens stehen vor allem die Kolonisatoren im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen.
Bei Edward Said heißt es: „Never was it the case that the imperial encounter pitted an active Western intruder against a supine or inert non Western native, there was always some form of active resistance, and in the overwhelming majority of cases, the resistance finally won out” (P. XVII).
Aber auch in seinem Buch sind vor allem die Kolonisatoren diejenigen, deren Aussagen und Taten zentral analysiert und kritisch beleuchtet werden. Wie gesagt liegt dies daran, dass die koloniale Bibliothek und das koloniale Archiv vor allem aus Texten und Zeugnissen der Kolonialherren bestehen. Umso wichtiger ist es, jene wenige Dokumente, wo der Kolonisierte sich zu Wort meldet, stärker ins Bewusstsein zu rücken und zu untersuchen. Ich nehme das Postulat von Edward Said ernst und suche nach Spuren des subalternen kolonialen Subjektes. Mir geht es darum zu untersuchen, wie es sich als Subjekt auch mitten in der Subjugation positioniert hat. Mir geht es also darum zu zeigen, inwiefern und wie der Kolonisierte als Subjekt auftritt, d.h. als jemand mit einem individuellen und kollektiven Willen, der vermochte, Ziele zu verfolgen und Strategien zu entwickeln, um sie zu erreichen. Heute möchte ich mich mit jenen Texten beschäftigen, die am Anfang der Kolonisation standen, sie sozusagen eröffneten und begründeten, nämlich die sogenannten Schutzverträge. Betrachten wir einige dieser Schutzverträge näher:
„Mafungu Biniani, Herr von Quatunge Quaniani usw., Sultan von Nguru, tritt hiermit durch sein Handzeichen und unter Zuziehung der mitunterschriebenen Zeugen das ihm widerspruchslos als alleinigem Souverän gehörige Land Quaniani Quatunge Nguru mit allen ihm widerspruchslos und unbestritten gehörigen Rechten für ewige Zeiten und zu völlig freier Verfügung an Herrn Dr. Peters als den Vertreter der Gesellschaft für deutsche Kolonisation, Herrin von Useguha, ab.
Die Rechte, welche mit dieser Abtretung auf Herrn Dr. Carl Peters als den Vertreter der Gesellschaft für deutsche Kolonisation, Herrin von Useguha, übergehen, sind die dem Sultan von Nguru einzeln und mündlich dargelegten Rechte, welche nach den Begriffen des Quellen zu deutschen Staatsrechtes die Staatsoberhoheit sowie den privatrechtlichen Besitz des Landes bedeute.1
Muinin Sagara, Herr von Muinin Sagara usw., alleiniger und absoluter Herr von ganz
Usagara, und Dr. Carl Peters, als Vertreter der Gesellschaft für deutsche Kolonisation,
schließen hierdurch einen ewigen Freundschaftsvertrag ab.
Sultan Muinin Sagara erhält eine Reihe von Geschenken, weitere Geschenke für die
Zukunft werden ihm versprochen, und er tritt hierdurch unter den Schutz der
Gesellschaft für deutsche Kolonisation resp. deren Vertreter.
Dafür tritt der Sultan Muinin Sagara an Herrn Dr. Carl Peters, als den Vertreter der
Gesellschaft für deutsche Kolonisation, kraft seiner absoluten und unumschränkten
Machtvollkommenheit das alleinige und ausschließliche Recht, Kolonisten nach ganz
Usagara zu bringen, ab.2
Wir, die unterzeichneten unabhängigen Könige und Häuptlinge des Landes Kamerun am Kamerunfluß, welches begrenzt wird im Norden vom FlußBimbia, im Süden vom FlußQuaqua und sich erstreckt bis zu 4°10 nördlicher Breite, haben heute in einer Versammlung in der deutschen Faktorei an King Aquas Strand aus freien Stücken beschlossen wie folgt:
Wir treten mit dem heutigen Tage unsere Hoheitsrechte, die Gesetzgebung und Verwaltung unseres Landes vollständig ab an die Herren Eduard Schmidt und Johannes Voß als Vertreter der Firmen C. Woermann und Jantzen &Thormählen in Hamburg, welche seit vielen Jahren an diesem Flusse Handel treiben.3
Auf dem ersten Blick stellt sich die Frage „Wer spricht hier?“ Kann man den Text überhaupt als Willensäußerung betrachten oder gar als authentische Äußerung eines freien und bewussten Subjektes? Schon die Sprache, nämlich die deutsche Sprache als Kommunikationsmittel ist verdächtig. In einem der Schutzverträge heißt es ausdrücklich, dass der Text durch einen Dolmetscher dem Vertragspartner übersetzt wurde. Auch der juristische Duktus deutet darauf, dass hier Experten am Werk sind, die bewandert sind in der juristischen Sprechweise. Diese Texte, die in verschiedenen Kontexten und durch verschiedene Akteure erarbeitet und getragen wurden, weisen überraschende strukturelle Ähnlichkeiten aus. Hier sprechen Individuen, die in ihrem eigenen Namen handeln, auch wenn sie als Potentaten eine Bevölkerung zu vertreten behaupten. Man braucht diese Texte nur mit anderen im kolonialen Kontext entstandenen Verträgen zwischen europäischen Nationen zu vergleichen, um deutlich zu merken, dass wir hier nicht mit den üblichen zwischen Nationen abgeschlossenen Übereinkünften zu tun haben. In den zwischen Deutschland und England oder zwischen Deutschland und Frankreich getroffenen Vereinbarungen sind die Subjekte der Verhandlung Staaten, nicht die Staatsoberhäupter. Dort heißt es nämlich:
Die Kaiserlich Deutsche Regierung und die Regierung der Französischen Republik sind übereingekommen, im Anschluß und als Ergänzung des Marokko betreffenden Abkommens vom 4. November 1911 und als Kompensation für die Schutzrechte, die Frankreich bezüglich des Scherifenreiches zuerkannt worden sind, einen Gebietsaustausch in ihren Besitzungen in Äquatorial-Afrika vorzunehmen und zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen.4
Dies hat dazu geführt, dass viele Juristen die internationale Rechtsgültigkeit der Verträge in Frage gestellt haben. Ein kamerunischer Jurist nennt sie schlicht private Abmachungen. Haben wir hier mit dem von Homi K. Bhabha so gut analysierten kolonialen Mimikry zu tun? Damit bezeichnet Bhabha zunächst den kolonialen Ethos, der vorgibt, europäisch zu sein, den Normen der europäischen Gepflogenheit aber nicht entspricht. Es handelt sich um eine für die Kolonisationssituation erarbeitete Handlungs- und Sprechweise, die nur in der Kolonie Gültigkeit hat und nicht in der Metropole.
Auf jeden Fall kann man sich fragen, ob es sich bei diesen Schutzverträgen nicht um eine Bauchrederei handelt, bei der der Kolonisator durch den Mund des Kolonisierten spricht. Spricht also hier der Kolonisator und nicht der Kolonisierte? Drückt sich in den Texten nicht eher der Wille, fremde Länder zu annektieren und den rechtsmäßigen Besitzern zu enteignen? Wenn man die historischen Umstände der Unterzeichnung genau kennt, ist die Antwort auf solche Fragen nicht so selbstverständlich, wie es scheint.
Es soll zunächst daran erinnert werden, dass allein in Kamerun insgesamt 95 Verträge mit lokalen Machthabern unterschrieben wurden. Dazu kommen nicht schriftlich fixierte Abmachungen, die in manchen Fällen sogar besser funktionierten als unterschriebene Verträge. Diese schriftlich verfassten und unterschriebenen Verträge waren sehr unterschiedlicher Natur. Darunter hatten wir Kaufverträge, Friedensverträge und natürlich Schutzverträge und sogar Freundschaftsverträge. Dies bedeutet, dass manche Verträge und gerade die Schutzverträge durch echte Verhandlungen zustande kamen. Auch die afrikanischen Verhandlungspartner handelten also weder unter Druck, noch in totaler Ignoranz dessen, was sie unterschrieben. Im Gegenteil. Konzentrieren wir uns auf den Schutzvertrag, der zwischen dem 11. Und 12. Juli 1884 in Kamerun unterschrieben wurde. Dieser Vertrag bereitet vielen Wissenschaftlern große Schwierigkeiten, die durch eine einfache Frage zusammengefasst werden können: Wie konnten die Herrscher ohne Zwang ihre Souveränität einem anderen abtreten? In dem Vertrag heißt es sehr klar: „Wir treten mit dem heutigen Tage unsere Hoheitsrechte, die Gesetzgebung und Verwaltung unseres Landes vollständig an die Herren Eduard Schmidt und Johannes Voß als Vertreter der Firma C. Woermann und Jantzen & Thormählen in Hamburg, welche seit vielen Jahren an diesen Flüssen Handel treiben.“
Vor diesem Rätsel wurden unterschiedliche Erklärungsmuster bemüht. Der erste Ansatz ist der kulturalistische. Hier geht man davon aus, dass das Subjekt über ein Reservoir von Interpretations- und Handlungsmustern verfügt, das von der Kultur übermittelt wird und seinen Horizont von verstehen und handeln festlegt. Dieses Subjekt handelt also nach vorgegebenen Kodes, die ihm eine Identität verleihen. Um zu verstehen, was es sagt oder tut, muss man den Schlüssel besitzen, der sein Fühlen und Tun sinnvoll macht. In Bezug zu dem Schutzvertrag, von dem wir hier sprechen, hat der kamerunische Philosoph Nsame Bongo nach der Methodologie der sogenannten Ethnophilosophie versucht, in der Duala-Kultur das kulturelle Dispositiv zu finden, das das Handeln der Duala-Herrscher erklären könnte. Nach einer akribischen Analyse von mündlichen literarischen Texten kommt er zu dem Schluss, dass die Herrscher nach zwei kulturellen Prinzipien gehandelt haben, und zwar der Pazifismus und die Solidarität. So schreibt er:
Car il faut bien souligner que la philosophie de solidarité pacifiste vis-à-vis des étrangers repose sur le socle métaphysique qui fait dépendre les orientations et les choix des générations actuelles des significations anciennes remontant aux ancêtres et fournissant les critères d’authenticité et de validité nécessaires à la conception et à la conduite d’une action moralement et politiquement acceptable. (P. 16)
Denn man muss klar betonen, dass die Philosophie der pazifistischen Solidarität gegenüber Fremden auf der metaphysischen Grundlage beruht, die die Denkrichtung und die Entscheidungen aktueller Generationen von antiken, auf Ahnen zurückführenden Sinngebungen abhängig machen, so dass die Vergangenheit die Kriterien der Authentizität und der Gültigkeit in der Konzeption und Durchführung einer moralisch und politisch annehmbaren Tat bestimmt.
Nach diesem Erklärungsmuster handelten die Herrscher insofern richtig, als sie dabei den eigenen, d.h. im Grunde den Prinzipien ihrer Kultur treu blieben. Die Einschränkungen, die sie im Vertrag formulierten, entsprachen auch grundsätzlichen kulturellen Paradigmen. Das Problem mit solchen Erklärungsmustern liegt nicht nur in der Vorstellung eines globalen und absolut kohärenten und stimmigen Kulturbegriffs, der hier mitschwingt, es liegt auch darin, dass die konkreten Umstände der Verhandlungen einfach ausgeblendet werden. Bei der ethnophilosophischen Vorgehensweise werden nur jene mündlich überlieferten Texte mobilisiert, die eine vorgegebene Sinnkonstruktion dokumentieren. Texte, die eine konträre Ansicht andeuten, werden ignoriert. Und so konstruiert man eine holistische Weltanschauung, die als authentischer Rahmen des Denkens und Handelns aller Individuen in der gegebenen kulturellen Gruppe betrachtet werden kann. Dabei geht es meistens nicht wirklich um eine emische Perspektive, die von einer Innensicht ausgehend, Denkkategorien von Betroffenen in ihrer eigenen Begrifflichkeit wiedergibt, sondern um eine retrospektive Konstruktion, die vom Unbehagen der Nachkömmlingen zeugt, welche ihre Vorfahren mit Kategorien zu verstehen versuchen, die aus Herausforderungen von heute resultieren. Das Handeln von gestern wird also mit Kategorien von heute interpretiert. Dabei werden ethische und politische Maßstäbe verwendet, die für heute die Taten sinnvoll machen. Die Konstruktion eines sinnvollen Bezugsrahmen rekurriert paradoxerweise auf ein von der kolonialen Bibliothek geliefertes Paradigma: Das subalterne koloniale Subjekt als das Andere der Europäer. Das koloniale Subjekt kennzeichnet sich durch seine Alterität zum europäischen Kolonisator. Er verwendet kulturelle Kodes, die den europäischen entgegengesetzt sind. Das, was oft als koloniales Missverständnis gedeutet wird, resultiert, nach diesem Deutungsmuster aus der Konfrontation von zwei verschiedenen Kulturen mit unterschiedlichen Kodes. So schreibt Nsame Bongo:
C’est le lieu de dire que le traité de 1884 nous met en présence d’un véritable choc des valeurs qui traduit l’opposition qui n’a pas pu être surmontée, entre une philosophie occidentale bourgeoise de la domination violente en vue de l’accumulation exclusiviste de la puissance matérielle et une philosophie africaine de l’humanisme traditionnel tournée vers la prépondérance de l’intérêt commun conformément à l’idéal de solidarité entre les contemporains et entre les générations. D’un côté, la vision de la politique émane d’une logique juridique communautariste et égalitariste qui tend à fusionner légalité et légitimité et à donner à la morale une place centrale, étant entendu qu’est moral, ce qui se conforme à la justice et privilégie l’humain[…] (P. 17)
An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass wir bei dem Vertrag von 1884 mit einem Zusammenprall von Werten zu tun haben, der auf eine nicht überwundene Opposition deutet zwischen der okzidentale-bürgerlichen Philosophie der gewaltigen Herrschaft mit dem ausschließlichen Ziel die Anhäufung von Gütern auf der einen Seite, und der afrikanischen Philosophie des traditionellen Humanismus auf der auf der anderen Seite, , die das Gemeinwohl nach dem Ideal der Solidarität unter Zeitgenossen und Generationen privilegiert. Auf der einen Seite basiert die politische Vision auf eine kommunautarische und egalitaristische Rechtslogik, die dazu tendiert, Legalität und Legitimität zu vereinen und die Moral ins Zentrum des Interesses zu rücken, da moralisch das ist, was rechtmäßig ist und dem Menschen Vorrang gibt.
Hier gibt es nur kollektive Subjekte, keine individuelle. Menschen sind nur reagierende Akteure, die von einer Black Box gesteuert sind. Sie sind keine Subjekte, sondern Werkzeuge eines übergeordneten Subjektes, das allein vermag, Willen und Ziele zu haben. Dieses übergeordnete Subjekt umfasst sehr oft bei einer solchen Vorgehensweise eine immer größere Gruppe. Hier geht man von der Duala-Kultur und schließt auf eine afrikanische, von einer deutschen auf eine okzidentale. Am Ende handeln also die Duala-Herrscher als Reifikation oder Vergegenständlichung der Abstraktion Afrika bzw. der afrikanischen Kultur. Wie oft bei kulturalistischen Ansätzen oszilliert man zwischen einer genauen lokalen Bestimmung der Gruppen wie die Duala und einer viel vageren wie die Afrikaner, ohne dass immer klar wird, wie man von der einen auf die andere übergeht. Es wird nicht geklärt, wie die bei der Analyse von Duala-Texten festgestellten Charakteristika auf ganz Afrika übertragen werden können. Solche Deutungsmuster sind also in vieler Hinsicht sehr problematisch und vermögen nicht, historische Handlungsmuster genau zu analysieren.
Von einer Blackbox, die die Einstellung und das Handeln der Duala Fürsten bei dem Unterschreiben der Schutzverträge bestimmt hat, kann man im Grunde nicht sprechen. Damit wird nicht behauptet, dass kulturbedingte Werte und Einstellungen bei solchen Entscheidungen keine Rolle spielen. Man soll aber ihre Bedeutung nicht überbewerten.
Das zweite Deutungsmuster, das oft das kulturalistische ergänzt oder verstärkt, ist das behaviouristische. Hier geht man davon aus, dass das Subjekt nach einem natürlichen instinkthaft vorgegebenen Script handelt, der genau festlegt, welche Reaktion auf welchen Stimulus erfolgt. Das Subjekt handelt also aus hardwired von der menschlichen Natur determinierten Impulsen oder aus erlernten Stimuli-Response Modellen. So ist es möglich, ein Katalog von Handlungsmustern vorgegebener Situationen zu erarbeiten und Subjektpositionen danach zu klassifizieren. Aussagen und Handlungen von kolonialen Subjekten können also nach klaren Kategorien rubriziert werden. In der Regel werden nur zwei Kategorien bestimmt: Widerstand und Kollaborationen. Die meisten Untersuchungen zum Verhalten der kolonialen Subjekte arbeiten danach und erarbeiten eine Galerie von guten Widerstandskämpfern und bösen oder zumindest problematischen Kollaborateuren.
Wie wenig solche Analysearten vermögen, viele Situationen, Texte und Handlungsmuster von kolonialen Subjekten adäquat zu erfassen, ließe sich an vielen Beispielen zeigen. Wenn wir die unterschiedlichen Versuche, auf Herausforderungen zu reagieren, die sich aus einer asymmetrischen und gar brutalen Begegnung mit dem Fremden ergaben, in ihrer Komplexität und Intensität erfassen wollen, dann brauchen wir ein anderes Analyseraster. Wenn wir annehmen wollen, dass Kolonisierte handelnde Subjekte geblieben sind, und dass es notwendig ist, bei ihnen verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit dem Unglück zu untersuchen und zwar nicht nur gelungene oder erfolgreiche, müssen wir anders vorgehen. Vielleicht ergibt sich daraus eine Reihe von intelligenten, strategischen und genau überlegten, erhabenen, aber auch tragischen, pathetischen, lächerlichen, naiven, schurkenhaften Persönlichkeiten. Manche werden so komplex sein, dass man sie nicht einfach moralisch klassifizieren kann. Manche werden sympathisch sein, andere weniger, aber wir werden zumindest verstehen, unter welchen Bedingungen sie handelten, wie sie auf die Situationen einzuwirken versuchten, was sie bewegte, wie sie sich betrachteten, wie sie andere betrachteten, wie sie sich die Welt vorstellten, welche Einschätzung sie von den Menschen und von den Dingen hatten, wie sie sich fühlten, wie sie sich die Zukunft vorstellten.
Um ein Modell solcher Analyse zu erarbeiten möchte ich auf zwei theoretische Ansätze rekurrieren und zwar auf den symbolischen Interaktionismus von Blumer und auf die Theorie des strategischen Handelns von Michel Crozier und Erhard Friedberg. Crozier und Friedberg haben zwar die Theorie des symbolischen Interaktionismus kritisiert, es ist aber möglich, beide zu kombinieren, weil beide Theorien darauf abzielen, zu erklären, wie die Interaktion zwischen Menschen und Gruppen verlaufen und auf welcher Grundlage sie verlaufen. Mit der Kombination beider Theorien lässt sich, so meine ich, eine vorurteillose Rekonstruktion von Lebensgeschichten, von individuellen Strategien zur Bewältigung von Situationen machen und diese Strategien gründen immer auf einer Einschätzung der Situation und der Interaktionspartner. Nach Blumer ist das menschliche Zusammenleben ein Prozess, in dem Objekte geschaffen, bestätigt, umgeformt und verworfen werden. Das Leben und das Handeln von Menschen wandeln notwendigerweise in Übereinstimmung mit den Handlungen, die in ihrer Objektwelt vor sich gehen (vgl. Blumer S. 91). So fasst er seine Theorie in drei Prämissen zusammen:
-
Menschen handeln auf der Grundlage der Bedeutungen, die Dinge für sie tragen.( Mit Dingen meint er sowohl Gegenstände als auch Menschen oder Kategorien von Menschen, Institutionen oder Werte.)
-
Die Bedeutung dieser Dinge ist abgeleitet aus der sozialen Interaktion, die man mit seinen Mitmenschen eingeht.
-
Die Bedeutungen werden in einem interpretativen Prozess, den die Person in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, erarbeitet und abgeändert. (Blumer S. 81)
Daraus leite ich ab, dass Subjektpositionen aus der Vorstellung, die man sowohl von Situationen als auch von den Interaktionspartnern und von Institutionen hat, hervorgehen. Diese Vorstellung resultiert aus der Erfahrung, die man mit den Mitmenschen hat und verändert sich im Prozess der Interaktion. Subjekte interpretieren also Situationen nicht einfach aufgrund von vorgefundenen Deutungsmustern, sondern aufgrund von Erfahrungen und können also ihre Interpretation ändern. Menschen sind also rationale Wesen, die Situationen einzuschätzen vermögen und Entscheidungen entsprechend treffen können. Sie benutzen dabei kulturelle Kodes aber sie sind durchaus imstande zu erkennen, ob diese Kodes adäquat sind und ob sie diese Kodes ändern müssen.
Von der Theorie des strategischen Handelns übernehme ich die Idee der Macht. Demnach sind zwischenmenschliche Beziehungen von dem Willen geprägt, Macht über den Anderen zu üben. Es wird dann möglich, Ressourcen zu analysieren, die Akteure mobilisieren, um Einfluss oder Macht über andere zu gewinnen oder um zu verhindern, dass andere Macht auf einen gewinnen. In den zwischenmenschlichen Interaktionen ist also nicht nur ein Prozess von Interpretation im Gange, sondern auch eine Strategie, um Vorteile zu gewinnen oder seine Interessen durchzusetzen.
Wie schon oben angemerkt standen die Duala zur Zeit der Unterzeichnung der Schutzverträge schon in regen Kontakt mit den Europäern und speziell mit den Engländern. Dies hatte zu grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen geführt. Durch die Einführung der Geldwirtschaft und des Ausfuhrhandels hatten sich neue Möglichkeiten und Formen der Bereicherung entwickelt. Nutznießer dieser Entwicklung waren vor allem die Potentaten. Aber auch andere Schichten der Bevölkerung profitierten davon. Diese ganze Umwandlung der Gesellschaft generierte auch große soziale Spannungen. So kam es zu sozialen Unruhen und zu Spannungen zwischen den Herrschern und Menschen aus unteren Schichten, die reicher geworden waren. Auch zwischen den Herrschern kam es immer wieder zu Rivalitäten. Die Verkomplexifizierung der innersozialen Beziehungen führte zu einer Unsicherheit dieser Herrscher, die an ihrer eigenen Fähigkeit zweifelten, Herr der Lage zu bleiben. Da sie gesehen hatten, nämlich durch den „Court of Equity“, dass die Europäer offensichtlich über bessere Techniken der Regulierung von sozialen Spannungen verfügten als ihre eigene gewohnten Institutionen, kamen sie immer mehr auf die Idee, ihnen die Kontroll- und Stabilisierungsfunktion zu übergeben:
Une autre réalité majeure de cette période, le XIXe siècle, est que les relations des Duala et des Européens actifs dans leur région sont confiantes et mutuellement bénéfiques. Ayant une expérience consommée de la gestion politique d’Etats complexes, les Blancs étaient donc considérés comme bien placés pour les aider à maîtriser cette phase inédite. (Nsame Bongo, S. 6ff.)
Eine weitere, grundlegende Tatsache dieser Epoche, des 19. Jahrhunderts, ist, dass die Beziehungen zwischen den Duala und den in ihrer Region tätigen Europäern auf gegenseitigem Vertrauen und Gewinn basieren. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Umgang mit komplexen politischen Staaten waren die Weißen für die Duala am besten geeignet, ihnen aus dieser völlig neuen Situationen heraus zu helfen.
Die Nachrichten aus Calabar in der Guinea Bucht, unweit von Duala im heutigen Nigeria, wo die britische Verwaltung etabliert war, bestärkten die Herrscher in der Idee, dass die Übertragung der Verwaltung auf die Europäer eine vernünftige Sache war. Deswegen schickten sie 1879 und 1881 ein Angebot an die englische Königin. Weil die Engländer zögerten, wurden die Deutschen als Partner angenommen. Worum ging es bei solchen Angeboten? Nach dem deutschen Historiker Wirz ging es keinesfalls um Unterwerfung. Der Schutzvertrag mit den Deutschen zeigt das deutlich. Klare Einschränkungen werden formuliert:
-
Die Rechte Dritter sollen unverletzt bleiben.
-
Alle früher mit anderen Mächten abgeschlossenen Freundschafts- und Handelsverträge sollen in Kraft bleiben.
-
Das jetzt von uns bewirtschaftete Land und der Grund und Boden auf welchem Städte erbaut sind, sollen Eigentum der jetzigen Besitzer und ihrer Rechtsnachfolger bleiben.
-
Der Kumi (Faktoreisteuer) soll jährlich den Königen und Häuptlingen wie bisher gezahlt werden.
Wenn man diese Vorbehalte genau liest, merkt man, dass es ihnen nur darum ging, die komplexer gewordene Arbeit der Ordnungshaltung und der bürokratischen Verwaltung zu übergeben. Sie waren von der bürokratischen Effizienz der Europäer fasziniert. Dieser Text ist noch in der juristischen Sprache geschrieben. Offensichtlich waren sich die Herrscher nicht sicher, ob damit ihre Einsichten klar genug formuliert waren. Daher schrieben sie in ihrem eigenen Englisch einen Text, der bekannt ist als „Wünsche der Kamerun Leute“, obwohl er in Englisch verfasst ist. Hier ist der Wortlaut dieses Textes:
Our wishes is that white men should not go up and trade with the Bushmen, nothing to do with our markets, they must stay here in this river and they give us trust so that we will trade with our Bushmen.
We need no protection, we should like our country to annect with the government of any European Power.
We need no attention about our Marriages, we shall marry as we are doing now.
Our cultivated ground must be taken from us, for we are not able to buy and sell as other Country.
We need no Duty or Custom House in our country.
We shall keep Bulldogs, Pigs, Goats, Fowls, as it is now, and no Duty on them.
No man shall take another man’s wife by force, or else a heavy [fine (?)].
We need no fighting and beating without fault and no impression on paying the trusts without notice and no man shall be put to Iron for the trust.
We are the chiefs of Cameroons.
Durch alle diese Restriktionen wird klar, dass die Herrscher im Grunde den Deutschen nur lästige Aufgaben, die sie selber nicht übernehmen konnten, abtreten wollten, ohne dabei ihre gewohnten Rechte (vor allem ökonomische) und Sitten einzubüßen. Sie waren überzeugt, im eigenen Interesse zu handeln. Sie hatten wahrscheinlich gemerkt, wie genau die Europäer sich an geschriebenen Abmachungen hielten. Durch diesen Schriftfetichismus der Europäer wähnten sie sich geschützt gegen Wortbrüche oder Willkür.
Wie man weiß, kam es anders. Sie entdeckten später ein anderes Gesicht der Europäer, mit denen sie bis dahin vertrauensvoll verkehrt hatten und die sich als skrupellose Herrscher entpuppten. Sie dachten in der Interaktion, die Mächtigeren und Herren der Lage zu sein. Ihre ungenauen Kenntnisse ihrer Partner führten dazu, dass sie strategische Fehler machten, die ihnen dann zum Verhängnis wurden. Keine ihrer Wünsche wurde respektiert. Die an deutsche Händler abgetretenen Rechte wurden kurz danach an den deutschen Staat weiter gegeben und dieser handelte nicht mehr als individuelles Wesen, sondern als Macht, als Herrschaftsmaschinerie, die nach einer ganz anderen Logik als bei interindividuellen Interaktionen agierte. Die Potentaten handelten als Individuen und nicht als Machtentitäten. In einigen Textstellen sprechen sie als Repräsentanten eines Volkes, aber nicht so sehr in ihrem Namen. Sie behielten weitgehend eine individuelle Subjektposition. Gegenüber einem Staat fanden sie sich sehr schnell in einer nicht mehr beherrschbaren Situation, wo zwar einige Regel der Interaktion bestanden, die Verhältnisse aber keine interindividuelle Interaktion mehr waren. Und auch hier machten sie eine falsche Analyse der Situation. Der Partner hatte sich geändert und sie glaubten weiterhin nach demselben Prinzip wie bei den Händlern vorgehen zu können bis sie verstanden, dass die politische Interaktion eine ganz andere als die private soziale ist. Dann war es zu spät. Die deutsche Herrschaft hatte sich bereits konsolidiert und jeder Versuch, als politisches Subjekt zu handeln und nicht mehr als individuelles Subjekt, wurde erbarmungslos und mit aller Gewalt unterbunden.
Bibliographie
Bhabha, Homi K. (2004): “Location of Culture”, Routledge. London.
Blumer, H. (1937). Social psychology, in: Schmidt, E. P. (Éd): Man and society New York : Prentice Hall, Pp. 144-198
Crozier M. & Friedberg E., (1977) :L’acteur et le système, Editions du Seuil, Paris
DOO BELL, J. (2004) : Traité germano-duala : 120 années de controverse. Réflexions Kum-mouelle-nsame-ntone in: Le Messager du 09.08.2004.
Nsame Bongo (2002) : Rationalité juridique et philosophie des conflits, le cas germano-duala: 1884-1914, Conférence présentée le 05 mars 2002 dans le cadre du Programme AfricAvenir de séjour et d’études des étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques de l’Université Libre de Berlin au Cameroun, AfricAvenir, Douala. (zitiert nach einem nicht veröffentlichten Manuskript)
Said E. (1993): Culture and imperialism, Vintage, New York
Spivak, Gayatri C. (1988): “Can the Subaltern Speak?” in: Cary N. & Lawrence G. (Eds): Marxism and the Interpretation of Culture, University of Illinois Press, October 1. Pp. 271-313.
Wirz, Albert, Vom Sklavenhandel zum kolonialen Handel. Wirtschaftsräume und Wirtschaftsformen in Kamerun vor 1914. Zürich 1972
1 Carl Peters‘ Vertrag mit Mafungu Biniani, Sultan von Nguru, am 23. November 1884.
2 Carl Peters‘ Vertrag mit dem Sultan von Usagara vom 4. Dezember 1884.
3 Erster Schutzvertrag vom 12. Juli 1884 zwischen den Königen und Häuptlingen des Landes Kamerun und den Vertretern der Firmen C. Woermann und Jantzen & Thormählen.
4 Deutsch-Französisches Abkommen über Marokko vom 4. November 1911.