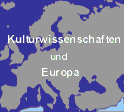
Kulturwissenschaften und Europa
oder die Realität der Virtualität
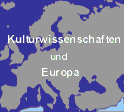
|
Kulturwissenschaften und Europa Enzyklopädie vielsprachiger Kulturwissenschaften |
Tunca Kortantamer (Izmir)
Der Zivilisationsbegriff bei den Türken
Den Begriff "Zivilisation" übernahmen die Türken
von der französischen Sprache. Dies steht im Kontext der
Begegnung der Türken mit der europäischen Kultur, die
eigentlich ziemlich früh begann. Es darf nicht vergessen
werden, daß die Osmanen schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts
in Europa Fuß gefaßt hatten und bis zum 17. Jahrhundert
immer nach Westen drangen, so daß sie zu Grenznachbarn der
Österreicher wurden. Es ist bekannt, daß sie - wenn
auch in den Anfängen weniger - von den Europäern beeinflußt
wurden. Zum Beispiel: Im 15. Jahrhundert lud Mehmet der Eroberer
den bekannten italienischen Maler Bellini ein und ließ sein
Portrait von ihm machen. Der berühmte Leonardo da Vinci schlug
Beyezid II., dem Sohn des Erorberers, vor, eine Brücke in
Istanbul zu bauen. Im 17. Jahrhundert zeichnete Piri Reis, der
Admiral, eine Karte, die heute noch in der Forschungswelt für
ihre "Modernität" bekannt ist. In demselben Jahrhundert
schildert Evliya Çelebi die Stadt Wien auf eine sehr interessante
Weise. Und im selben Jahrhundert deutet Katip Çelebi an,
daß ihm einiges von der europäischen Kultur bekannt
sei.
Trotz der Begegnungen mit der europäischen Kultur interessierten
sich die Osmanen für die Zivilisation Europas nicht, weil
sie bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts glaubten, daß sie
das stärkste Reich der Welt hätten und ihre Lebensweise
die beste auf der Welt sei. So glaubten sie, daß sie das
Recht hätten, die Weltordnung (=nizâm-i âlem)
zu hüten.
Die Niederlagen, die nach dem verheerenden Rückzug von Wien
im Jahre 1683 nacheinander kamen, und der erniedrigende Vertrag
von Karlofça im Jahre 1699 richteten die Aufmerksamkeit
der Osmanen auf die Überlegenheit der Europäer in der
Wissenschaft und Technologie. Auf diese Weise fingen sie an, sich
für diese Seite der europäischen Zivilisation zu interessieren.
Mit der Zeit steigerte sich dieses Interesse immer mehr.
Am Anfang des 19. Jahrhunderts erlebten die Osmanen viele Katastrophen.
Aufstände, Verluste, Niederlagen kamen nacheinander. Das
alles war unerträglich für sie. Im Gegensatz dazu erreichte
die europäische Zivilisation in demselben Jahrhundert ihre
Blüte. Europäer bestimmten die Weltpolitik. Sie glaubten,
daß sie das Recht hätten, die Welt in ihrem eigenen
Sinne zu zivilisieren.
Gerade in diesem Jahrhundert, nach den Pleiten in den Anfängen
des Jahrhunderts, schickte das osmanische Reich mehrere Botschafter
nach Europa, um dort nach Hilfe zu suchen. Der Botschafter in
Paris hieß Mustafa Resid (der spätere Pasa und Leiter
der Reformen). Ab 1834 schickte er schriftliche Berichte an die
Hohe Pforte, dem Regierungszentrum des Reiches. In diesen Berichten
wurde oft das Wort "Sivilizasyon" erwähnt. So machten
die Türken mit dem Begriff "Zivilisation" Bekanntschaft.
Im Grunde genommen hatten die Rivalen der Osmanen in Ägypten,
Mehmet Ali Pasa und sein Sohn Ibrahim, angefangen, den Begriff
Zivilisation gegen die Osmanen als ein Propagandamittel in Frankreich
auszunutzen, um europäische Unterstützung zu erhalten.
Sie meinten, daß sie für die Zivilisation wären,
die Osmanen sie aber daran hinderten. Gegen diese Propaganda verteidigten
sich die Osmanen mit ähnlichen Argumenten, indem sie behaupteten,
daß sie auch angefangen hätten, sich zu zivilisieren.
Zur dieser Zeit leiteten die Osmanen aus dem Wort "medine",
d.h. die Stadt, solche Wörter wie "medeniyet" für
Zivilisation, "medenî" für zivil, "medenileºme",
"temeddün" für zivilisiert werden, "mütemeddin"
für zivilisiert ab. Bei dieser Wortbildung merkt man, daß
die Osmanen über die Beziehung zwischen der Stadt und der
Zivilisation Bescheid wußten. Diese Beziehung war ihnen
seit langem bekannt, weil die osmanischen Chronisten Ibn Chaldun
gelesen hatten. Man fing an, diese Wörter in den vierziger
Jahren des 19. Jahrhunderts zu verwenden. Sowohl die Wörter
"medenî", "medeniyet", "medenilesme"
als auch die Wörter "Sivilizasyon" und "sivil"
sind in der türkischen Sprache heute noch im Gebrauch. Ungefähr
ein Jahrhundert später - in den dreißiger Jahren des
20. Jahrhunderts - erfand man unter dem Einfluß der Türkisierungsmode
der Sprache die Wörter "uygar" (d.h. zivil), "uygarlik"
(d.h. Zivilisation) und "uygarlasmak" (d.h. zivilisiert
werden). Ähnlich wie bei der Bildung des Wortes "medeniyet"
aus dem Wort "medina" ging man auch hier vom Begriff
"Stadt" aus. Es ist nämlich bekannt, daß
die Uiguren des 8. Jahrhunderts die ersten Türken sind, die
Städte besaßen. Man entwickelte das Wort "uygarlik"
aus dem Wort "uygur" nach dem Beispiel "medine"
und "medeniyet". Auch diese Wörter werden heute
unter den jüngeren Generationen häufiger verwendet.
Für die westliche Zivilisation interessierten sich im osmanischen
Reich im 19. Jahrhundert hauptsächlich die Literaten unter
den Intellektuellen, die für die Akzeptierung dieser Zivilisation
im Reich politisch aktiv wurden. Durch diese Aktivität entstanden
Begriffe wie "Avrupalilasmak" (europäisiert werden),
"çagdaslasmak" (zeitgenössisch werden),
"batililasmak"(Verwestlichung), "modernlesmek"
(modernisiert werden) u.ä. Darüber, was diese Begriffe
beinhalten und wie man sie verwirklichen könnte, wurde viel
diskutiert. Mit der Zeit entstanden drei Ziele : 1. Demokratie
und Freiheit, 2. Zivilisation, 3. Beförderung der Wissenschaft
und Technologie.
In den Fremdwörterbüchern, die in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts im osmanischen Reich im Gebrauch waren, konzentriert
sich die Bedeutung des Wortes Zivilisation mehr auf die guten
menschlichen Beziehungen, Erziehung und Moral. Das zeigt einen
eindeutigen französischen Einfluß. Denn die französische
Kultur betrachtete die verfeinerten menschlichen Beziehungen als
einen wichtigen Bestandteil der Zivilisation. Nach dieser Einstellung
können auf diese Weise die grobe Natur des Menschen milder,
die rauhen Sitten feiner und das Barbarentum menschlicher werden.
Nur durch sie kann das erreichte hohe Niveau bewahrt werden.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff
Zivilisation in den türkischen Wörterbüchern erweitert.
Er beinhaltet nun auch Fortschritt, Nutznießung der Technologie
und Wohlstand. In den Diskussionen unter den osmanischen Intellektuellen
über die Zivilisation verlangt man zu jener Zeit die Förderung
der Wissenschaften, Säkularisation, Förderung des Lesens
und Schreibens, Menschenrechte, juristische Entwicklung, Modernisierung
der Institutionen u.ä.
Die schriftliche Bekanntgabe des Sultans, die "Tanzimat Fermani"
heißt und einer Epoche den Namen "Tanzimat Dönemi"
(die Zeit der Ordnung) gegeben hat, ist eigentlich die offizielle
Bestätigung der Annahme der westlichen Zivilisation, die
unter den türkischen Intellektuellen als Fortschritt in der
Wissenschaft, Entwicklung der Städte, Entwicklung der Industrie,
Blüte der Wirtschaft und das durch all diese Faktoren entstandene
hohe Lebensniveau verstanden wurde. Zu all diesen Umständen
gehörten natürlich noch die feinen menschlichen Beziehungen.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. Jahrhunderts
beteiligten sich auch die Sozialwissenschaftler an der Zivilisationsdiskussion.
Interessante Fragen tauchten auf. Zum Beispiel: Ist die europäische
Zivilisation einzigartig in der Weltgeschichte oder gibt es andere
Zivilisationen? Gibt es zwei unterschiedliche Zivilisationskreise
- der westliche und der östliche? Kann man den Osten als
einen einheitlichen Zivilisationskreis betrachten? Weisen der
Mittelmeerkreis, Europa und der Nahe Osten nicht dieselben Quellen
der Zivilisation auf? Nehmen die Türken, die lange sowohl
in Asien als auch in Europa lebten, eine besondere Stellung ein?
Was würden die Türken, die Muslime sind, in einer westlichen
Zivilisation machen, die tief von der christlichen Kultur geprägt
ist? Diese und ähnliche Fragen wurden lange diskutiert und
bilden heute noch wichtige Diskussionsthemen.
Schon am Ende des19. Jahrhunderts entstanden durch die Zivilisationsfrage
einige unterschiedliche Richtungen. Die erste Reaktion kam von
denjenigen Intellektuellen, die das osmanische Reich aufrechterhalten
wollten. Die Linie, die sie verfolgten, wurde "Osmanlicilik"
genannt. Das könnte vielleicht mit Ottomaniedentum übersetzt
werden. Im Grunde genommen stellte das eine Selbstverteidigungsreaktion
des Reiches dar. Die ersten Vertreter der Verwestlichung traten
zugleich für diese Richtung ein. Sie wollten das Osmanentum
den nationalistischen Strömungen Europas gegenüberstellen.
Sie betrachteten die abendländische Zivilisation als Fortschritt
in der Wissenschaft, Technologie und als die Steigerung des Lebensstandards
in jeder Hinsicht. Sie glaubten, daß man das alles auch
im osmanischen Reich verwirklichen könnte. Um diese Ziele
zu erreichen, versuchten sie, den Staat und das Erziehungswesen
zu reformieren. Die Gesetze wurden geändert und die Begründung
der konstitutionellen Monarchie versucht. Man bemühte sich
darum, den osmanischen Menschen zu schaffen und die Industrie
zu modernisieren. Der Balkankrieg am Anfang des 20. Jahrhunderts
setzte jedoch den osmanistischen Ideen ein Ende.
"Islamcilik" (d.h.Islamismus) ist eine wichtige Ideologie,
die unter dem Einfluß der abendländischen Zivilisation
als Reaktion gegen diese Zivilisation entstand. Diese Ideologie
tauchte ziemlich früh auf, aber entwickelte sich erst in
den Anfängen des 20. Jahrhunderts und bewahrte ihre Existenz
bis zum heutigen Tag. Den wichtigsten Ideen der Islamisten im
19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts zufolge ging die europäische
Zivilisation auf den Rest der Welt erbarmungslos, gefühllos
und verständnislos los, ohne den Anderen das Recht, wie ein
Mensch zu leben, zuzuerkennen. Die Abendländer waren längst
mit ihrer Wissenschaft und Technologie überlegener als die
islamische Welt geworden. Die meisten islamischen Länder
wurden kolonisiert und stöhnten unter dem abendländischen
Joch. Das so empfindliche Herz des Abendländers überhört
die Schmerzensschreie der islamischen Völker. Die Kinder
der muslimischen Mütter werden in Kriege geschleppt, die
sie überhaupt nichts angehen. Das osmanische Reich befindet
sich in einer schrecklichen Lage. Alles Schöne, was zur alten
Kultur gehörte, verschwindet. Eine degenerierte Verwestlichung
überwältigt die Intellektuellen. Man übernimmt
aus dem Westen nicht das Gute, sondern nur das Böse. Die
Japaner dagegen werden ein Musterbeispiel für die Beziehungen
zur abendländischen Zivilisation. Sie bewahren ihre eigene
Tradition und übernehmen vom Westen nur die Wissenschaft
und Technologie. Aus diesem Grunde haben sie eine Zukunft.
Die Lösungen, die von den Islamisten vorgeschlagen wurden,
können wir auf folgende Weise in verkürzter Form zusammenfassen:
Man muß sich aus den Krallen des Westens retten. Die islamische
Einheit ist nötig. Man muß den Geist der goldenen Zeit
Muhammeds wieder finden und mit diesem Geist an die zeitgenössischen
Probleme herangehen. Aus der abendländischen Zivilisation
können Wissenschaft, Technologie, Arbeitsmoral u.ä.
übernommen werden. Es darf aber nicht vergessen werden, daß
es eine islamische Zivilisation gibt, die viele schöne Seiten
innehat. Menschenliebe, Respekt vor den Menschenrechten, Gerechtigkeit,
Klassenlosigkeit, religiöses Leben ohne Klerus, Solidarität
der Menschen ohne auf Rasse und Religion zu achten bilden die
Merkmale dieser Zivilisation. Natürlich auch die Kunst, die
aus dem Geist dieser Zivilisation entsteht, und die damalige Blüte
der Wissenschaft gehören dazu. Also nur eine Synthese mit
der abendländischen Zivilisation in diesem Sinne wird genügen.
Die islamische Ideologie hat sich in den letzten Jahrzehnten vervielfältigt,
und verzweigt, aber der leitende Gedanke, den Islam zu bewahren
und nur das Gute von der abendländischen Zivilisation zu
nehmen, ändert sich nicht sehr.
Eine der wichtigsten Strömungen, die nach der Begegnung mit
der abendländischen Zivilisation auf die Bühne trat,
ist "Türkcülük" ( d.h. Türkismus).
Erst erschien diese Ideologie als eine pantürkistische, sogar
als eine rassistische. Aber in kurzer Zeit verwandelte sie sich
zu einem kulturellen sprachlichen Nationalismus. Die türkische
Republik entwickelte hauptsächlich aus den Ideen Ziya Gökalps
( gest. 1924) ein Programm, dessen Ziel es war, durch die Sprache,
Kultur, soziale Ordnung eine Nation zu bilden, die auch zur abendländischen
Zivilisation gehörte. Die Republik versuchte mit dem Eingriff
in das Recht, in die Moral, in die Kultur, in die Schrift und
sogar in das alltägliche Leben die abendländische Zivilisation
einzuführen.
Seit den Anfängen des 20. Jahrhunderts entwickelten die Anhänger
des Türkismus einige Thesen über die Zivilisation. Die
eine unter ihnen ist die These von einer Zivilisation der Steppe.
Diese These stammt hauptsächlich von den ungarischen und
russischen Wissenschaftlern. Nach dieser Auffassung konnten die
Stämme, die in Asien und Eurasien in den Steppen und Ebenen
Pferde und andere Tiere wie Rinder und Schafe züchteten und
deren Produkte bearbeiteten, die Fähigkeiten entwickeln und
Erfahrungen sammeln, um Staaten zu begründen und zu verwalten.
Nur dadurch, daß sie sich mit den Ansässigen vermischten,
konnten große Staaten und Reiche entstehen. Die Türken
gehörten zu diesen Stämmen und hatten früh die
Begriffe wie "il" (d.h. Land) und "töre"
(d.h. Brauch, Ordnung, Gesetz) "budun" (d.h. Volk) und
"Hakan" (d.h. Fürst), der vor Gott für das
"Volk" verantwortlich ist, entwickelt. Aus diesem Konzept
konnte eine Hierarchie und auch der Begriff des Staates leicht
entstehen. Diese Zivilisation hatte in der Schmiedekunst, Lederbearbeitung,
Webekunst sowie in der Bearbeitung der Produkte der Tiere wichtige
Fortschritte gemacht. Sie konnten sogar wie bei den Köktürken
ihren Nachfolgern aus dem 8. Jahrhundert eine schriftliche Kultur
hinterlassen.
Eine andere These unter den Anhängern des Türkismus
lehnt diese Betrachtungsweise der Geschichte ab: Sie meint, daß
die Urheimat der Türken nicht die Steppe sei. Obwohl sie
sich hauptsächlich mit der Tierzucht beschäftigt haben,
lebten sie im Winter unten in den Ebenen. Die Orte, in denen sie
überwinterten, nannten sie "kislik". Im Sommer
zogen sie oft in die höher liegenden Gebiete der bergigen
Gegenden, die sie "yayla" nannten. Die meisten Türken
hatten Kontakt mit den benachbarten Zivilisationen und begründeten
während der ganzen Geschichte mehrmals wichtige und große
Staaten. Die Türken lebten seit über tausend Jahren
in Städten, die auch geschichtlich bekannt sind. Davor führten
sie ein halbnomadisches Leben oder lebten oft mit den Ansässigen
in einem Staat zusammen.
Wie dem auch sei, sind die Hauptideen dieser Auffassungen ähnlich.
Es heißt, daß die Türken eine lange Vergangenheit
und eine wichtige Kultur hatten. Jedesmal bildeten sie, wenn sie
mit einer fremden Zivilisation in Kontakt traten, ihre eigene
Synthese. Der Eintritt in den Islam und die Verwestlichung werden
als die wichtigsten Zivilisationsänderungen eingeschätzt.
Sie betonen, daß das Allerwichtigste bei der Verwestlichung
die Bewahrung des eigenen Kulturgutes sei. Man sollte vom Westen
die Wissenschaft, Technologie und alle schönen Seiten übernehmen.
Bei dem kulturellen Einfluß des Abendlandes solle man aufpassen,
daß man die eigene Identität nicht verliert.
Eine andere wichtige Haltung zur abendländischen Zivilisation
nimmt die türkische Linke ein. Die türkischen Linken
betrachten alle Variationen der abendländischen Zivilisation
mit Skepsis. Sie verachten sie als einen imperialistischen Ausnutzer
der Arbeit und der armen Völker. Sie träumen von einer
Welt in der die Technologie und der Wohlstand auf dem Gipfel stehen,
und in der es keine Unterdrückung und Ausnutzung gibt.
Wir können außerdem noch eine andere Seite von Anhängern
der westlichen Zivilisation unter den Türken nennen. Diese
kümmern sich nicht um Ideologien, bewundern die westliche
Zivilisation und versuchen die Abendländer in jeder Hinsicht
zu imitieren. Für sie ist die Zivilisation eine Lebensweise,
die sie auch gerne hätten, aber nur sehr oberflächlich
verstehen.
So ungefähr sehen die Gedankenverbindungen aus, die mit dem
Begriff Zivilisation bei den türkischen Intellektuellen ins
Gedächtnis gerufen werden. Natürlich sind hier alle
Ideologien und Auffassungen zusammengefaßt und sehr vereinfacht
dargestellt. Wir dürfen nicht vergessen, daß in der
Türkei über diese Themen seit über 150 Jahren diskutiert
wird. In der letzten Zeit wird die Sache noch schwieriger, denn
in allen Richtungen tauchen revidierte, ineinander geflochtene
und völlig neue Ideen und Gruppen auf, deren Schilderung
den Rahmen dieses Vortrages sprengen würde.
© INST: Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse, 2000 |