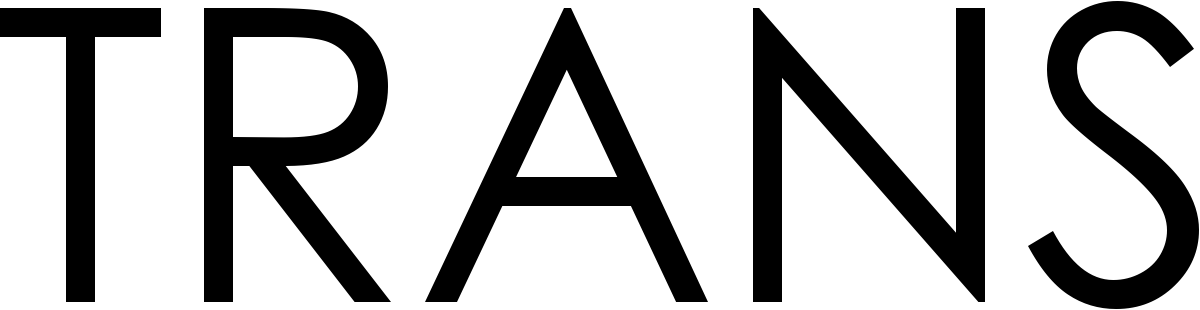Nr. 18 Juni 2011 TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften
„Manchmal allein gegen Krieg“
Angelika Schrobsdorffs literarisches Schaffen
Anatol Michajlow (Universität Gdansk, Polen) [BIO]
Email: colon2@interia.pl
Konferenzdokumentation | Conference publication
Einleitend möchte ich erwähnen, dass ich schon vor längerem geplant hatte, diesen Beitrag zu schreiben. Aber erst nach dem kritischen Besprechen der Ur-Variante mit der Schriftstellerin am 29. Juli 2010, als ich verpflichtet wurde, „das Thema nicht breitzutreten“(1), nahm er die endgültige Form an.
Angelika Schrobsdorff, eine der letzten Schriftstellerinnen, die die NS-Herrschaft und den Holocaust miterlebt haben, wurde durch diese Erlebnisse entscheidend als Mensch geformt. Sie musste Berlin verlassen, um ihr Leben zu retten – eine Stadt, in der sie „alles besessen hatte und alles verloren“(2). Bis heute prägt dies ihr ganzes Wesen. Sie war auch Zeugin des palästinensisch-israelischen Konflikts, erlebte die Gewaltwellen der Intifada in Jerusalem, wo sie sich von ihren Ängsten befreien konnte und sich neu zu verwurzeln hoffte(3), wo sie tatsächlich für eine längere Zeit eine neue Heimat fand, die kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem aufmerksamen Blick einer Humanistin im aufklärerischen Sinne des Wortes verfolgend. Die Schriftstellerin geht stets von der Frage „warum?“(4) aus, wenn sie über die Kontroversen und Konflikte schreibt. Diese Arbeitsweise(5) verursacht, dass sie immer diese Frage stellt, indem sie die Wirklichkeit literarisch erfasst, die Tatsachen darstellt und das Geschehen analysiert. Die Autorin reißt das menschliche Leben nicht aus der Umwelt heraus, sondern sieht den Menschen als einen Bestandteil der Umwelt und betrachtet dann diese Umwelt als etwas Lebendiges(6), als ein Etwas, was mit unsichtbaren Fäden mit der menschlichen Existenz verbunden ist. Der Mensch existiert folglich in einer organischen Gemeinschaft mit der humanen und dinglichen Umgebung. Die Schriftstellerin betrachtet die ganze Menschheit auf diese Weise und lehnt die Versuche jeder Teilung von der Menschheit grundsätzlich ab, die eine andere Begründung haben könne, als die gegenseitige humane Behandlung. Selbst, als ihre Schwester Bettina sich auf eine unvernünftige Weise zum Thema „Gelbe Gefahr“ äußert, entgegnet Angelika: „Willst du vielleicht behaupten, die weiße Rasse mordet humaner als die schwarze oder gelbe? Du solltest dich etwas besser informieren, wenn du’s bis jetzt noch nicht gelernt hast.“(7)
Sich selbst bezeichnet die Schriftstellerin entschieden als „Tochter Israels“. Diese Selbstidentifizierung ist in ihrem Innern tief und fest verwurzelt, ist etwas Positives und Wertvolles, das sogar Glück an und für sich bedeutet. Denn nirgendwo fand Angelika so viel Geborgenheit und Vertrautheit als in Israel(8), vergleichbar allein mit dem Glücksgefühl, das die Autorin als Kind bei ihren jüdischen Großeltern Kürschner verspürte.(9) Sie empfindet überhaupt die ganze Zeit ihres reifen Lebens eine tiefe Liebe für ihr Volk – und verbindet diese Liebe mit Objektivismus (bei den Beschreibungen des Konflikts) und Pessimismus – bezogen auf die ganze Menschheit, denn die Schriftstellerin bezweifelt die Existenz von Vernunft bei den breiten Massen oder vielleicht bei dem Menschen in allgemeinen(10). Man muss wohl zuerst diese grenzenlose Liebe zur Heimat unterstreichen, um ihre – manchmal bitteren und kontroversen – Urteile objektiv einzuschätzen. Das Rechavia-Viertel in Jerusalem hat der Autorin ihren Geburtsort – Berlin-Grunewald – völlig ersetzt, „[…] lange bevor ich mich dort niederließ […].“(11) Und obwohl Angelika Schrobsdorff dort auch Angst und Zerrissenheit wegen der Intifada verspürte, war Jerusalem – wie sie bekennt – „mein erstes wahrhaftiges Zuhause, seit ich als Kind Berlin hatte verlassen müsse.“(12) Von ihren persönlichen Erfahrungen ausgehend, versucht Angelika Schrobsdorff die Schwächen beider Seiten im destruktiven palästinensisch-israelischen Konflikt darzustellen, um seine Überwindung oder mindestens seine Milderung zu erreichen. So müssen sich ihr zufolge die christlichen Touristen in Jerusalem vom religiösen Wahn, die Israelis vom Größenwahn und die Palästinenser vom Verfolgungswahn befreien.(13) Die Schriftstellerin sieht die schwierige Lage von Menschen, die sich auf beiden verfeindeten Seiten nach Frieden sehnen.(14) Dabei hebt sie die eigene Situation hervor; schon 1998 muss sie mit ansehen, wie die Konfliktparteien auf eine zunehmende Brutalisierung und Hass(15) zusteuern. Die Autorin dämonisiert niemanden, sie macht aus niemandem ein eigenartiges, böswilliges Wesen, sie legt nur den Anführern des Konflikts, die falsche Entscheidungen treffen, Misstrauen und Hass schüren, die Verantwortung für die fatale Entwicklung zur Last: „[…] falsch sind allein die Monster, die Länder, Zeiten und Menschen wie uns ihren blutigen Stempel aufzudrücken versuchen.“(16) Die Teilung nach dem einfachsten Muster – in Mächtigen und Ohnmächtigen – sei wohl – aus der Sicht des Verfassers – eine künstlerische Vereinfachung oder Übertreibung, sagt aber viel über das schwierige Leben der sensiblen Menschen, die sich den politischen Spielen ausgeliefert fühlen.(17) Die Autorin verzeichnet auch die Existenz von destruktiven Faktoren in den breiten Volksmassen, mit denen die Machträger identisch sind und die eine kaum erfreuliche Nebengattung bilden. Das sind vor allem Intoleranz, Fanatismus, Extremismus und Nationalismus.(18)
Die Masse der gleichgültigen Beobachter ist in dieser Situation mindestens mitschuldig, denn sie nimmt alles ohne jegliche Reflektion hin, ja verlangt sogar nach neuen „Reizen“. Die Schriftstellerin stellt nüchtern fest: „Wir haben einen so ungeheuren Katastrophenkonsum, dass jede neue willkommen ist….“(19) Der Mensch konsumiert die Tragödien, ohne sie innerlich mitzuerleben; er verdrängt sie, versucht das Geschehene zu rationalisieren, zu rechtfertigen und das Grausame als etwas Akzeptables (weil auf Fremde bezogen) zu betrachten. Und diese Heuchelei und die Fähigkeit, sich selbst irrezuführen und zu belügen kritisiert die Schriftstellerin,(20) denn sie bemerkt, dass die Selbstrechtfertigung, die Zurückweisung eigener Schuld und die Verharmlosung der Schandtaten die ganze Menschheit und einzelne Menschen zu noch schrecklicheren Erfahrungen führen. Sie fragt deshalb rhetorisch: „Oder findest du, dass der Holocaust, der zu einer Massenproduktion verballhornt wurde, zu Moral und Aufklärung der Menschheit beigetragen hat?“(21) Die Autorin stellt also fest, dass die Menschen von sich selbst aus nie etwas aus der Geschichte lernen und auch nie etwas daraus lernen werden.(22)
Deshalb sind die Anmerkungen der Schriftstellerin so wertvoll, als sie über die Konfliktproblematik schreibt, die zu einem dauernden Krieg zwischen Palästinensern und Israelis führt. Die aggressiven Handlungen beider Völker, was beide Konfliktseiten mit unbeirrbarem Willen tun, charakterisiert Angelika Schrobsdorff als „kollektive[n] Selbstmord“,(23) wobei beide Völker dem Hass, Vergeltung und Zerstörung anheim fallen.(24) Angelika Schrobsdorff behauptet, dass die Kriege nicht abschreckend genug auf die Menschen wirken, mehr noch – der Krieg fasziniert, gibt den Menschen etwas ungewöhnliches, hilft auf eine rein schopenhauerische Weise Langeweile zu überwinden. Die gefährliche Zuspitzung der Emotionen und der Nervenkitzel führen die Betroffenen auf Irrwege: „So was gibt allem einen Reiz, sogar einer ausgelaugten Ehe, macht aus unbrauchbaren Kindern und kümmerlichen Männern Helden, aus ewig kränkelnden jammernden Frauen tapfere, klaglose Gefährtinnen, aus Fremden Brüder und aus einem Stück Brot Kuchen.“(25) Die Faszination durch den Schrecken wird dann zum Zweck und Ziel, und falls der Mensch dabei noch auf eine unvernünftige – wohl angeborene biologische Weise(26) – auf alles Fremde mit Abneigung oder sogar Aggression reagiert, geschieht etwas Böses, wobei es dann sehr oft kein Zurück mehr gibt.
Eine solche Fragestellung geht tief in die kriegerische Problematik hinein, denn die Autorin vermutet zu Recht, dass ohne Gegenwirkung der Vernunft, ohne aktive Abwehrposition der Menschen in allen Angelegenheiten des Friedenserhaltens, die Situation – und nicht allein in Palästina und Israel – immer schlechter und hoffnungsloser wird. Keinesfalls dürfen die Menschen warten, bis die Ereignisse eigene Dynamik entfalten und die Teilnehmer mit sich reißen. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen sind manchmal von unterschiedlichem Ausmaß, jedoch darf der vernünftige, aufklärerische Mensch nicht zulassen, dass sie die Bestialität der Nazizeit erreichen.(27) Die erfolgreiche Gegenwirkung ist demzufolge ohne Analyse, ohne genaue Erforschung unmöglich; hiervon ausgehend bringt die Autorin manche Mechanismen des Konflikts ans Licht und ihre Offenheit und Ehrlichkeit helfen ihr sofort, eine beinahe philosophische Darstellung der phänomenalen Erscheinung der verkehrten Toleranz zu liefern. Bei allen kriegerischen Handlungen lassen sich Menschen töten, verstümmeln einander auf ausgesuchteste Art und Weise, was eigentlich jeden geistig gesunden Menschen zum Nachdenken bringen solle. Das ist aber nie der Fall. Vielleicht handeln in diesem konkreten Konflikt die Palästinenser aus Hoffnungslosigkeit, Ehrgefühl, Überzeugung und die Israelis aus Pflichtgefühl und Gedankenlosigkeit, wie das die Schriftstellerin schildert.(28) In jedem Fall scheint die komplexe Betrachtung der problematischen Aspekte der Koexistenz mehr als empfehlenswert.
Die Schriftstellerin vermittelt vor allem Bilder von der unverschuldeten, immanenten menschlichen Ignoranz, die selbst den vernünftigen Menschen daran hindert, die wahre Lage der Dinge angemessen zu erfassen und zu beurteilen. Angelika Schrobsdorff erzählt offen: „Zwanzig Jahre hatte ich nicht einmal gewusst, wo sich die Lager befanden, wie viele es waren, wie hoch die Zahl der Flüchtlinge war, die darin lebten, existierten, vegetierten.“(29) Die scheinbar banalste Feststellung wird auf diese Weise brillant artikuliert – homo sapiens ist nicht im Stande selbst das Offensichtliche zu sehen, falls den Menschen dazu der feine humane Wahrnehmungsapparat fehlt.
Auch die Bilder voneinander sind in jedem Konflikt gleich negativ und diese Tatsache beeinflusst zusätzlich negativ die Koexistenz, ebenfalls nicht nur im palästinensisch-israelischen Konflikt. Angelika Schrobsdorff vermittelt folgende Arten der gegenseitigen Wahrnehmung: Man sieht das Bild „der“ Palästinenser in ihren eigenen Augen und in den Augen von Juden, wie auch das Bild „der“ Juden in den Augen von Palästinensern. Die Autorin bringt eher absichtlich nicht das Selbstbild der Israelis zum Ausdruck, um zu subjektive Urteile zu vermeiden.(30)
Die Palästinenser charakterisieren vor allem ihre eigene Staatsführung als „einen Haufen korrupter, inkompetenten Kerle“(31). Die palästinensische Selbstkritik geht aber noch weiter: „Wir wollen unbedingt einen Staat und können nicht einmal Ordnung in einem Dorf machen. Es gibt fünfzehn arabische Staaten und keiner taugt was.“(32) Diese Menschen brauchen praktische Hilfe beim Aufbau einer effizienten Verwaltung. Sie brauchen Anerkennung ihrer menschlichen Würde und sie brauchen dringend eine permanente und konsequente Aufklärungsarbeit. Es gibt aber stattdessen eine andere, brutale Wirklichkeit, in der die andere Seite des Konflikts alle Probleme mit Gewalt lösen will. Es wird jedoch etwas anderes erreicht, nämlich ein Zustand der allgemeinen Verwilderung.(33) In der Situation, in der eine Seite mit dem Rücken zur Wand steht, ist allerdings jedes rationelle Verhalten ausgeschlossen. Aus der anderen Seite wird ein Gegner und später – ein Feind. Die Palästinenser werden für die Israelis zu einer gesichtslosen halbwilden Horde halbfertiger Terroristen, und die Israelis werden in den Augen ihrer Nachbarn zu einer ebenso bedrohlichen Masse.(34) Die logische Fortsetzung dieses Wahrnehmungsschemas wird von der Schriftstellerin so vermittelt: „Die Palästinenser sahen in den Israelis Monstren nazistischen Ausmaßes, die Israelis sahen in den Palästinensern eine einzige Terroristenbande. Man erzog Generationen jungen Menschen zur Verständigungslosigkeit, Hass, Brutalität.“(35) Die Palästinenser empfinden dazu noch die Haltung der Israelis ihnen gegenüber als Erniedrigung, weil kein Mensch ja wie Gesindel betrachtet werden will.(36)
Die aufklärerische Position der Schriftstellerin wird umso verständlicher, als der Leser die Empfehlungen für die Überwindung der Gewaltursachen, wenn nicht in direkter Form, so doch unmissverständlich dargestellt bekommt. Zu diesen Empfehlungen zählt vor allem anderen die Notwendigkeit, eine fremde Sprache, Religion und Kultur kennenzulernen, denn ohne dies „muss jede Beziehung rudimentär und aufgepfropft bleiben.“(37) Als ein Hindernis betrachtet Angelika Schrobsdorff die Überheblichkeit der zivilisatorisch entwickelteren, israelischen Seite „mit ihrer immensen Eitelkeit, Erfolgssucht, Angabe und Heuchelei.“(38) Diese Faktoren erschweren also bei jedem Konflikt seine Schlichtung und dauernde Lösung. Die Schriftstellerin postuliert wohl deshalb die dringende Notwendigkeit einer komplexen gegenseitigen Wahrnehmung, die radikale Absage an die Enthumanisierung des Nachbarn oder Gegners, die Vermeidung von Situationen, in denen man das fremde vergossene Blut als wertlos betrachtet.(39) Die Autorin bemerkt dabei, dass in jeder gewaltsamen Auseinandersetzung, nicht nur der Verlierer sein Leben oder etwas wertvolles verliert, sondern auch der Sieger, der demoralisiert nach Hause zurückkommt und der sich innerlich oft unheilbar verletzt fühlt.(40) Der zeitgenössische Mensch darf sich also den Weltwerdegang und die Geschehnisse als Beobachter betrachten, denn ein solcher Mensch von einer Seite ist am Tod jedes Menschen der anderen Seite(41) mitschuldig. Zusätzlich wird jeder Konflikt durch die Tatsache erschwert, dass dabei stets auch andere Kräfte im Spiel sind, die aus dem Blutvergießen ihren eigenen Nutzen ziehen. Die Schriftstellerin begrenzt ihre Betrachtungsweise also nicht allein auf den arabisch-israelischen Konflikt, sie sieht z.B. auch die Gefahren, die aus dem gefährlichen Spiel mit Terrorismus und Terroristen folgen. Man benutzt die Terroristen, um eigene politische Ziele zu erreichen, dabei wird dann alles relativiert. Man betrachtet alle Prinzipien als Ballast und als Störfaktoren. Man vernichtet den gestrigen Freund und verherrlicht den vorgestrigen Feind, weil er hier und jetzt nützlich ist.(42) Die Schriftstellerin durchschaut – dank ihrer Holocaust-Erfahrung – die noch nicht klar genug hervortretenden Zerfallserscheinungen der menschlichen Kultur und diagnostiziert sie: „Wir haben Gott, Menschenwürde und alle Gesetze des Universums mit Füßen getreten, und jetzt tanzen wir den Totentanz ums goldene Kalb.“(43) Die soziale Umwälzung allein betrachtet die Schriftstellerin als unzureichend, um Gewalt aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen, weil die Menschen oft nicht für höhere Ziele, sondern nur für ihre „persönlichen, materiellen und ideellen Ziele auf die Barrikaden“(44) gehen und logischer Weise die alte Konfliktsituation durch eine neue ersetzen, die wiederum aus der Sicht der Schrobsdorffs nur „eine Aufforderung zum Mord oder Selbstmord“(45) sei. Vielleicht deshalb ist ihre aufrichtige aufklärerische Empfehlung so wertvoll für unsere Diskussion. Um die Daseinsberechtigungen unserer Zivilisation aufrechtzuerhalten, müssen die Völker den moralischen Anstand und Instinkt für Recht und Unrecht wiederaufbauen und entwickeln.(46) Wenn die Menschen ehrlich und entschlossen in diese Richtung handeln, könnte dieses Unternehmen gelingen, andernfalls „ehe man sich’s versieht, steckt man in einem unentwirrbaren Knäuel klebriger Fäden“(47), gewoben aus den alten Vorurteilen und Stereotypen, und geht zu Grunde, indem man in Gewalt die Lösung aller Probleme sieht.
Wir können verschieden Meinungen zum Thema haben, aber grade den Vorschlag, zu der Tradition der Aufklärung zurückzukehren, darf man wohl nicht ignorieren.(48)
Anmerkungen:
1 Zitiert nach der Tonbandaufnahme des Gesprächs. Im Besitz des Verfassers. 2 Schrobsdorff A., Von der Erinnerung geweckt, in: Von der Erinnerung geweckt, München 1999, S.74. Die Autorin verglich ihr eigenes Schicksal mit dem von Zeitgenossen und verzeichnet dabei bedeutende Unterschiede: „Der Zweite Weltkrieg hatte gewiss auch ihnen Verluste jeglicher Art zugefügt, Erschütterungen und Krisen ausgelöst, und dennoch waren sie ganz geblieben oder es wieder geworden, eins mit dem Land, dem Stand, der Familie, der christlichen Religion und Tradition, in die sie hineingeboren worden waren.“ Schrobsdorff A., Wenn ich dich je vergesse, oh Jerusalem, München 2009, S.21. 3 Vgl. Filmreihen, Töchter, Talmud, Tore – 12. Jewish Film Festival Berlin α Potsdam, 2006, in: Ein Leben lang Koffer, nach: http://www.filmusem-potsdam.de/html/de/445-1517.htm (Stand vom 11.8.2010). 4 Vgl. Schrobsdorff A., im Vorwort, Von der Erinnerung geweckt, München 1999, S.8, wie auch A. Schrobsdorff, Warum?, ebenda, S.24. 5 Der Autor verzichtet bewusst auf die Erwägungen zu diesem Thema, denn diese Methode, die auf eine literarische Erfassung der Wirklichkeit zielt, impliziert zunächst die Darstellung von Tatsachen und die Analyse von Geschehnissen in ihrem lebensweltlichen Kontext. 6 So ist z.B. ein Haus imstande, etwas vom Schicksal seiner Bewohner anzunehmen. „Es lebt, es atmet, es erinnert sich, es kennt unsere Geheimnisse, unseren Schmerz, die kurzen Atempausen der Freude.“ Nach A. Schrobsdorff, Ulitza Murgasch in: Von der Erinnerung geweckt, München 1999, S.45. Diese Feststellung spielt eine bedeutende Rolle in unseren Erwägungen, denn sie akzentuiert ausdrücklich, dass man den Menschen nicht isoliert von dem Land, wo er wohnt, betrachten darf. 7 Schrobsdorff A., Trink, trink, Brüderlein trink…, in:Von der Erinnerung geweckt, München 1999, S.51. Die Schriftstellerin sieht dabei eine breite und eher gefährliche Erscheinung der Ignoranz und des Denkens in einfachsten Vorurteilskategorien bei Völkern, die weit entfernt vom Krieg in Palästina wohnen. „Araber sind große Räuber“, sagt ein Protagonist in A. Schrobsdorff Roman Grandhotel Bulgaria: Heimkehr in die Vergangenheit, München 2009, S.23. 8 Zum ersten Mal 1961 und 1963. „Wissen Sie, ich hätte nie Jerusalem verlassen und dann auch noch nach Berlin kommen dürfen.“ Zitiert nach dem Brief an den Verfasser des Beitrags vom 20.12.2010. 9 Vgl. Schrobsdorff A., Hadera, in Erzählband: Von der Erinnerung geweckt, München 1999, S.85. 10 Vgl. Schrobsdorff A., Hadera, in: Von der Erinnerung geweckt, München 1999, S.109. Dieselbe Idee finden wir bei Libbys Selbstverwirklichung, ebenda, S.120 oder Die Aktion, ebenda, S.206. 11 Schrobsdorff A., Mein Jerusalem, in: Von der Erinnerung geweckt, München 1999, S.181. Vgl. auch ebenda, S.179, 201-202. 12 Schrobsdorff A., Mein Jerusalem, in: Von der Erinnerung geweckt, München 1999, S.202. 13 Vgl. Schrobsdorff A., Die Aktion, in: Von der Erinnerung geweckt, München 1999, S.235-236. Es gibt neben der menschlichen Sympathie zu Palästinenser auch eine nüchterne und sachliche Beurteilung ihrer Lage, wo „[…] die Autonomie, zu der sie mutig beigetragen hatten, zum Verlust ihrer persönlichen Selbständigkeit [wurde].“ Schrobsdorff A., ebenda, S.230. 14 Vgl. Schrobsdorff A., Frieden, in: Von der Erinnerung geweckt, München 1999, S.238-239. 15 Über die Hassspirale sagte Manès Sperber etwas, das besonders im Fall des Teufelskreises der Gewalt im israelisch-palästinensischen Konflikt zutrifft: „Die Furcht der Verfolgten kann mit der Gefahr, die sie bedroht zunehmen oder vergehen, die beklemmende Angst der Verfolger aber bleibt unheilbar.“ Sperber M., Über den Hass, in: Dichtung aus Österreich. Prosa. 2.Teilband, Wien 1969, S. 580. 16 Schrobsdorff A., Grandhotel Bulgaria: Heimkehr in die Vergangenheit, München 2009, S.100. 17 Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.137. 18 Vgl. ebenda, S. 154, 316. Das Bedrohliche liegt dabei nicht allein in politisch oder ideologisch gefärbten Reaktionen der Masse: „Bedroht (in Berlin – A.M.) habe ich mich nur einmal gefühlt, nach dem Endspiel der Fußballmeisterschaft […] umringt von kreischenden, fahnenschwenkenden Horden. Doch die waren keine Neonazis, sonder biedere, deutsche Bürger, die ihr aufgestautes Selbstvertrauen wiedergefunden hatten.“ Es stirbt sich bequemer in Berlin, Berliner Zeitung am 24.2.2007, zit. nach: http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/bin/dump.fcgi/20, Stand vom 11.8.2010. 19 Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.194. 20 Vgl., Schrobsdorff A., Wenn ich dich je vergesse, oh Jerusalem… , München 2009, S.237, 357. Auch in: Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.109. Selbst im Sprachgebrauch hat man Hilfsmittel entdeckt, um das menschliche Gewissen zu beruhigen, wie z.B. im Fall der Wendung „unschädlich machen“, also eine umschreibende mildere Gattung der Terminologie des Hasses erfunden. Vgl., Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.26. 21 Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.109. 22 Vgl. Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.187. Die Autorin spricht sich deshalb entschieden gegen einen Missbrauch von Bildern Verstorbener oder Ermordeter „zu didaktischen Zwecken“ aus, denn dadurch entwürdige man die toten Menschen, ohne das jemandem genützt würde. „Er war ein Mensch und hat das Recht, als solcher wenigstens gewürdigt zu werden, dass man ihn nicht als dieses unfassbare Schreckgespenst dem Blick der Welt preisgibt.“ Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.268. 23 Schrobsdorff A., Wenn ich dich je vergesse, oh Jerusalem… , München 2009, S.306. 24 Vgl. ebenda, S.348. 25 Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.263. 26 Die Schriftstellerin vergleicht diese Erscheinung mit einer Szene in Jerusalem, in der Spatzen ihren „Artverwandten“ regelrecht diskriminierten und verfolgten. Die Autorin stellt also die Frage an Leser: „warum wurde dieser Spatz nicht akzeptiert? Kam er aus einem anderen sozialen Mileau, einer anderen Kultur, Religion, Rasse?“ Ebenda, S.201. 27 Vgl. Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.294. Dies widerspricht eindeutig dem Konzept des vernunftgeleiteten Menschen aus der Aufklärung, der gewaltsame Auseinandersetzungen nicht auf sich zukommen ließ, sondern sie sorgfältig ab- und einzuschätzen trachtete. 28 Vgl. Schrobsdorff A., Wenn ich dich je vergesse, oh Jerusalem… , München 2009, S.304. Man darf wohl behaupten, dass das Gesagte per analogiam alle ähnlichen Situationen – so auch beide Seiten des Konflikts – betrifft. 29 Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.92. Vgl. auch Schrobsdorff A., Wenn ich dich je vergesse, oh Jerusalem… , München 2009, S.158. 30 Denn die Frage ist umfangreich, sie betrifft das Problem der Selbstidentifizierung von Menschen und erfordert weitere Forschungen, die die Grenzen dieses Beitrags überschreiten. Selbst die Beantwortung der Frage – „Was heißt, sich jüdisch fühlen?“ ist für die Schriftstellerin unmöglich; sie reagiert mit weiteren Fragen darauf: „Sei das ein physischer Zustand, ein intellektueller Willensakt oder eine Eingebung aus höherer Instanz?“ Schrobsdorff A., Die kurze Stunde zwischen Tag und Nacht, München 2004, S.203. 31 Schrobsdorff A., Wenn ich dich je vergesse, oh Jerusalem… , München 2009, S.67. Vgl. auch ebenda, S. 351. 32 Ebenda, S. 230. 33 Vgl., ebenda, S. 131-132. Gemeint dabei sind wohl vor allem die radikalen Israelis und die radikalen Islamisten. Die Schriftstellerin macht uns aber auf die steigende Neigung, Gewalt zu verwenden, aufmerksam. 34 Vgl. Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.130. 35 Ebenda, S.221. 36 Vgl. ebenda, S. 304. 37 Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.40. 38 Ebenda, S. 317. 39 Vgl. Schrobsdorff A., Wenn ich dich je vergesse, oh Jerusalem… , München 2009, S.141, 369. 40 Vgl. Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.190. Auch Schrobsdorff A., Wenn ich dich je vergesse, oh Jerusalem… , München 2009, S.313. 41 Vgl. Schrobsdorff A., Wenn ich dich je vergesse, oh Jerusalem… , München 2009, S.313. Es fehlt auch nicht an Selbstkritik, denn die Autorin bemerkt diese Neigung, diese rein beobachtende Lebensposition auch bei sich selbst. Vgl. Schrobsdorff A., Jerusalem war immer eine schwere Adresse, München 2008, S.253. 42 Vgl. Schrobsdorff A., Wenn ich dich je vergesse, oh Jerusalem… , München 2009, S.381. 43 Ebenda, S.315. An sich besteht automatisch eher keine Kausalitätsverbindung zwischen schrecklichen Erlebnissen und schöpferischen Befähigungen, denn die ersten vernichten auch die Überlebenden innerlich; aber der Verfasser teilt die Meinung, dass die Erfahrung der Verfolgung und drohender Vernichtung zur Reflexionen und zum Bedürfnis führt, diese für den Frieden fruchtbar zu machen. 44 Schrobsdorff A., Grandhotel Bulgaria: Heimkehr in die Vergangenheit, München 2009, S.186. 45 Schrobsdorff A., Grandhotel Bulgaria: Heimkehr in die Vergangenheit, München 2009, S.213. 46 Vgl. Schrobsdorff A., Wenn ich dich je vergesse, oh Jerusalem… , München 2009, S.310. 47 Schrobsdorff A., Der Geliebte, München 2005, S.330. 48 „Man muss nur mit Menschen viel Zeit und Geduld haben und nie bei dieser Arbeit nachlassen.“ A. Schrobsdorff am 7.4.2010 im Gespräch mit dem Verfasser. Tonbandaufnahme in Besitz des Verfassers.
Inhalt | Table of Contents Nr. 18
For quotation purposes:
Anatol Michajlow: „Manchmal allein gegen Krieg“. Angelika Schrobsdorffs literarisches Schaffen –
In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 18/2011.
WWW: http://www.inst.at/trans/18Nr/II-15/michajlow18.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2011-07-11