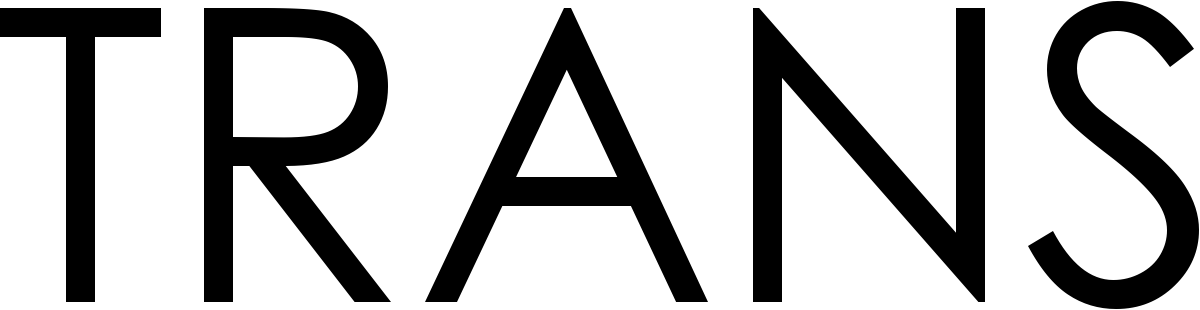István Ágoston Simon
(Westungarische Universität Benedek Elek Pädagogische Fakultät Sopron, Ungarn) [Bio]
Email: simon.istvan@bepf.hu
Die beschleunigte Lebensweise, die hohen Anforderungen in der Schule, die wenig Bewegung beeinflussen den Gesundheitszustand der Jugendlichen negativ.
Die negativen Prozesse werten die präventiven, rehabilitativen Tätigkeiten auf, deren Begriff in den mitteleuropäischen Ländern unterschiedlich definiert wird. Die gegenständlichen und persönlichen Bedingungen der adaptiven Körpererziehung weisen auch große Unterschiede in den Ländern der Region auf, die deren Wirksamkeit in großem Maße beeinflussen.
Im Vortrag wird der Begriff der adaptiven Körpererziehung geklärt und die objektiven und persönlichen Bedingungen, pädagogischen Faktoren vorgestellt, die zum erfolgreichen Unterricht der adaptiven Körpererziehung unentbehrlich sind, bzw. die auf diesem Gebiet existierenden Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der mitteuropäischen Region werden auch dargestellt.
Einleitung
Angesichts der großen Zahl der Kinder, die in den Wartezimmern der orthopädischen und pulmologischen Arztpraxen in den Krankenhäusern auf ihre Behandlung warten, und der großen Zahl der Kinder, die auf Chips und Cola aufwachsen, sind die Daten über den Gesundheitszustand der Schüler, die uns ein nicht gerade positives Zukunftsbild zeigen, keinesfalls überraschend. Jeder achte ungarische Schüler im Lebensalter zwischen 6-18 Jahren hat Haltungsfehler und jeder achte leidet an Scoliosis (Valek, 2008). Maßgebenden Erhebungen zufolge leiden 2 – 2,5 % derselben Generation an Asthma (Kádár, 2006), aber zusammen mit anderen Allergiekrankheiten kann sich die Prozentzahl sogar auf 20% belaufen (TSZK (=Fachkollegium für Lungenheilkunde), 2002), der Anteil der Übergewichtigen und Fettleibigen beträgt sogar 20 – 30 %. Die Sachlage ist leider in Europa und auch in anderen Gegenden der Welt nicht günstiger. (European Health for all Database, 2008; Bloom & Cohen, 2007; Akinbami, 2006; Grivas & al., 2006) Durch die eben angeführten negativen Prozesse wurde die Rolle der Präventiv- und Rehabilitationstätigkeiten aufgewertet, unter ihnen auch die der adaptiven Körpererziehung, deren Begriff allerdings in den mitteleuropäischen Ländern verschiedenartig interpretiert wird. Ein Grund für die unterschiedliche Auslegung könnte sein, dass die integrierte schulische Rehabilitation von Kindern mit Erkrankungen an Bewegungs- und inneren Organen in Ungarn, als alleinigem Land in der Region, schon ab 1915 als eine dem Unterrichtswesen zugewiesene Tätigkeit ausgeführt wird. Dem gegenüber wird die Rehabilitation von Kindern mit Erkrankungen an Bewegungs- und inneren Organen in den benachbarten Ländern vom Gesundheitswesen, in Form von Heilgymnastik in Krankenhäusern vorgenommen. In Europa, darunter auch in den mitteleuropäischen Ländern, wird der Begriff der adaptiven Körpererziehung eingeschränkt, in erster Linie als Feld für das Körpertraining und die Rehabilitation der Behinderten, quasi als Synonym für „adapted physical activity“ benutzt. (Winnick, 2005; Hutzler und Sherrill, 2007; Divišová et al., 2007; Stanescu et al., 2007). Es stellt sich die Frage, ob adaptive physische Aktivität und adaptive Körpererziehung tatsächlich dieselben Zielsetzungen haben und ob die gleichen Tätigkeiten damit gemeint sind. Eine Antwort ergibt sich nur, wenn man diese Begriffe einheitlich interpretiert. Hat man die Einheit der EU vor Augen, ist es wichtig, dass alle Fachleute, die auf diesem Gebiet arbeiten, eine einheitliche Sprache sprechen. Um Prävention und Rehabilitation effizienter zu machen ist es notwendig, all jene Bereiche zu erforschen, in denen sich die Länder der Region behilflich sein können. Für eine kooperative Zusammenarbeit muss man in erster Linie in Erfahrung bringen, über welche personelle und sachliche Basis die mitteleuropäischen Länder verfügen. In unserer Studie machen wir den Versuch, den Begriff „adaptive Körpererziehung“ einheitlich, vom Begriff der „adaptiven physischen Aktivität“ deutlich abgegrenzt zu interpretieren; bzw. es soll vorgeführt werden, welche personellen und sachlichen Bedingungen und pädagogischen Faktoren unentbehrlich sind, um die adaptive Körpererziehung erfolgreich in den Unterricht einzubringen; bzw. es werden die auf diesem Gebiet konstatierten Unterschiede und Gemeinsamkeiten der mitteleuropäischen Region erörtert.
Der Begriff der adaptiven Körpererziehung
Die im Ausland gebrauchte Interpretation des Begriffes unterscheidet sich von der in Ungarn gebräuchlichen. Beim Studieren der europäischen Fachliteratur kann festgestellt werden, dass unter adaptiver Körpererziehung (adapted physical education, APE) in erster Linie das Körpertraining der Behinderten verstanden und der Begriff oft als Synonym zur adaptiven physischen Aktivität (adapted physical activity, APA) gebraucht wird (Winnick, 2005; Hutzler und Sherrill, 2007). Dies ist unangebracht, da die adaptive physische Aktivität (APA) jene Art von Bewegungsformen, physischer Aktivität und Sport bezeichnet, wo der Hauptakzent auf Interessen und Fähigkeiten solcher Menschen gesetzt wird, die über begrenzte Fähigkeiten verfügen, wie Bewegungsbehinderte, Gesundheitsgeschädigte oder ältere Leute (IFAPA 1989). Der Begriff beinhaltet nicht nur die organisierten, regelmäßigen Körpertrainingsformen, sondern alle Bewegungsarten, die dazu beitragen, die physische Aktionsfähigkeit von Leuten mit begrenzten Fähigkeiten zu steigern. APA ist die Gesamtheit jener Tätigkeiten, die zur Schaffung der Möglichkeit einer qualitativen Lebensführung und der Chancengleichheit der betroffenen Population dienen. Zu diesen Tätigkeiten gehört auch die adaptive Körpererziehung (APE), welche jene Präventiv- und Rehabilitationsmaßnahmen beinhaltet, die in institutionalisiertem Rahmen erfolgen. APE wird in Europa und darunter auch in Mitteleuropa hauptsächlich als Begriff für die Rehabilitationsformen der Behinderten gebraucht, in vielen Fällen auf das Körpertraining der betroffenen Population beschränkt. In Ungarn wird APE in erweitertem Sinn verwendet, der Begriff beinhaltet sowohl die Rehabilitation der Behinderten, als auch jene von Erkrankungen an Bewegungs- und inneren Organen durch Bewegungstherapie. Aufgrund dessen ist es verständlich, dass wir uns bei der Begriffsbestimmung für APE statt der ausländischen eher auf die ungarische Fachliteratur stützen.
Punyi (1959) bezeichnet die adaptive Körpererziehung als einen Unterrichts- und Erziehungsprozess, der seine Wirkung bei der Vorbeugung und der Heilung von Krankheiten ausübt. Laut Nemessúri (1965) ist die adaptive Körpererziehung jener Wissenschaftszweig, der mit Anwendung der Methoden der Körpererziehung fähig ist Krankheiten vorzubeugen und sie zu heilen (Übersetzung von dem Author). Die bisher am ehesten zeitgemäße Definition stammt von Gárdos und Mónus (1991): Die adaptive Körpererziehung gliedert –als eine Disziplin der Körpererziehung und der Sportwissenschaften – jene Kenntnisse in ein System ein, welche dazu dienen, den Gesundheitszustand mit den Mitteln und Methoden von Körpererziehung und Sport wieder herzustellen (Übersetzung von dem Author). Obige Begriffe sind nur zum Teil mit den in diesem Bereich abgeschlossenen internationalen Abkommen in Einklang ( Draft convention ont he rights of persons with disabilities, 2006; Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2008), da nur die Wiederherstellung des Gesundheitszustandes angestrebt wird. Um aber in die Gesellschaft als vollwertiges Mitglied zurückkehren zu können, ist es notwendig, dass auch die Leistungsfähigkeit zu einem möglichst hohen Prozentsatz wieder hergestellt wird.
Bei der Begriffsbestimmung muss beachtet werden, dass die Sportwissenschaften im Laufe eines im Jahre 1994 beginnenden Prozesses, der mit der Regierungsverordnung 169/2000. (IX.29.) abgeschlossen wurde, eine andere, günstigere Einstufung innerhalb der Wissenschaftszweige erhielten. Ihre Grundkategorien sind (Bíróné, 2004):
-physische Aktivitäten
-Freizeitgestaltungstätigkeiten
-Tätigkeiten auf den Gebieten Rehabilitation und Körperheilung durch Bewegung
-bewusste Körperübungen, Körpererziehung
-Körpererziehung im Heilbereich
-Sportarten (präventiv, zur Gesundheitserhaltung, Rekreation)
-Leistungssportarten
Die adaptive Körpererziehung beinhaltet Grundkategorien der Sportwissenschaften (Tätigkeiten auf den Gebieten Rehabilitation und Körperheilung durch Bewegung, Körpererziehung im Heilbereich), so werden von ihr deren Mittel, Methoden und wissenschaftliche Forschungen angewandt. Als Grenzwissenschaft hat sie einen engen Bezug zu den medizinischen Wissenschaften und von ihren Wissenschaftszweigen zu den Gesundheitswissenschaften (Gesundheitsförderung, Gesundheitserziehung), deren Ergebnisse zur Verwirklichung der Zielsetzungen und Aufgaben der adaptiven Körpererziehung mit verwertet werden. Auch ihr Bezug zur Pädagogik darf nicht außer Acht gelassen werden, denn gerade diese Beziehung muss infolge der geänderten gesellschaftlichen Umgebung enger werden als je zuvor (vgl. Veränderung der Beziehungsverhältnisse zw. Erzogene/r-ErzieherIn, ErzieherIn-Eltern, Schule-Eltern und Aufwertung der Chancengleichheit). Von den als Ausgang benutzten Definitionen wird bei Punyi der pädagogische Charakter betont und kein Bezug zu den Sportwissenschaften hergestellt. Bei Gárdos und Mónus wird die Begriffsbestimmung von Nemessúri zeitgemäßer formuliert und – anstatt von Heilung – der Begriff „Wiederherstellung des Gesundheitszustandes“ gebraucht, sowie mit der genauen Zuordnung der adaptiven Körpererziehung in das Bezugssystem der Wissenschaften der Begriff zugleich präzisiert. Leider fehlt in dieser fast vollständigen Begriffsbestimmung der Hinweis auf den Erziehungsprozess bzw. auf die Adaptivität, welche aber wichtige Elemente der adaptiven Körpererziehung darstellen. Adaptiver Unterricht heißt nichts anderes, als Differenzierung und Unterricht mit Bezugnahme auf individuelle Eigenschaften. Differenzierung bedeutet eine Förderung mit Betracht auf individuelle Eigenschaften bzw. die Schaffung von pädagogischen Umständen und Bedingungen, die dem Individuum ermöglichen, sich selbstgesteuert zu entwickeln. Unseres Erachtens kann der Begriff der adaptiven Körpererziehung mit einer Integrierung der Werte der bisherigen Begriffsbestimmungen und unter Berücksichtigung der Komplexität, der Adaptivität und der gesellschaftlichen Erwartungen folgendermaßen definiert werden:
Adaptive Körpererziehung bezeichnet einen Prozess im Laufe des Unterrichts und der Erziehung, bei dem die individuellen Eigenschaften in maximaler Weise in Betracht gezogen werden und jene Mittel und Methoden von Körpererziehung und Sport angewendet werden, die dazu beitragen, den Gesundheitszustand und die Leistungsfähigkeit zu möglichst hohem Anteil wieder herzustellen und Chancengleichheit zu sichern.
Verglichen mit den bisherigen Begriffsbestimmungen gibt es hier neue Elemente, wie die Inbetrachtnahme der individuellen Eigenschaften und die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit, welche eindeutig zur Abgrenzung gegenüber der adaptiven physischen Aktivität dienen. Die APA möchte in erster Linie durch die Gewährleistung von Bewegungsaktivitäten eine Steigerung der Handlungsfähigkeit Bewegungsbehinderter, Gesundheitsgeschädigter oder älterer Leute erreichen, wodurch für die Betroffenen die Erlangung von qualitativer Lebensführung und Chancengleichheit ermöglicht wird.
Aufgrund obiger Aussagen lässt sich feststellen, dass die adaptive physische Aktivität (APA) eine Tätigkeitsform von Körpererziehung und Sport darstellt, die die Methoden der Körpererziehung und des Sports anwendet und dazu beiträgt, bei Menschen mit geändertem Gesundheitszustand und beschränkten Fähigkeiten eine positiv gerichtete Änderung des Gesundheitszustandes, die prozentuell höchst mögliche Wiedererlangung ihrer Handlungsfähigkeit und die Schaffung der Chancengleichheit zu erreichen.
Adaptive physische Aktivität und adaptive Körpererziehung sind aufeinander aufbauende (nicht gegeneinander gerichtete) Tätigkeiten, bei denen verschiedene Körperübungen impliziert sind, und das muss sich auch in den von uns benutzten Formulierungen richtig widerspiegeln. Adaptive Körpererziehung bedeutet eine institutionalisierte Rehabilitation, die mit der zielgerichteten Entwicklung der verschiedenen physischen Fähigkeiten und der Vermittlung der grundlegenden Bewegungsformen einen Beitrag leistet, den Gesundheitszustand und die Leistungsfähigkeit in möglichst hohem Maße wieder herzustellen. Organisatorische Einrichtungen für APE sind Schulen und Rehabilitationsinstitute. Zielsetzungen der adaptiven physischen Aktivität werden vor allem durch zivile Selbstorganisationen verwirklicht, bei denen es um die Förderung des Gesundheitszustandes und der Handlungsfähigkeit geht. APA bietet eine Möglichkeit, die nur von jenen wahrgenommen werden kann, die über die entsprechenden physischen und mentalen Grundlagen verfügen. Eine Hilfe dazu bietet die adaptive Körpererziehung. Abbildung 1. zeigt Vorangegangenes in Zusammenfassung, weiters werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede von APE und APA geschildert.
|
adaptive Körpererziehung |
adaptive physische Aktivität |
|
Gemeinsamkeiten |
|
|
Ziel: Wiederherstellung, Bewahrung der Gesundheit |
Ziel: Wiederherstellung, Bewahrung der Gesundheit |
|
sekundäre Prävention |
sekundäre Prävention |
|
Ziel: Schaffung der Chancengleichheit |
Ziel: Schaffung der Chancengleichheit |
|
Unterschiede |
|
|
Ziel: Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit |
Ziel: Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit |
|
institutionalisierte Rahmenbedingungen, vor allem Schule |
vor allem im Rahmen von zivilen Organisationen |
|
zielgerichtete Entwicklung motorischer Fähigkeiten |
Möglichkeiten für Bewegungsübungen anbieten |
|
möglichst viele Bewegungsformen, Sportarten vermitteln |
die ausgewählte Bewegungsform auf höchstmöglichem Niveau durchführen |
Abb. 1. : Vergleich zwischen APE und APA
Nach Klärung der Begriffe „adaptive Körpererziehung“ und „adaptive physische Aktivität“ können wir uns jetzt den Erscheinungsformen der adaptiven Körpererziehung in Mitteleuropa zuwenden.
Unterschiede bei den Erscheinungsformen der adaptiven Körpererziehung in der mitteleuropäischen Region
In Mitteleuropa zeigt sich ein buntes Bild bei den Erscheinungsformen der adaptiven Körpererziehung. Eine institutionalisierte Form bei der Behandlung und der adaptiven Körpererziehung von Kindern mit Erkrankungen der Bewegungs- und inneren Organe bzw. von Behinderten ist nur in Ungarn vorzufinden. Kranke Kinder werden je nach Grad ihrer Erkrankung kategorisiert, und darauf folgend wird die Rehabilitationstätigkeit in den an sie angepassten, adaptiven Körpererziehungsgruppen begonnen. Die Beschäftigungen werden von speziell für diese Tätigkeit ausgebildeten Pädagogen für Körpererziehung geleitet. In Ungarn werden Lehrer für adaptive Körpererziehung schon seit 1915 ausgebildet. In der mitteleuropäischen Region konnte Fachliteratur zum Thema der adaptiven Körpererziehung nur in geringer Anzahl gefunden werden, daher stammen unsere Informationen aus unstrukturierten Interviews und Beobachtungen. In den Ländern der Region wird adaptive Körpererziehung in erster Linie Behinderten angeboten. Spezielle Beschäftigungen für Kinder, die an Krankheiten der Bewegungs- und inneren Organe leiden, gibt es in den meisten Fällen als Physiotherapie, in Krankenhäusern angeboten. In Österreich werden die Grundlagen der Physiotherapie und der Rehabilitation durch Sport von den Studenten im Zuge des Studiums zwar erlernt, aber eigens auf diese Bereiche spezialisierte Pädagogen für Körpererziehung gibt es nicht. In der Slowakei haben wir ein ähnliches Bild. Im Laufe unserer Untersuchungen haben wir feststellen können, dass in einigen Bundesländern von Österreich zwar eine Form von institutionalisierter Rehabilitation existiert – ähnlich wie sie auch in Ungarn praktiziert wird-, es ließ sich aber auch feststellen, dass eine Rehabilitation für Kinder mit Erkrankungen an Bewegungs- und inneren Organen in keinem mitteleuropäischen Land mit ähnlicher Ausstattung wie in Ungarn der Fall ist.
Abbildung 2. zeigt eine Gesamtdarstellung personeller Bedingungen.
|
Ausbildung in Ungarn |
Ausbildung in den mitteleuropäischen Ländern |
|
Ausbildung zum Lehrer für adaptive Körpererziehung
|
Teil der Ausbildung zum Lehrer für Körpererziehung
|
|
Ausbildung zum Physiotherapeuten
|
Ausbildung zum Physiotherapeuten
|
|
Konduktor
|
Abb. 2. Vergleich personeller Bedingungen
Vergleicht man in den Ländern der Region die materielle Ausstattung, so kann festgestellt werden, dass deren Dimension leider immer noch wesentlich vom Grad der wirtschaftlichen Entwicklung des betreffenden Landes abhängig ist. Über die beste materielle Ausstattung verfügen dementsprechend die Institutionen in Österreich.
Zusammenfassung
Am Ende unserer Studie kann zusammenfassend gesagt werden, dass es notwendig ist, die Begriffe adaptive Körpererziehung (APE) und adaptive physische Aktivität (APA) getrennt zu behandeln, sowie auf die Unterschiede bei der Benutzung der Begriffe einzugehen. Des Weiteren empfinden wir es als notwendig, dass der Begriff APE in Europa und auch in der internationalen Fachliteratur einheitlich benutzt wird. Im Laufe der Begriffsbestimmung wurde ersichtlich, dass APA eine breitere Auffassung des Begriffs darstellt, der Rehabilitationstätigkeiten, spezielle Körpererziehung und Sport umfasst. APE beinhaltet einen engeren Bereich der Rehabilitation, die institutionalisierte Rehabilitation, die Prävention, Erziehung und Unterricht als Bestandteil der adaptiven physischen Aktivität. Wir erachten es als wichtig, dass diese differenzierte Auffassung auch in der europäischen Praxis erscheint, denn nur so kann die Rehabilitation der betroffenen Population effizient werden.
Unsere Untersuchungen in den Ländern der Region haben gezeigt, dass APA in Ungarn nicht in dem Maße verbreitet ist, wie es in einigen benachbarten Ländern (z.B. Österreich) der Fall ist. APE hingegen ist in Ungarn – verglichen mit den umliegenden Ländern – in viel effizienterer und organisierterer Form vertreten als bei seinen Nachbarn. Die Untersuchung zeigte auch, dass Ungarn bezüglich der Rehabilitationstätigkeiten über bessere personelle Bedingungen verfügt als die anderen Länder der Region, hingegen ist aber Österreich das Land, das in materieller Hinsicht am besten ausgestattet ist.
Aus Obigem ergibt sich, dass in Europa auf dem Gebiet der Rehabilitationstätigkeiten ein einheitliches Begriffssystem notwendig ist, in dem die organisatorischen Rahmenbedingungen der einzelnen Teilbereiche der Rehabilitation differenziert zur Erscheinung kommen und mit Hilfe dessen die personellen und materiellen Bedingungen gleichgeschaltet werden können. Erst durch die Erfüllung dieser Zielsetzungen kann die Integration von Menschen mit dem Bedürfnis nach physischer Rehabilitation. in eine gesunde Gesellschaft erreicht werden.
Literatur
Akinbami LJ. (2006): The state of childhood asthma, United States, 1980–2005. Advance data from vital and health statistics; no 381, Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics.
A középfokú nevelés-oktatás kerettantervei (2000): Budapest.
Bloom B, Cohen RA. (2007): Summary of Health Statistics for U.S. Children: Natilan Health Interview Survey, 2006. National Center for Health Statistics. Vital Health Statistics 10. 234.
Biróné, N.E. (2004): Sportpedagógia, Dialóg Campus, Bp.-Pécs 18-19.
Declaration of Principle and Position Statement (1995): Approved at the 13th General Meeting of WCPT, Washington
Divišová, J.-Hanulíková, J.-Klimešová,T.-Vítková, L. (2007): Comparative study on adapted physical activity Czech republic http://www.erasmusmundus.be/comparative/Czech%20Republic.pdf retrived november 25.
Draft convention on the rights of persons with disabilities, New York, 14-25 August 2006
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc8adart.htm ,Retrived november 25., 2008.
European Health for all Database Retrieved July 8, 2008, from http://www.euro.who.int/hfadb Érdi-
Gárdos, M. –Mónus, A. (1991): Gyógytestnevelés, Bp, TF. 29-30, id.29.; id.29.
Grivas T. B. – Vasiliadis E. – Mouzakis, V. – Mihas C. – Koufopoulos, G.(2006): Association between adolescent idiopathic scoliosis prevalence and age at menarche in different geographic latitudes, Scoliosis 2006, 1:9doi:10.1186/1748-7161-1-9
Hutzler Y, Sherrill C. (2007). Defining adapted physical activity. International perspectives. Adapted Physical Activity Quarterly 24(1):1-20.
Kádár, J. (2006): Asztmás gyermekek az iskolában. Magyar Sporttudományi Szemle /2 42.
Nemessúri, M. (1965): Gyógytestnevelés. TK., Budapest ,25.
Punyi, A.C. (1959): Kvoproszu o pszihologicseszkih osznovah lecsebnoj fizicseszkoj kulture. Fizkultura i szport, Moszkva, 27.
Robazza, C – Bortoli. L – Carraro, A – Bertollo, M (2006): ‘‘I wouldn’t do it; it looks dangerous’’. Changing students’ attitudes and emotions in physical education Personality and Individual Differences 41. 767–777.
Stanescu,M.-Bota, A.-Popescu,M.(2007): ICT training inspecialistin Adapted Physical Aktivities (APA) ICT in Education:Reflections and Perspectives, Conference in Bucharest, 2007.
http://bscw.ssai.valahia.ro/pub/bscw.cgi/d257223/Paper09_M_Stanescu_75_81.pdf Retrived november 25., 2008.
Szatmári, Z. (2004): Testnevelő tanárok nevelési stílusainak vizsgálata egy tanulói szerepjáték tükrében. Iskolai Testnevelés és Sport, 21. sz. 14.-18.
Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium (2002): Rhinitis ,Pulmonológiai útmutató. 2002 Klinikai Irányelvek Kézikönyve
United Nations Commission for Equal Rights of People with Disabilities. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Available online: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=259 retrieved June 20, 2008.
Valek, A. (2008): Összefoglaló jelentés a 2006/2007. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról. OGyEI, Budapest 1- 36.
Winnick, J.P. (2005): Adapted Physical Education and Sport. Human Kinetics, 4-5.
Zakrajsek,D., Carnes, L, Pettigrew, F.E. (2003): Quality Lesson Plans for Secondary Physical Education. Human Kinetics, USA, 2-73.