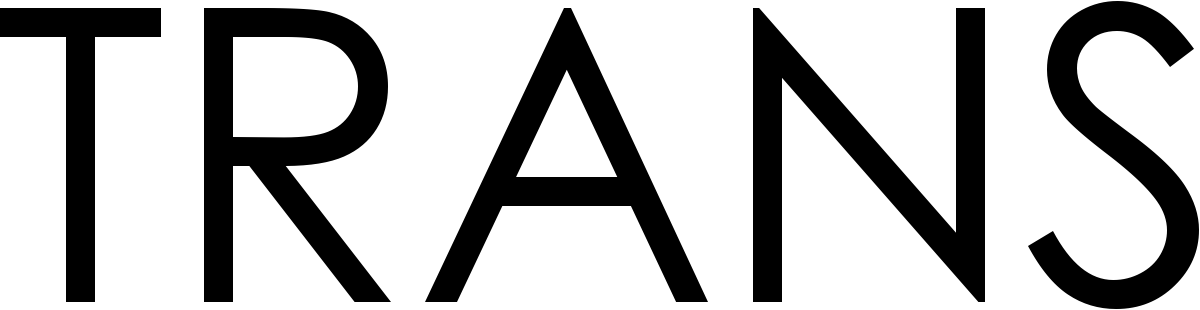Irina Solodilova
(Staatliche Universität Orenburg) [Bio]
Email: solodilovaira@rambler.ru
Im vorliegenden Beitrag möchte ich versuchen zu zeigen, wie die kognitive Linguistik und zwar ihre Auffassung der Wortbedeutung einige Probleme des Fremdsprachenerwerbs erklären kann und welche möglichen Konsequenzen sich für den Fremdsprachenunterricht daraus ableiten lassen.
Nach dem kognitiv-semantischen (holistischen) Ansatz ist „Sprache ein Ausdrucksmittel für inhaltliche Konzepte <…>, mit deren Hilfe der Mensch die Wirklichkeit wahrnimmt und verarbeitet“ (Hüllen 1992: 20). Natürliche Sprache und Kognition bilden somit zwei miteinander verbundene Phänomene, indem die Sprache die kognitive Erfahrungswelt des Sprechers widerspiegelt. Wie Martin Pütz betont, sind „die grammatischen und lexikalischen Strukturen der Sprache geradezu als ein Spiegelbild der universellen und der kulturspezifischen menschlichen Konzeptualisierungen aufzufassen“ (2002: 379). Demzufolge bezieht sich das sprachliche Zeichen auf eine kognitiv konstruierte Repräsentationseinheit und nicht auf realweltliche, extramentale Sachverhalte, wie es in der Auffassung des naiven Realismus behauptet wurde. Da unsere Sprache nicht die reale Welt, sondern ihre mentale Auffassung bzw. Vorstellung, die sich aufgrund der menschlichen Erfahrung und Wahrnehmung bildet, widerspiegelt, gibt es keine hundertprozentige semantische Äquivalenz zwischen zwei Wörtern verschiedener Sprachen, wenn es auch um quasi-analoge Referenten geht1. Darüber hinaus erweist sich die Übersetzungsmethode, die das Aneignen der fremden Wörter und Wendungen durch ihre Übersetzung in die Muttersprache voraussetzt, als uneffektiv und teilweise auch falsch, da sie nämlich sowohl lexikalische, als auch grammatische Fehler verursachen kann.
Als ein Beispiel dafür gilt das Wort müde und seine Übersetzung in die russische Sprache уставший (von der schweren körperlichen oder geistlichen Arbeit erschöpft), die im meist verbreiteten deutsch-russischen Wörterbuch von O.I. Moskalskaja gegeben wird. Diese Bedeutung, die die russischen Schüler lernen und kennen, bedeckt aber nur einen Teil des Bedeutungsumfanges von müde und lässt den anderen Zustand, der im Deutschen durch dasselbe Wort bezeichnet wird (in einem Zustand sein, der nach Schlaf verlangt), nicht erkennen, so dass die in der deutschen Realität durchaus übliche Frage Müde? früh am Tage einen Russen, der diese Bedeutung nicht kennt, eher verwirrt.
Jede Sprache repräsentiert eigenartig das mentale Konstrukt (Konzept) der realen Welt durch die Bedeutungen ihrer lexikalischen Einheiten, durch die einzigartige Bildlichkeit ihrer Idiomatik, durch die Semantik der grammatischen Kategorien und bildet damit insgesamt ihr (sprachliches) Weltbild. Die Eigenartigkeit der Sprache ist durch die Eigenartigkeit der menschlichen Kognition bedingt, die seinerseits kulturell, sozial, national „programmiert“ wird. Nach der Meinung von russischen Linguisten S.D. Popova und I.A. Sternin, werden Konzepte auf Grund a) der menschlichen Perzeption – der Wahrnehmung der Welt durch die Sinnesorgane, b) der menschlichen Tätigkeit, c) der kognitiven Zusammenhänge mit anderen Konzepten, d) der sprachlichen Kommunikation, e) des bewussten Erlernens der Spracheinheiten gebildet (2001: 40). Diese Interpretation der Vermittlungsfunktion der menschlichen Kognition erläutert die Kernannahme der kognitiven Linguistik im Sinne von Langacker und Lakoff, dass der kognitive Inhalt durch seine sprachliche Repräsentation selbst zu einem Bestandteil der Sprache wird, nämlich zu ihrer Semantik.
Darüber hinaus lässt sich ganz logisch schlussfolgern, dass der einzig richtige Weg zum erfolgreichen Erlernen einer Fremdsprache durch das Verstehen bzw. Aneignen der Art und Weise besteht, wie die sprachlichen Formen und Kategorien die sozial-historische Erfahrung der Menschen widerspiegeln.
Wie kann man aber an diese Art herankommen? Auf der lexikalischen Ebene ist es die Theorie des Konzeptes, die über eine „erklärende Kraft“ verfügt. Die Studien2 zu der semantischen Struktur eines Konzeptes lassen einige Schichten des Konzeptes bestimmen, einerseits eine etymologische und eine aktuelle und andererseits eine begriffliche, eine wertende und eine bildliche. Demnach lässt sich die Bedeutung eines Wortes dadurch aneignen, wenn alle diese Schichten berücksichtigt werden. Das Etymon stellt die erste mentalsprachliche Stufe in der Bedeutungsbildung. Die innere Form ist dabei die kognitive Basis jedes Sprachzeichens und ist eng mit dem Etymon verbunden. Das Etymon bzw. die innere Form des Wortes können also die Bedeutung eines Wortes durch das zu Grunde liegende Bild oder Merkmal erklären und damit auch dem Fremdsprachenlerner bewusst und anschaulich machen. Nach dem metaphorischen Ausdruck von N.A. Krasavskij, kann die etymologische Analyse das Geheimnis der ersten Schritte des Konzeptes aufschließen (2005: 39).
Diese These lässt sich am Beispiel der Wörter wissen – kennen illustrieren. Die Übersetzungsmethode hilft in diesem Fall nicht, sondern stört, da die beiden Verben ins Russische mit dem Verb знать übersetzt werden. Dabei geht es hier um zwei verschiedene Konzepte. Wissen, wie es im Etymologischen Wörterbuch von F. Kluge (2002: 994) steht, geht im Gotischen auf wait, im Altindischen auf véda und im Altslavischen auf vĕdĕ zurück und bezeichnet also den Zustand des Menschen als Ergebnis eines Informationserwerbs. Etymologische Bedeutung des Verbs kennen lässt seinen konzeptuellen Inhalt als Resultat einer Bekanntschaft mit etw./ j-m erklären: ich kenne es = es ist mir bekannt.
Inwiefern die Übersetzungsmethode manchmal stören kann, zeigen die Verben, deren Subjekt-Objektbeziehungen in zwei Sprachen nicht übereinstimmen. Das Verb begegnen wird von russischen Schülern analog dem russischen Äquivalent встретить ständig mit dem Akkusativ-Objekt gebraucht. Die innere Form des Wortes hilft die Bedeutung „auf deutsche Weise“ begreifen, so wie sie im Bewusstsein des Deutschen verankert ist. Begegnen ist eine Ableitung von der Präposition entgegen, d.h. es bezeichnet die Fortbewegung zu einem Anderen , der als entgegen gedacht wird – hier ist es die Semantik, die das Dativ-Objekt des Verbs auch Russen verständlich macht.
Die Übersetzungsmethode kann auch einen größeren Schaden zufügen, als nur grammatische Fehler beim Gebrauch des Wortes. Das geschah, meiner Meinung nach, mit dem Konzept Fleiß, einem sehr wichtigen in der deutschen Mentalität.
Mit diesem Begriff machen wir uns durch das Adjektiv fleißig und deren Übersetzung im deutsch-russischen Wörterbuch (Moskalskaja 2001: 482) als „I a прилежный, старательный; II adv прилежно, старательно, усердно“ bekannt. Im russischen Bewusstsein bezieht sich diese Charakteristik assoziativ vor allem auf einen Schüler, einen Studierenden. Der assoziative Zusammenhang прилежный – сотрудник ist im Bewusstsein der Russen eher ungewöhnlich oder enthält andere wertende Komponenten. Auf solche Weise wird der Bedeutungsumfang dieses Wortes stark reduziert. Fleißig bedeutet in erster Linie ’unermüdlich und viel arbeitend‛, die Bedeutung, die sich von der des russischen Wort прилежный etwas unterscheidet. Sehr wichtig bei der Beschreibung der Wortbedeutung auch wertende und assoziative Bereiche zu berücksichtigen, die natürlich viel schwerer zu erschließen sind.
Zum Glück werden heute im Rahmen der kognitiven Semantik viele kulturell wichtige Konzepte untersucht. Wichtig ist, dass die Ergebnisse dieser Studien auch im Fremdsprachenunterricht ihre Anwendung finden können. Bemerkenswert ist aber die Tatsache, dass sich das Hauptaugenmerk der Wissenschaftler mehr auf die Konzepte richtet, die in der Sprache durch die signifikanten Sprachzeichen repräsentiert werden. Dabei bleibt der mentale Inhalt solcher Wörter wie z. B. Präpositionen weiter wenig erforscht. Das konzeptionelle Auffassen von Präpositionen könnte aber m. E. viel beim Lernen der Rektion der Verben helfen. Traditionell lernt man sie auch weiter einfach auswendig, ohne jegliche Erklärung, obwohl sie es geben muss. Präpositionen beziehen sich trotz ihrer Mehrdeutigkeit auf bestimmte mentale Konstrukte bzw. Vorstellungen, durch die sich die Semantik der ersten gut erklären lässt. Denn es muss doch einen Grund dafür geben, dass die Verben sprechen, lesen, schreiben, nachdenken u.a.m. mit der Präposition über gebraucht werden, während sich erinnern, sich halten, sich anpassen – die Präposition an fordern. Diese Logik muss herausgefunden und dem Fremdsprachenlerner als Hilfe zur Verfügung gestellt werden.
Bei dem der Logik der Sprache folgenden, d.h. bewussten Erlernen erreicht man im Unterschied z. B. zu der Konzeption einer pädagogischen Grammatik a priori oder der Übersetzungsmethode das Ziel viel leichter und schneller, wenn man unter dem Ziel das, was in der linguistischen Didaktik als „Entwicklung des zweiten Sprachbewusstseins“3 und in der Umgangssprache als Sprachgefühl bezeichnet wird, versteht.
Diese Thesen erinnern trotz ihrer Aktualität aber an ähnliche, wenn auch etwas anders formulierte Ideen der Hermeneutik: Die Übersetzung des Wortes stellt einen einfachen Deutungsakt dar, eine adäquate Deutung erfolgt nur durch das „Einleben“ in die andere Kultur bzw. Zeit, durch das Begreifen des Wortes im Kontext der eigentlichen Kultur4.
So oder anders formuliert lässt sich schlussfolgern, dass die „Bewusstmachung“ der grammatischen oder lexikalischen Strukturen, d. h. sinnvolles Lernen, bei dem man die Fremdsprache erleben kann, auf jeden Fall erfolgreicher und viel interessanter ist, als gedankenloses Auswendiglernen.
Das zweite Moment, worauf ich im Rahmen dieses Beitrags eingehen möchte, betrifft das Problem des usuellen Gebrauchs des fremden Wortes, das (das Problem) in kognitionswissenschaftlichen Ansätzen auch seine Lösung finden kann. Die heute unbestreitbare These der DaF-Methodik lautet: Das referenzielle Bedeutungswissen garantiert den richtigen Gebrauch des Wortes bei weitem nicht. Das neue Wort muss daher nicht isoliert, d. h. in seiner Wörterbuchbedeutung vermitellt werden, sondern in seiner „natürlichen“ Umgebung von kontextuellen bzw. kommunikativen Partnern. Es genügt bei weitem nicht, nur die Bedeutung z. B. des Substantivs Gesetz zu erklären. Für den richtigen Gebrauch dieses Wortes ist auch das andere Wissen nötig, und zwar von Verben, die in der deutschen Sprache bestimmte Handlungen bzw. Prozesse bezeichnen, die mit dem Gesetzt als dem Objekt der Wirklichkeit vollgebracht werden. M.a.W. geht es um die möglichen Prädikationen, typischen für das deutsche Sprachbewusstsein, und weiter – um den situativen Ansatz und seine These, das Wort werde erst durch seinen Einschluss in eine größere Einheit – eine Proposition, ein Schema, eine Szene, einen Frame verstanden [Zalevskaja 2005: 222].
Der Frame-Ansatz setzt eine weitere Bedeutungsauffassung voraus, der zu Folge die mentalen Einheiten – die Einheiten der empirischen Erfahrung, d.h. des Weltwissens in den Prozess des Sprachverstehens einbezogen sind. In Bezug auf das genannte Problem möchte ich nur auf einige, die Anwendung des Frame-Ansatzes bei der Beschreibung der Wortsemantik erläuternde Thesen eingehen.
Unter Frames (nach Fillmore) versteht man in der kognitiven Semantik standardisierte, aber gleichzeitig dynamische konzeptuelle Wissensstrukturen, deren Elemente teilweise variable, veränderliche (d.h. ko-und kontextabhängige) Werte, teilweise typische bzw. Standardwerte sind, die von einer Wortform bzw. einem Formativ evoziert werden. Da Frames enzyklopädisches Wissen repräsentieren, d.h. eine Menge von Propositionen, so müssen die beiden Bestandteile der Propositionsstruktur – die Referenz und die Prädikation – aus dem Frame ermittelt werden. In diesem Zusammenhang wird angenommen, dass der evozierte Frame dem referenziellen Inhalt der Proposition entspricht, die Elemente der Prädikation mit den Standardwerten übereinstimmen, die im Fillmores Modell als default values bezeichnet werden. Die Wortbedeutung, die konventionell mit einer Form bzw. Formativ verbunden wird, lässt sich als eine Struktur, einen Rahmen mit Slots oder Leerstellen beschreiben, die mit Wissenseinheiten besetzt werden. Laut Fillmore sind das ko-und kontextuelle Angaben, allgemeine Hintergrundkenntnisse und extralinguistische Faktoren, die das Verstehen des sprachlichen Ausdrucks motivieren. Einerseits werden diese Wissenselemente durch konkrete (explizite) Prädikationen, andererseits – durch typische (implizite), sogenannte Standardprädikationen repräsentiert. Bei den letzten geht es um das Wissen, das im Bewusstsein des Rezipienten durch assoziative Zusammenhänge mit bestimmten Vorstellungen, Szenen, Situationen aktualisiert wird. Standardprädikationen kommt eine sehr wichtige Funktion zu: sie repräsentieren den größten Teil des verstehensrelevanten Wissens, so dass ihre Ermittlung für Linguisten von großem Interesse ist.
Den Inhalt des Frames kann man laut Fillmore durch Fragen explizieren. Der von einem Sprachzeichen evozierte Frame umfasst das Wissen über die Gegebenheiten, die sich mit dem Referenzobjekt verbinden. Wenn der Frame, wie Fillmore meint, aus systemhaft wechselwirkenden Konzepten besteht, so lässt sich jeder Konzept anhand der Fragen expliziert werden [Fillmore 1977: 64]. Die gleiche Auffassung vertritt Minsky, nach dessen Definition Frame eine Menge von Fragen darstellt, die in einer hypothetischen Situation gestellt werden können [Minsky 1975: 246]. In diesem Fall kann man Fragen als Leerstellen und Antworten als ihre Füller betrachten. Diese These ermöglicht anhand der Fragen-Antwor-Ordnung die Struktur des Frames zu explizieren, d.h. sein semantisches Model zu bauen.
Als Mittel der Erfahrungsstrukturierung und als Beschreibungsverfahren für lexikalisches und grammatisches Material werden Frames in der letzten Zeit immer mehr aktuell. So wurde von K.-P. Konerding [Konerding 1993: 139-217] die auf der Frame-Theorie fundierte Methode der Ermittlung von Leerstellen des Frames anhand der Fragen entwickelt. Seiner Auffassung, die Frames aktualisierten Sprachausdrücke bzw. Texte seien als eine Liste von strategisch wichtigen Fragen darzustellen, liegen die Prämisse der Theorie der Informationsermittlung in [Hintikka 1985], die die Explikation des usuellen Wissens anhand der Fragen voraussetzt. Die Konerdings Methode lässt die Frame-Struktur nicht ad hoc, sondern systemhaft, anhand der plausiblen und überschaubaren Kriterien und Prozeduren zu rekonstruieren. Der Ausgangpunkt bildet die Annahme, der Zugang zum konzeptuellen Wissen sei durch die Prädikationen möglich, die in der Sprachgemeinschaft gebräuchlich sind, d.h mit usuellen Werten der entsprechenden Ausdrücke übereinstimmen [Konerding 1993: 166ff].
Die Konerdings Methode findet ihre Anwendung bei der Beschreibung des lexikalischen und grammatischen Gutes sowohl von westeuropäischen als auch von inländischen Linguisten (sieh [Fraas 1996], [Ziem 2008]), [Burenkova 2009] So unternimmt Burenkova die semantische Beschreibung der lexisch-semantischen Gruppe Ungeschicklichkeit/Plumpheit.
Dieses Verfahren kann m.E. auch im Fremdsprachenunterricht seine gute Anwendung finden, vor allem bei der Vermittlung neuer Wörter bzw. des Wortschatzes zu einem Thema. Der Frame-Ansatz bereichert das Wissen, das die Spracheinheit repräsentiert und ermöglicht dabei auch die assoziativen Zusammenhänge zu ermitteln, die fürs Sprachverstehen auch einen relevanten Charakter haben.
Die aktuelle Fremdsprachendidaktik gibt zu, dass die optimale Vermittlungsarbeit nur nach dem Konzept eines kommunikativen Unterrichts gekoppelt mit kognitiven Lerntheorien erfolgen kann [Güler 2011: 2]. Zum Schluss möchte ich nur noch betonen, dass die frühere Isolation von Wissenschaften wohl keine Zukunft mehr hat und haben soll, umgekehrt ist es die erwähnte Koppelung von Wissenschaften, die uns auf dem Wege der Lösungssuche helfen kann.
LITERATUR
Burenkova C.V. Frame kak sposob modelirovanija fragmentov polja v ideografitscheskoj lexikigrafii (na materiale lexiko-semantitscheskoj gruppy „neuklüghest“// Voprosy kognitivnoj lingvistiki. – 2009. № 2. S. 73-81.
Dilthey, W. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geistwissenschaften// Gesamte Schriften. – Leipzig, Berlin: B.G. Teubner, 1927 – Bd. 7. – XII.
Fillmore Ch. J. Scenes-and-frames semantics. In: Cole R.W. Current Issues in Linguistic Theory. Bloomington/London: Indiana University Press, 1977. – P. 76-138.
Fraas C. Gebrauchswandel und Bedeutungsvarianz in Textnetzen. Die Konzepte „Identität“ und „Deutsche“ im Diskurs zur deutschen Einheit. Tübingen: Narr, 1996.
Galskova, N.D., Ges, N.I. Teorija obutschenija inostrannym jasykam (Theorie des Fremdsprachenunterrichts). Linguistische Didaktik und Methodik. – M.: „Akademija“, 2007.
Güler G. Bewusstheit eigener Spracharbeit: Eine Seminarkonzeption für Wortschatzerwerb und –vermittlung in der fremdsprachigen Lehrbildung// Muttersprache, Jahrgang 121 (2011). S. 1-18.
Hintikka J., Hintikka M. B. Scherlock Holmes in Konfrontation mit der modernen Logik. Zu einer Theorie des Informationserwerbs durch Befragung In: Eco U., Sebeok Th. (Hrsg): Der Zirkel oder im Zeichen der Drei. Dupin. Holmes. Peirce. München: Fink, 1985. – S. 231-251.
Hüllen, W. Kognitive Linguistik – eine Möglichkeit für den Grammatikunterricht. Ein neuer Vorschlag zur Lösung eines alten Problems // Grammatica vivat. Konzepte, Beschreibungen und Analysen zum Thema „Fremdsprachengrammatik“. – A. Barrera-Vidal, M. Raupach, und E. Zöfgen (Hgg.). – Tübingen: Narr, 1992: 15-30.
Karasik V.I. Jasykovoj krug: litschnost`, kontepty, diskurs (Sprachkreis: Perönlichkeit, Konzepte, Diskurs). – M.: Gnosis, 2004.
Konerding K-P. Frames und lexikalisches Bedeutungswissen. Untersuchungen zur linguistischen Grundlegung einer Frametheorie und zu ihrer Anwendung in der Lexikographie. Tübingen: Niemeyer, 1993.
Krasavskij N.A. Emozionalnaja konzeptosfera nemezkogo jasyka: opyt etimologitscheskogo analisa (Emotionelle Konzeptsphere der deutschen Sprache: der Versuch einer etymologischen Analyse) //Voprosy kognitivnoj lingvistiki. – 2005. – №1. S. 38-43.
Komlev N.G. Slowo v retschi: Denotativnije aspekty (Das Wort in der Rede: Denotative Aspekte). – M.: LKI, 2007.
Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache / Bearb. Von Elmar Seebold. / 24., durchges. u. erw. Aufl. / Berlin; N.Y.: de Gruyter, 2002.
Minsky M. A Framework for Representing Knowledge. In: Winston P.H. The Psychology of Computer Vision. New York: McGraw-Hill, 1975. P. 211-277.
Moskalskaja O.I. Das große deutsch-russische Wörterbuch: in 3 Bd. – 7. Aufl. – M.: Russ. Jas., 2001.
Popova S.D., Sternin I.A. Otscherki po kognitivnoj Lingvistike (Grundriß der kognitiven Linguistik). – Voroneg, 2001.
Pütz, M. „Bedeutungskonstruktion“ und fremdsprachendidaktische Implikationen der kognitiven Linguistik // Prozesse der Bedeutungskonstruktion/ Inge Pohl (Hrsg.). – Frankfurt a. Main; Berlin; Bern; Bruxelles, N.Y.; Oxford; Wien: Lang, 2002. – S. 375-394.
Stepanov J.S. Konzept// Konstanten. Slovar´ russkoj kultury. M.: Akademitscheskij projekt, 1997. S. 40-76.
Zalevskaja A.A. Psichologitscheskije issledovanija. Slovo. Text: Iybrannyje trudy. M.: Gnosis 2005.
Ziem A. Frames und sprachliches Wissen. In: Felder E. (Hrsg.) Sprache und Wissen. – Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008.
1 Nach der Meinung von Komlev ist kein Wort einer Sprache in seiner semantischen Struktur einem Wort der anderen Sprache völlig äquivalent (2007: 142).
2Vgl. dazu Karasik 2004, Stepanov 1997.
3 Vgl. dazu Galskova N.D., Ges N.I. 2007.
4 Vgl. dazu Dilthey W. 1927.