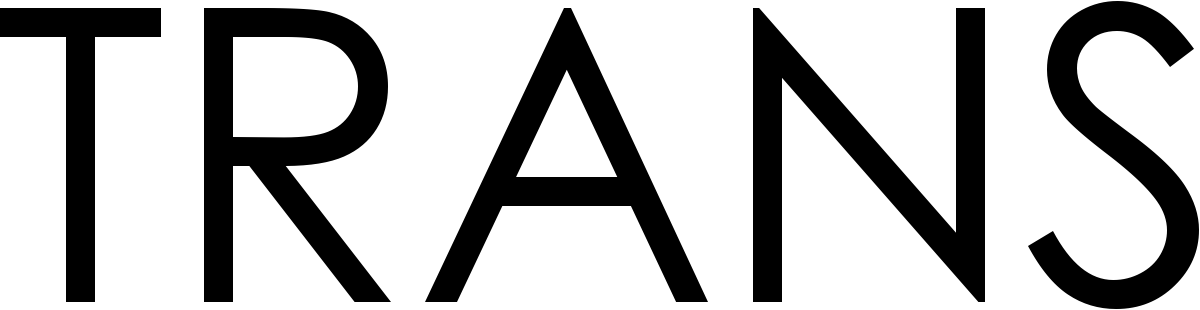Nr. 18 Juni 2011 TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften
Section | Sektion: Semantik, Diskurs und interkulturelle Kommunikation aus interdisziplinärer Perspektive
Semantisch-expressive Charakteristik der Verben
Natalia Akinina (Staatliche Linguistische Universität Pyatigorsk, Russland) [BIO]
Email: nakinina@yandex.ru
Konferenzdokumentation | Conference publication
Die semantisch-expressive Charakteristik des Wortes wird in der Linguistik fast immer als Konnotation interpretiert.
Das Wort „Konnotation“ scheint in der Logik von Scholastikern auf. Im XVII. Jahrhundert verbreitet sich dieses Fachwort in der Sprachwissenschaft. Mit Hilfe von diesem Wort bezeichnet man Eigenschaften im Unterschied von Substanzen. In der Logik wird dieser Begriff der Denotation entgegengesetzt. Anders formuliert: in der Logik bezeichnet er den Begriffsinhalt, in der Sprachwissenschaft die Nebenbedeutung.
Nach Gottlob Frege bedeutet Konnotation die intensionale Bezugnahme – den Umfang oder die Intension eines Terminus – im Gegensatz zu seiner Extension.
Nach John Stuart Mill ist ein Wort „konnotativ“ (vgl. Englisch: connotative – „mitbezeichnend“) „wenn es außer einem Gegenstand auch eine seiner Eigenschaften bezeichnet; es ist nicht-konnotativ […], wenn es nur einen Gegenstand oder eine Eigenschaft allein bezeichnet.“
In der Sprachwissenschaft – genauer in der Semantik – bedeutet Konnotation die Nebenbedeutung eines sprachlichen Ausdrucks. Im Vordergrund der Betrachtung steht meist die Konnotation von einzelnen Wörtern. Man kann aber auch „Wort-, Satz- oder Textkonnotationen beschreiben“. In der Wortsemantik bezeichnet Konnotation die zusätzliche gedankliche Struktur, die die Hauptbedeutung (die Denotation, das Denotat) eines Wortes begleitet und die stilistischen, emotionalen, affektiven Wortbedeutungskomponenten enthält – also das, was bei der Verwendung eines Begriffs bewusst oder unbewusst noch mitschwingt.
Konnotation wird mitunter von einer bloßen Assoziation abgegrenzt, die im Gegensatz zur Konnotation nicht zur eigentlichen Bedeutung gehört, jedoch als deren Begründung(en) anzusehen sein soll. So hat das Wort Köter im Vergleich zu Hund eine negative Konnotation. Der Gedanke an Flöhe bei Hund soll nur eine Assoziation sein. Richtig erscheint zudem die Unterscheidung zwischen konventionalisierter und rein individueller Konnotation.
Erdmann O. interpretierte den Begriff «Konnotation» in dreierlei Hinsicht: 1. als Begriffsinhalt, 2. als zusätzliche Bedeutung, 3. als sinnliches Element, das mit der Stimmung verbunden ist (Erdmann, 1925: 106). Schippan und Sommerfeldt (1966: 535) meinten, dass einzelne Bedeutungen etwas Wichtigeres als das Zentrum der Bedeutung ist, d.h. einzelne Wörter wecken bei den Menschen bestimmte emotionale Aktionen.
Galperin betont drei Typen der Bedeutungen; darunter „emotive meaning“ – „emotive meaning… has reference not directly to things or phenomena of objective reality, but to the feelings and emotions of the speaker towards these things or to his emotions as such, …“ (Galperin, 1981: 66).
Riesel unterscheidet Stilfärbung, Stilsphäre, Stilschicht – geschraubt, geschwollen, gewählt, poetisch – speisen, nullexpressiv – essen, literarisch-umgangssprachlich – kein Mensch, keine Seele war gekommen; familär (salopp) – kein Teufel, kein Hund war gekommen, quatschen; grob (vulgär) – fressen, krepieren, die Fresse, das Maulwerk, keine Marie (kein Geld) haben. Hier muss man aber betonen (nach Riesel), dass literarisch-umgangssprachliche Ausdrücke (das sind die Ausdrücke, die leicht familiär sind) zu familiär-umgangssprachlichen und diese ihrerseits zu vulgären, vulgäre zu groben übergehen. Riesel unterstreicht, dass „semantisch-expressiv“ das Verhalten des Sprechers zum Objekt ist. Aber vergleichen Sie bitte das eindeutige deutsche Verhalten und die Interpretation des Ausdrucks «Du, Esel!»
Man muss auch bemerken, dass stilistische Neutralität, nach unserer Meinung auch eine bestimmte stilistische Färbung besitzt. Diese Tatsache hilft uns, der Meinung von Arnold zuzustimmen. Er bemerkt, dass die lexikalische Bedeutung jeder lexikalisch-semantischen Variante eine komplizierte Einheit ist. Diese Einheit besteht aus: 1. Denotativer Bedeutung des Wortes, die Begriff heißt; 2. dem Teil der Mitteilung, der mit Bedingungen und allen Mitgliedern der Kommunikation verbunden ist und einen emotionalen, expressiven, stilistischen Bestandteil hat. Alle Bestandteile können sich sowohl alle zusammen als auch in verschiedenen Variationen zeigen. Sie können auch überhaupt fehlen. Man muss aber betonen, dass jedes Wort (in unserem Fall – jedes Verb) einen rationalen und emotionalen Bestandteil hat. Außerdem muss man immer bei dem Gebrauch des Wortes die soziokulturelle Umgebung berücksichtigen.
Die Idee des Zusammenhangs der Sprache und der Soziokultur kommt noch aus dem 17. Jahrhundert. Der soziale Aspekt der Semantik des Verbs wurde aber bis heute noch nicht genug studiert. Wir machten einen solchen Versuch.
In diesem Referat handelt es sich um die semantisch-expressive Charakteristik der Verben. Die gewählten Verben haben in den Definitionswörterbüchern die Wörterbuchbezeichnung „Umg“; darum muss man betonen, dass alle Verben einen umgangsprachlichen Charakter haben. Den umgangsprachlichen Charakter kann man mit Hilfe des Vergleichs der Verben bestimmen, die zu einem lexikalisch-semantischen Feld gehören: speisen, essen, fressen; sterben, ableben, krepieren, entschlafen u. s. w.
Im Referat werden drei Gruppen der Verben analysiert: familiäre, vulgäre und scherzhafte. Im gewählten Forschungsmaterial haben soziale Semantik „familiär“ folgende Verben: abplacken (sich) – мучиться, биться над чем – либо, abrackern – измучиться, abrauschen – с шумом удалиться, absäbeln – откромсать кусок, abschmatzen – расцеловать, обцеловать, anbaggern – подвалить к кому-либо, abzittern – убираться вон, anblaffen – тявкать, наорать, aufmotzen – приукрасить, вырядить, auseinanderklamüsern – разобраться в чем-либо, dünnemachen – исчезнуть, смыться, spucken – плевать, verwalken – избивать, verwamsen – избить, verwischen – вздуть кого-либо, промотать деньги, vergucken – обознаться.
Familiarität erfasst die Physiognomie eines Objektes; sie spricht auf die Vertrautheit eines Objektes an; sie vergleicht also das äußere Erscheinungsbild des Objektes mit dem im Gedächtnis gespeicherten Erfahrungsschatz und prüft, ob er das betreffende Individuum schon von früher kennt, insbesondere, ob für diese Reizkonfiguration einmal eine Prägung stattgefunden hat. Familiarität ergibt sich nach Bischof aus der Dauer und der Enge des Zusammenseins. Das heißt, dass die Kommunikanten gleichen sozialen Status haben müssen, sonst wird die Kommunikation als „familiär“ im negativen Sinn bezeichnet.
Folgende Verben haben die Wörterbuchbezeichnung „vulgär“: abkotzen – обрыгать, ankotzen – дразнить, обрыгать, ansaufen – основательно напиться, anscheißen – грубо ругать, aufgeilen – построиться, вытянуться в струнку, besaufen – напиться до чертиков, bescheißen – обрыгать, вымазать кого-либо блевотиной, einsauen – измазаться, испачкаться, вымазаться как свинья, furzen – громко выпускать газы (пердеть), gasen – выпускать газы, pupen – громко выпускать газы, pimpern – трахаться, abmurksen – прикончить, убить, anstinken – опротиветь, einbleuen – вдалбливать в голову, ersaufen – утонуть, ersaeufen – утопить, kalbern|kälbern – дурачиться, блевать, popeln – ковырять пальцем в носу, abschnappen – подыхать.
Vulgarität bezeichnet die Eigenschaft des Unkultivierten, Gewöhnlichen, Niederen oder auch Unflätigen. Vulgär im letzteren Sinne bezeichnet insbesondere Sprachelemente, Verhaltensmuster und Handlungen, die vor dem Hintergrund kultureller Normen als verächtlich oder tabu gelten. Beispielsweise werden Vulgärsprache, grobe Umgangsformen und rüpelhaftes Benehmen, oder das aufdringliche Zurschaustellen von Reichtum oder sexuellen „Vorzügen“ als vulgär empfunden.
Vulgär bedeutet ein abwertendes Urteil – beispielsweise als Ausdruck individuellen Geschmacks oder sozialer Zugehörigkeit des Urteilenden. Grundsätzlich bedeutet das Wort bloß schlicht (nach dem französischen Wort vulgaire = gewöhnlich, das aus dem lateinischen vulgus/volgus = Volk abgeleitet wurde); somit auch „das Gewöhnliche“, „das dem einfachen Volk (als Gegensatz zum Adel) Entstammende“. In diesem Sinn ist auch der Begriff Vulgärlatein zu verstehen: Die lateinische Sprache des einfachen Volkes.
„Vulgarität“ im engeren Sinn wird dann eher dem „gemeinen Volk“ (lateinisch: vulgus profanum) zugeschrieben. In diesem Zusammenhang wird der Begriff auch als einfach, oberflächlich oder (in wissenschaftlicher Argumentation) als unwissenschaftlich verstanden.
Warig bezeichnet nur solche Verben als „vulgär“, die mit Mahlzeiten, Ausflussen und sexuellem Verhalten verbunden sind. Solche Wörter werden oft tabuisiert. Wir meinen aber, dass dieser Gruppe (vulgäre Verben) auch die Verben zuzurechnen sind, die mit der individuellen Tätigkeit des Individuums, mit dem Verhalten dieses Individuums zu den anderen Individuen verbunden sind: kalbern, einbleuen, abmurksen, popeln, pimpern u.s.w. Sozial-semantischer Bestandteil „Vulgarität“ gibt dem Verb solche Zuschußbedeutungen wie Gewalt, Nichtachtung, Gefühl der Überlegenheit, Demütigung der anderen Individuen.
Folgende Gruppe der Verben wird als „scherzhaft“ bezeichnet (Scherz bezeichnet: Witz, ein Sachverhalt mit Pointe, eine listige Handlung): bechern – выпивать, kneipen – пить по черному, попивать, benamsen – давать имя, называть ребенка, beniesen – обчихать окружающих, dazwischenfunken – вмешаться в разговор, вставить словечко, erblonden – перекраситься в блондинку, füttern – уплетать, кормить, verartzen – врачевать, плохо, неправильно лечить, verdünnisieren – убираться восвояси, verschlimmbessern – (ирон.) ухудшить (при попытке сделать лучше), vertrödeln – продать за бесценок, продавать в розницу (устар.), hinüberschlummern – (поэт. шутл.) умереть, kuren – (возвышенно, шутливо) выбирать, избирать.
Scherz ist hauptsächlich in einem sozialen Raum erlaubt. Es ist nicht üblich, wenn sich der Untergebene zum Chef scherzhaft verhält.
Daraus kann man folgende Schlussfolgerungen ziehen: 1. Jedes Verb hat eine rationale und eine emotionale Bedeutung. 2. Die semantisch-expressive Ckarakteristik der Verben und den Status der Kommunikanten muss man bei der Kommunikation immer berücksichtigen, um Missverständnisse zu vermeiden.
Literatur:
- Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст] / И.Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 140c.
- Ельмслев, Л. Пролегомены к теории языка. // Новое в лингвистике, вып. I [Текст] / Л. Ельмслев. М.: 1962. – 371.
- Koмлев, Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова [Текст] / Н.Г.Koмлев. – М.: МГУ, 1969. – 192 с.
- Милль, Д.С. Система логики силлогической и индуктивной [Текст] / Д.С.Милль. – М.: Книжное дело, 1899. – 871 с.
- Erdmann, O. Die Bedeutung des Wortes. [Text]/ O.Erdmann. – Leipzig: Haessel, 1925. – 226 S.
- Riesel, E. Der Stil der deutschen Altagsrede [Text]/ E. Riesel. – M.: Verlag Hochschule, 1964.– 315 S.
- Wahrig, G. Deutsches Wörterbuch. – Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1997.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Familiarit%C3%A4t
Inhalt | Table of Contents Nr. 18
For quotation purposes:
Natalia Akinina: Semantisch-expressive Charakteristik der Verben –
In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 18/2011.
WWW: http://www.inst.at/trans/18Nr/II-13/akinina18.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2011-07-07