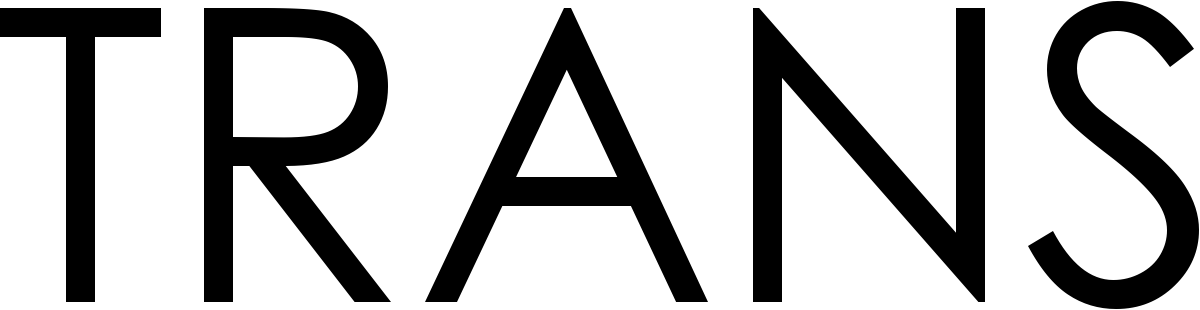Nr. 18 Juni 2011 TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften
Section | Sektion: Interkultureller Dialog im Mediendiskurs der Informationsgesellschaft
Stilistische Merkmale der Expressivität des Fachtextes im interkulturellen Mediendiskurs am Beispiel der Satzgefüge
Tatiana Burdaeva (Staatliche Universität für Verkehrswesen Samara, Russland) [BIO]
Email: t-burdaeva@mail.ru
Konferenzdokumentation | Conference publication
Im vorliegenden Beitrag geht es um stilistische Merkmale der Expressivität des Fachtextes im interkulturellen Mediendiskurs. Neben der allgemeinen Charakteristik des Fachtextes wird seine Rolle in der Informationsgesellschaft analysiert. Durch fachliches Wissen wird die Information in einem interkulturellen Dialog zwischen den Wissenschaftlern – den Vertretern verschiedener Kulturgesellschaften – ausgetauscht, übertragen, verarbeitet. Für die effektive Kommunikation ist dabei die Wahl der Sprachmittel wichtig.
Es ist auch wichtig, die stilistischen Änderungen des Fachtextes im Laufe der Zeit zu berücksichtigen, und zwar die Expressivitätsmöglichkeiten. In diesem Beitrag wird gezeigt, welche stilistischen Merkmale der Expressivität der Fachtexte zum Thema „Verkehrswesen“ in der Zeitperiode von der Mitte des XX. bis zum Anfang des XXI. Jahrhunderts in verschiedenen Nebensatztypen aufweist. Dabei werden einige sprachdidaktische Aspekte beleuchtet.
Auf Grund der rasant fortschreitenden Globalisierung sowie der weltweiten Intensivierung der sprach- und kulturübergreifenden Fachkommunikation wird die Zusammenarbeit in der Forschung zwischen Wissenschaftlern international immer stärker. Als Kommunikationsverfahren tritt hier der Fachtext auf. Der Fachtext wird von mir hauptsächlich als Informationsquelle betrachtet. Einerseits sollte die bestimmte Information eigentlich das Fachwissen vom Adressant weitergegeben und vom Rezipienten empfangen werden. Andererseits sollte dieses Fachwissen ein bestimmtes Interesse beim Rezipienten erwecken und auf ihn einen positiven Eindruck machen. Der Adressant könnte ein Wissenschaftler, ein Fachmann, ein Lehrer sein, der Rezipient könnte ein anderer Wissenschaftler oder ein Fachmann sein, ein Student oder sogar ein Laie, ein Muttersprachler oder ein Ausländer. In diesem letzteren Falle wird die Information in einem interkulturellen Dialog zwischen den Vertretern verschiedener Kulturgesellschaften ausgetauscht, übertragen, verarbeitet. Die Situation, wenn Deutsch als Fremdsprache für den Beruf von Studenten gelernt wird, scheint mir am aktuellsten zu sein. Während der Arbeit an einem Fachtext im Unterricht oder während der gemeinsamen studentischen Forschungsprojekte, der wissenschaftlichen Konferenzen etc. wird der Student zum interkulturellen Dialog zugezogen.
Der interkulturelle Dialog wäre im weiteren Sinne mit dem interkulturellen Mediendiskurs vergleichbar, denn unter Mediendiskurs versteht man einen Nachrichtenaustausch, der folgende Komponenten hat: Adressant, Rezipient, Rückkopplung, Kodierung / Enkodierung von Informationen, Kontext / Situation. Meiner Ansicht nach könnte sich als Nachricht der Fachtext ergeben, als Adressant – der Autor, als Rezipient – der Leser. Unter Kodierung / Enkodierung ist die Aufnahme, die Übertragung, die Interpretation von Informationen gemeint. Der Kontext wird als Register der distanzierten Kommunikation betrachtet [Vgl. Kostrowa 1998, Кострова 2004]. Bei der Rückkopplung spielen die kognitiven Prozesse eine wichtige Rolle, d.h. die Art und Weise, wie der menschliche kognitive Apparat funktioniert und wie er aufgebaut ist: z.B. wodurch zeichnen sich die menschlichen Wahrnehmungsprozesse aus, welche Rolle spielt die Aufmerksamkeit bei der Informationsrezeption und -verarbeitung, wo werden Informationen gespeichert, welche Gedächtnistypen werden unterschieden, welche Strategien wenden Menschen beim Problemlösen an, welche Denkmuster lassen sich feststellen usw. Die Art und Weise, wie der menschliche kognitive Apparat funktioniert, hängt allerdings in hohem Maße davon ab, welche Ziele der Benutzer hat, wie er erzogen wurde sowie von seiner Bildung und Motivation.
Schematisch kann man diesen Kommunikationsprozess folgenderweise darstellen:
Schema 1
– Nachricht –
(Fachtext) ↓ ↓ Adressant Rezipient (Autor) ↔ (Leser) ↑ Rückkopplung ↓ − Kodierung / Enkodierung (Aufnahme, Übertragung, Interpretation)
Kontext (Register der distanzierten Kommunikation)
Fachtexte stellen konkrete Realisierungen der Fachsprachen, zu jeder Zeit verfügbare Ergebnisse der fachlichen Kommunikation dar. Sie sind komplexe Einheiten, die sich einerseits aus sozialen, situativen und thematischen Faktoren und andererseits aus den dadurch bedingten Textstrukturen, Stilschichten und formalen Merkmalen zusammensetzen [Vgl. Baumann 1992: 9ff.]. Sie sind komplexer als andere Texte, weil sie bestimmten Kriterien unterliegen, die ihnen das Fach selbst aufzwingt.
Unter den wichtigsten Merkmalen von Fachtexten sind Explizitheit, Exaktheit, Objektivität, Präzision, Differenziertheit, Sprachökonomie, Vollständigkeit, Anonymität und Sachlichkeit [Vgl. z.B. Baumann 1998: 374] zu nennen. Präzision ist die „wichtigste Rechtfertigung für die Existenz der Fachsprachen und ihre Weiterentwicklung“, da sich „Techniker und Wissenschaftler auch im sprachlichen Bereich um Präzision bemühen müssen.“ [Arntz 1989: 23 f.] Sprachliche Mittel der Präzisierung sind z.B. Attribute (nachgestellte Substantive im Genitiv, voran- bzw. nachgestellte Adjektive und Partizipien, Relativsätze). Zur Sprachökonomie, syntaktischen Kompression dienen z.B. Partizipialkonstruktionen, präpositionale Wortgruppen, Komposita. Der Fokus der Anonymität liegt in Fachtexten üblicherweise auf Objekten, auf wissenschaftlichen oder technischen Sachverhalten oder Handlungen, und nicht auf dem Akteur (E. Oksaar). Die Anonymisierung drücken in der Regel Passiv und Passiversatzformen aus.
Die Beschreibung der Merkmale des Fachtextes wäre ohne seine Expressivität nicht komplett. Da der Mensch durch verschiedene emotionale Prozesse des zentralen Nervensystems beeinflusst werden kann, schließt die Verarbeitung von im Fachtext enthaltenen Informationen zu einem großem Teil emotionale Komponenten ein [Baumann 2001: 11]. Ungeachtet dessen, dass die Fähigkeit die Information aufzunehmen und die Fähigkeit die Emotionen zu erleben zwei verschiedene Seiten sind, gibt es eine Korrelation zwischen dem Inhalt einer jeweiligen Information und dem Charakter der Emotionen, die im Bewusstsein des Menschen mit dieser Information assoziiert werden. Die Information, die bei der Wahrnehmung der Objekte der Außenwelt entsteht oder in einem Gedanken ist, und die emotionale „Begleitung“ zu dieser Information sind die einzelnen Seiten eines Ganzen [Брандес 2004: 177-178].
Es sei darauf geachtet, dass ein authentischer Fachtext mit allen seinen Besonderheiten eine Reihe von Schwierigkeiten für die Studierenden (die Nicht-Linguisten) bietet. Es lassen sich z. B. solche grammatischen Erscheinungen wie Relativpronomen in den Relativsätzen (das Relativpronomen wird oft mit einem bestimmten Artikel verwechselt), die letzte Stelle des Prädikats bzw. des finiten Verbs in Nebensätzen, das Partizip in der Funktion des Attributs etc. von den Studenten nicht sofort erkennen. Deswegen kommt es häufig zu Fehlern beim Übersetzen ins Russische. Die Übersetzung dient hier als eine der Prüfungsmethoden des Verstehens des gelesenen Textes. Es sollte nicht nur die Inhaltsseite des Originals und der Übersetzung berücksichtigt werden, sondern auch seine formelle Seite – z.B. stilistische Besonderheiten, das Verhältnis von Sprachnorm und Usus. Beim selbständigen Schreiben (bei der Bildung der Sätze) werden auch grammatische Fehler gemacht. Im interkulturellen Dialog sollte man diese Sprachprobleme lösen.
Demnach könnte das Ziel meiner Untersuchung folgenderweise formuliert werden: die stilistischen Möglichkeiten der Expressivität im Fachtext festzustellen und die expressiven Sprachmittel, die in verschiedenen Nebensatztypen realisiert werden, zu beschreiben. Dabei wird gezeigt, welche stilistischen Änderungen des Fachtextes in der Zeitperiode von der Mitte des XX. Jahrhunderts bis zum Anfang des XXI. Jahrhunderts zu beobachten sind.(1)
Als Untersuchungsmaterial dienen Fachtexte aus den deutschen Fachzeitschriften zum Thema „Verkehrswesen“ (etwa 300000 Zeichen).
Laut O. Kostrowa sind 3 Ebenen der Sprachanalyse zu unterscheiden: 1) oberflächensyntaktische, 2) semantisch-abstrakte, 3) diskursive [Кострова 2004].
Die oberflächensyntaktische Ebene ist empirisch durch den Satzumfang charakterisiert – und zwar durch Segmentierung und Abbruch. Hier werden solche Mittel analysiert, die oberflächlich vorkommen wie z.B. Satzlänge, Ellipse, Parzellierung, Anschluss.
Auf der semantisch-abstrakten Ebene sind die Prozesse der Metaphorisierung und Umstellung relevant, wobei die führende Rolle der Sinn der dargestellten Information spielt. Es handelt sich hier in erster Linie um die expressive Wortstellung.
Solche Prozesse wie Wiederholung und Einbettung – Metasymbolisierung genannt [Kostrowa 1998: 15] – lassen sich auf der diskursiven Ebene realisieren. Es ist üblich, die Satzlänge eines Elementarsatzes im Anhang von dem funktionalen Stil zu erforschen (in der Theorie von W. Admoni). In wissenschaftlichen und wissenschaftlich-populären Texten beträgt z.B. die Satzlänge etwa 8-16 Wörter [zit. nach Кострова 2004: 53]. Hier habe ich auch die Satzlänge in den Satzgefügen der früheren Zeitperiode und von heute verglichen. So variiert die Satzlänge in den Fachtexten des Jahres 1975 zwischen 29 bis 31 Wörtern, in den Fachtexten des Jahres 2009 zwischen 22 bis 24 Wörtern. Die stilistischen Änderungen in diesem Falle zeigen die Verkürzung der Satzlänge in der modernen deutschen Sprache. Die Tendenz zur Sprachökonomie in dem Register der distanzierten Kommunikation ist sowohl durch die Spezifik des Fachtextes bedingt, als auch durch die extralinguistischen Faktoren. Für die richtige Aufnahme der im Fachtext enthaltenen Information ist es für den Leser ein positives Merkmal. Es ist klar, dass ein langer Satz schwer aufgefasst wird; die Situation wird eben kompliziert, wenn ein Ausländer, der Deutsch als Fremdsprache studiert, mit einem Fachtext zu tun hat. Aus meiner persönlichen Erfahrung könnte das Beispiel 22 beispielhaft sein, wenn die Studenten auch wegen der deutschen typischen Satzklammer oft im schwerfälligen Stil den Satz übersetzen, ohne die letzte Stelle des Prädikats zu berücksichtigen (sieh unten).
Die Ellipsen (unvollständige Sätze) sind für einen Fachtext nicht so typisch, das ist eher ein Merkmal der Texte aus der schönen Literatur oder der mündlichen Rede. Doch manchmal treten die Ellipsen in Fachtexten sowohl der früheren als auch der neuen Zeitperiode auf.
Die reinen Ellipsen, die nicht als Parenthese definiert werden, sind mit der Auslassung des Hilfsverbs verbunden, z.B.:
- Wie schon ausführlich dargelegt, waren die alten Schienenomnibusse bei ihrem ersten Erscheinen in den 50er Jahren mit einem solchen Maß an fortschrittlichen, technischen Einrichtungen ausgestattet, … (ZEV-Glas № 5’75, S.132) → Wie schon ausführlich dargelegt wurde, …(Как уже было подробно представлено, … )
- Wie schon eingangs ausgeführt, wird gegenwärtig für den Betrieb im Jahre 1991 der „ICE“ entwickelt, … (Internationales Verkehrswesen № 37’85, S.396) → Wie schon eingangs ausgeführt wurde, …(Как уже было изложено вначале, …)
- Der Warnschall erscheint am Aufpunkt (Mikrofon) in der Entfernung a, wenn das Mikrofon direkt neben dem WSG steht wie in Abb. 4 dargestellt (EI № 9’09, S.22) → … wie in Abb. 4 dargestellt wurde (… как представлено на рис.4)
- Wenn erforderlich, kann man mit x≠0 die Verschiebung des WSG außerhalb der Mitte zwischen zwei Positionen berücksichtigen (EI № 9’09, S.22) → Wenn es erforderlich ist, …(Если необходимо, …)
Die Beispiele 1, 2, 3 stellen einerseits eine Abweichung von der Norm im Satzaufbau dar und wirken stilistisch expressiv, andererseits sind sie in den wissenschaftlichen Texten zu Klischees geworden. Solche Sätze werden von den Studenten ohne besondere Probleme ins Russische übersetzt, die reduzierte Passivform des Vollverbs wird gewöhnlich erkannt, wie in Beispielen gezeigt wird.
Im Beispiel 4 sind die Hauptglieder im Konditionalsatz ausgelassen, die jedoch leicht wiederhergestellt werden können. Während der Nebensatz zur Ellipse wird, wird die Information im Hauptsatz konzentriert. Eine Bedingung wird hier von den Studenten v. a. dank der Konjunktion „wenn“ erfasst – im Unterschied zum Beispiel 8 (siehe unten).
Im folgenden Beispiel wird die Wortverbindung „Plug and Play“ von mir als Anschluss betrachtet:
- So wird z. B. nach Tausch eines Sensors dessen Kennfeld vom System selbsttätig ermittelt und berücksichtigt, so dass keine Justage- und Einstellarbeiten erforderlich sind – „Plug and Play“! (EI № 9’09, S.51)
Die Expressivität wird hier nicht nur durch den Anschluss, sondern auch durch das Ausrufezeichen erreicht. Diese Wendung ist in der englischen Sprache einer Werbeaussage näher, der strenge wissenschaftliche Stil wird hier mit Elementen eines anderen Stils vermischt. Solche „Mischerei“ ist für den Mediadiskurs typisch [Губик 2006: 61]. Für den internationalen Verkehr ist die englische Sprache sehr wichtig, die aus dem Englischen entlehnten Wörter und Wortverbindungen sind in deutschen Fachtexten nicht selten. Aber solche Entlehnungen werden zu einem der Sprachbarrieren im interkulturellen Dialog, wenn die russischen Studenten nur eine Fremdsprache (Deutsch) erlernen. Da verstehen sie den Sinn der ganzen Aussage nicht und sind dabei verwirrt, denn sie können diese Wendung weder richtig übersetzen noch lesen.
Wie schon erwähnt, gehört die Wortstellung zu der semantisch-abstrakten Ebene der Analyse. In traditionellen Grammatiken ist häufig von „Wortstellung“ die Rede, wenn es um die Reihenfolge bzw. das Nacheinander der Teile im Satz geht. Der Terminus „Satzgliedstellung“ ist jedoch zu bevorzugen, weil nur Satzglieder insgesamt in ihrer Reihenfolge im Satz verändert werden können, einzelne Wörter nicht. Deshalb ist bei der Stellung der Teile im Satz stets vom Satzglied auszugehen. Die einzige Ausnahme besteht dort, wo Wort und Satzglied identisch sind, also das Satzglied nur aus einem Wort besteht [Bertelsmann Grammatik 1999: 475-476].
Neben der geraden und ungeraden Satzgliedstellung in der Grammatik unterscheidet man in der Stilistik neutrale und emphatische Satzgliedstellung. Es ist klar, dass sowohl bei der geraden als auch ungeraden Satzgliedstellung expressiver Ausdruck entstehen kann. Die folgenden Beispiele werden von mir als neutral betrachtet:
- Ein neues Fahrzeug, das diesen Anforderungen entsprechen soll, wird sich letzter Errungenschaften des technischen Fortschrittes bedienen müssen (ZEV-Glas № 5’75, S.132).
- Es ist zu erkennen, dass das Signal durch wechselnde Feinkornteile und Feuchtigkeit stark beeinflusst wird (ETR № 9’09, S.478).
- Da der Hochgeschwindigkeitsverkehr nicht nur Neuverkehre für die Bahnen verspricht, sondern bei Einhaltung bestimmter Dimensionierungskriterien auch interessante wirtschaftliche Perspektiven eröffnet, spielt er in der nationalen und internationalen Diskussion eine zunehmende Rolle (Internationales Verkehrswesen № 37’85, S.398).
- Im Rahmen der Planung wird festgelegt, ob konventionell oder gleisgebunden gearbeitet wird (ETR № 9’09, S.477).
- Steigt das Wasser in den Bereich des Schotters, verschwindet dessen Signatur örtlich ebenfalls (ETR № 9’09, S.480).
In 6, 7, 8, 9 geht es um die Satzgliedstellung im Hauptsatz, da der Nebensatz keinen Änderungen in der Stellung der Satzglieder in wissenschaftlichen Texten in beiden vergleichenden Zeitperioden unterzogen wird. Die Stellung des Nebensatzes vor dem Hauptsatz (8) oder in der Interposition (6) bringt keine Expressivität hervor. Konjunktionslose Konditionalsätze (10), die oft die Anfangsposition des Nebensatzes und die Erststelle des finiten Verbs haben, werden nicht als expressiv betrachtet, da sie Norm sind. Solche Sätze wirken aber auf die Studenten „nicht normal“, werden nicht sofort als Konditionalsätze erkannt und stellen einige Schwierigkeiten für das korrekte Verstehen dar:
*Вода протекает в области щебня, исчезает в местности (der Satz ist als eine Satzreihe übersetzt anstatt: Если вода поднимается в области щебеночного балласта, то его сигнатура также исчезает).
Im Russischen ist jedoch die Konjunktion „если“ Norm; konjunktionslose Konditionalsätze sind nur noch in einigen Sprichwörtern (z.B.: Тише едешь, дальше будешь.) erhalten geblieben, im wissenschaftlichen Stil aber kaum möglich. Deshalb entsteht ein interkultureller Konflikt wegen der Unterschiede in der Sprachnorm zweier Sprachen. Um diesen Konflikt zu lösen, sollte von der Seite des Lehrers jedes Mal erwähnt werden, was für ein Nebensatztyp das ist.
Die Beispiele 11, 12, 13, 14 wirken als stilistisch expressiv, da sie die Umstellung der Hauptglieder sowie der Nebenglieder haben:
1 2 3
- Maßgebend für die Unterschiede sind neben dem Umfang der menschlichen und wirtschaftlichen Beziehungen – einschließlich Fremdenverkehr – vor allem psychologische Barrieren, unter denen die Sprache eine wichtige Rolle spielt (Internationales Verkehrswesen № 37’85, S.396).
1 2 3 4
- Ausschlaggebend für die Wahl dieses Verfahrens war, dass der Läufer in seinem Innenbereich große Hohlräume aufweist … (ETR № 9’09, S.456).
1 2 3
- Zu beachten ist bei den folgenden Beispielen, dass die RDG-Streifen aufgrund der speziellen Eigenschaften der hochfrequenten Antennen derzeit nur in einigen Abschnitten erkennbar sind (ETR № 9’09, S.483).
1 2 3
- Begonnen wird zweckmäßigerweise mit dem Störschall LNx, der die höchsten Pegel aufweist … (EI № 9’09, S.23)
In (11, 12) wird die zweite Stelle durch Adverbiale besetzt, weshalb das finite Verb umgestellt wird. Die Umstellung erfolgt in diesem Falle wegen der Betonung, die auf dem Vorfeld liegt (Vgl. Vorfeld-Mittelfeld-Nachfeld von E. Drach). In (13, 14) bleibt das finite Verb an der zweiten Stelle, aber der infinite Prädikatsteil steht an der ersten Stelle, was für eine „normale“ Satzgliedstellung untypisch ist. Der Hauptsatz wird also wegen der Akzentuierung ausgeklammert.
Es ist jedoch festzustellen, dass die Änderungen in der deutschen Satzgliedstellung im Satzgefüge sehr selten vorkommen, deshalb kann man über die Expressivität der Sprachmittel auf der semantisch-abstrakten Ebene im interkulturellen Mediendiskurs kaum sprechen.
Was die diskursive Ebene der Sprachanalyse betrifft, so lässt sich hier der sogenannte Schaltsatz oder die Parenthese realisieren. Die Parenthese dient zum Zweck, etwas zu präzisieren, einzuschätzen, zu kommentieren etc. (Brandes 2004), kann dabei grammatisch unabhängig von dem ganzen Satz sein.
Die Parenthesen können im Satz auf verschiedene Weise graphisch gestaltet werden; z.B.:
- Diese Werte werden in die Bearbeitungstabellen – wie in Abb. 6 gezeigt – eingetragen (EI № 9’09, S.22) – Gedankenstrich
- Er wurde, wie Bild 8 zeigt, schwimmend aufgebaut, … (ZEV-Glas № 5’75, S.135) – Komma
- Ebenso hatte sich (durch Ausprobieren) für das Beispiel gezeigt, dass es für die Schallverteilung vorteilhaft ist, wenn der Geber 1 auf einer Position sitzt (EI № 9’09, S.22) – Klammer
Die Parenthesen können aus einem Wort, einer Wortverbindung, einem einfachen oder einem komplexen Satz bestehen; z.B.:
– ein Wort:
- Diese letzte Spule (VE-Spule) ist Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb des Fahrmotors nach der Montage, da Rückstände vom Reiniger innerhalb der Wicklung den Isolationswert der Motoren und damit ihre Funktion beeinträchtigen können (ETR № 9’09, S.454).
– eine Wortverbindung:
- Der Reisende, der am Bahnsteig anstelle des erwarteten Schienenomnibusses einen solchen Leichttriebwagen vorfindet, wird sogleich erkennen, dass hier ein Fahrzeug einer grundlegend neuen und fortschrittlichen Bauweise – attraktiv für jedermann – angeboten wird. (ZEV-Glas № 5’75, S.131)
- Messdaten müssen, wenn es – wie bei Regressforderungen – um Gerichtssicherheit geht, belastbar sein. (ETR № 9’09, S.481)
– ein Wort + die Infinitivkonstruktion „um…zu“:
- Dabei handelt es sich in aller Regel um modularisierte Fahrzeugkonzepte (Plattformen), die – um Synergien zu realisieren – flexibel mittels Länderpakete an die jeweilige nationale Anwendung angepasst werden. (ETR № 9’09, S.471)
– die Partizipialkonstruktion:
- Wie in Abb. 10 dargestellt, fällt der Schall an den einzelnen Positionen … unter einem bestimmten Abstrahlwinkel α – bezogen auf die Hauptabstrahlachse – ein. (EI № 9’09, S.23)
– einfacher Satz + konjunktionsloser Konditionalsatz:
- Der Einbau von längslaufenden Streifen wäre übrigens erfolglos, da diese in der Regel nicht detektiert werden (die zurückgestrahlte Energie ist zu gering) oder – sollte der Streifen wegen optimaler Antennenposition doch einmal erfasst werden – der Streifen als normale Schichtgrenze erscheint, die nicht definiert werden kann. (ETR № 9’09, S.483)
– Attributsatz:
- Anschließend betrachtet der Verfasser das Marktpotential für Magnetschwebebahntechniken – deren Entwicklung für Verbindungen ohne bestehende Bahninfrastruktur von Bedeutung sein könnte – sowie die neuesten Entwicklungen … . (Internationales Verkehrswesen № 37’85, S.397)
Wie die Beispiele zeigen, werden die Parenthesen, die aus einem Wort bestehen, selten in wissenschaftlichen Texten beider Zeitperioden gebraucht. Am häufigsten sind die Parenthesen, die aus einer Wortverbindung oder einem Nebensatz bestehen, zu finden.
Der Bedeutung nach unterscheidet man verschiedene Parenthesen. In (18) wird die Art der Spule präzisiert, während in (22) einige Charakteristika genauer gefasst werden, in (19) wird das neue Fahrzeug eingeschätzt. In (20) geht es um Vergleich, in (21) wird der Zweck der Fahrzeugkonzepte gezeigt, in (23) erfolgt eine Bedingung im zweiten Falle und in (24) dient der Attributsatz – und zwar der Relativsatz – zur genaueren Beschreibung der Magnetschwebebahntechniken.
Der Gebrauch der Parenthesen in wissenschaftlichen Texten wird einerseits durch die Spezifik des Fachtextes, wo es immer nötig ist, etwas zu kommentieren, genauer zu formulieren, zu vergleichen etc., erklärt. Andererseits werden sprachökonomische Konstruktionen (z.B. reduzierte Nebensätze) als Parenthese gebraucht. Die Expressivität wird also durch die Abweichung von der Satzbaunorm erreicht. Die Parenthesen werden von den Studenten in der Regel richtig verstanden, wenn der Satz nicht zu lang, verschachtelt oder überladen ist. Wie das Beispiel 22 zeigt, machen die Studenten Fehler, wenn sie den Satz ins Russische zu übersetzen versuchen:
Как представлено на изображении 10, *отдельный звук падает … под определенным углом α – *колеблется на главной оси излучения. (Anstatt: Как представлено на изображении 10, звук проходит на отдельных позициях под определенным углом излучения α – относительно главной аксионной оси)
Die reduzierte Passivform wird falsch übersetzt und anstelle der Wendung „в отношении …, относительно чего-либо“ steht das Verb, was zur Verdrehung des Sinnes des ganzen Satzes führt. Für den optimalen interkulturellen Dialog sind das Sammeln von Spracherfahrungen und der Erweiterung der Sprachkompetenz von hoher Bedeutung.
Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass die Expressivität des Fachtextes mehr auf den oberflächensyntaktischen und diskursiven Ebenen realisierbar ist. Zu den gebräuchlichsten expressiven Sprachmitteln des Fachtextes in der Periode von 1970 bis 2009 gehören die Satzlänge auf der oberflächensyntaktischen Ebene und die Parenthese auf der diskursiven Ebene. Im Großen und Ganzen bleibt der Fachtext stilistisch neutral, die Tendenz zur Expressivität in der deutschen Gegenwartssprache ist minimal. Die stilistischen Änderungen tragen jedoch zu der Entwicklung der Sprache bei und sind für den produktiven interkulturellen Dialog vor allem zwischen den Studierenden, dem wissenschaftlichen Nachwuchs, sehr wichtig.
Sekundärliteratur:
- Arntz, Reiner; Picht, Heribert. Einführung in die Terminologiearbeit. – Hildesheim. Zürich. New York: Olms 1989 (Studien zu Sprache und Technik 2).
- Baumann, Klaus Dieter. Integrative Fachtextlinguistik. – Tübingen: Gunter Narr Verlag 1992.
- Baumann, Klaus Dieter. Ergebnisse der Fachsprachenforschung I: Verwendungseigenschaften von Fachsprachen. Das Postulat der Exaktheit für den Fachsprachengebrauch (Stichwort I/34). In: Hoffmann, Lothar / Kalverkämper, Hartwig / Wiegand, Herbert Ernst. In Verbindung mit Christian Galinski und Werner Hüllen: Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. 1. Halbband. Berlin, New York: Walter de Gruyter 1998. S.373-377.
- Buhlmann, Rosemarie; Fearns, Anneliese. Handbuch des Fachsprachenunterrichts. Unter besonderer Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer Fachsprachen. – 6. Auflage. – Tübingen: Gunter Narr 2000.
- Bertelsmann Grammatik der deutschen Sprache : Sprachsystem und Sprachgebrauch. – Überarbeitete Neuausgabe der Grammatik von 1989. – Gütersloh, München: Bertelsmann Lexikon Verlag 1999.
- Kostrowa, Olga A. Satz und Äußerung: einfach und komplex. Lehrwerk zum Spezialkurs. – Samara: Verlag der Pädagogischen Universität Samara 1998.
- Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс: Учебник. . 3-е изд., перераб. и доп. . М.: Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004.
- Губик С.В. Когнитивно-дискурсивное исследование английского экономического массмедийного дискурса : На материале журнала „The Economist“ : Дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 Уфа, 2006.
- Кострова О.А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка. Учебное пособие. М.: Флинта, МПСИ, 2004.
- Andere benutzte Quellen:
Baumann, Klaus Dieter. Der Fachtext als komplexes Wissenssystem. Ein interdisziplinäres Konzept. In: LSP & Professional Communication Vol. 1 № 2. 2001. S.8–33 / http://ej.lib.cbs.dk/index.php/LSP/article/viewFile/1922/1925.
Primärliteratur:
- Der Eisenbahningenieur (EI). Internationale Fachzeitschrift für Schienenverkehr & Technik. – 2009. – № 9.
- Eisenbahntechnische Rundschau (ETR). – 2009. – № 9.
- Internationales Verkehrswesen. Fachzeitschrift für Information und Kommunikation in Verkehr. – 1984. – № 36.
- Internationales Verkehrswesen. Fachzeitschrift für Information und Kommunikation in Verkehr. – 1985. – № 37.
- Signal und Schiene. Fachzeitschrift für den Eisenbahnbau sowie das Sicherungs- und Fernmeldewesen der DR. – 1978. – № 1.
- Zeitschrift für Eisenbahnwesen und Verkehrstechnik. Glasers Annalen. – 1975. – № 5.
Anmerkung:
1 Es ist bemerkenswert, dass im Deutschunterricht mehr an den modernen Fachtexten gearbeitet wird, die Dynamik der deutschen Syntax ist vorwiegend für die allgemeine Entwicklung der Sprachkompetenz der Studenten bedeutsam.
Inhalt | Table of Contents Nr. 18
For quotation purposes:
Tatiana Burdaeva: Stilistische Merkmale der Expressivität des Fachtextes im interkulturellen Mediendiskurs am Beispiel der Satzgefüge –
In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 18/2011.
WWW: http://www.inst.at/trans/18Nr/II-14/burdaeva18.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2011-07-12