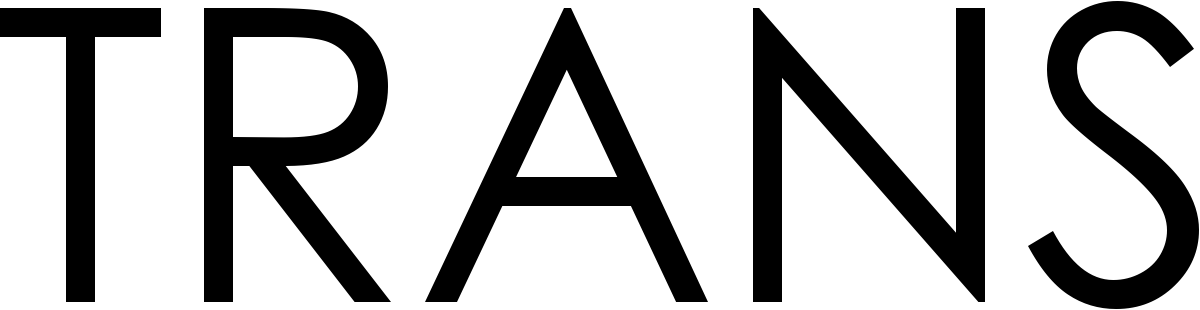Nr. 18 Juni 2011 TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften
Section | Sektion: Interkultureller Dialog im Mediendiskurs der Informationsgesellschaft
Sektionsbericht
Olga Kostrova (Interregionale Akademie für Sozial- und Geisteswissenschaften, Samara, Russland) [BIO]
Email: Olga_Kostrova@mail.ru
Konferenzdokumentation | Conference publication
Die Informationsgesellschaft ist durch Massenmedien möglich geworden und ist ohne sie nicht mehr denkbar. Nicht umsonst nennt man die Massenmedien die vierte Macht. Ob aber diese Macht immer positiv gebraucht wird, um die gesellschaftlichen Prozesse, die besonders intensiv in den Großstädten verlaufen, schöpferisch zu beeinflussen? Oder ob sie destruktiv wirken und Konflikte verschiedener Art auslösen? Besonders gefährlich ist ihre destruktive Rolle für die Großstädte, wo die Informationsdichte maximal ist und deren Bevölkerung verschiedenen Herausforderungen ausgesetzt ist.
Das globale Netz hat unsere Welt zu einem global village gemacht. Trotzdem behalten die Massenmedien in jedem Land ihr eigenartiges nationales Gepräge, das durch die nationale Mentalität und Ethnokulturalität bedingt ist. Besonders deutlich lassen sich die Unterschiede zwischen Ost und West fühlen, wobei die Machtdistanz, das Sicherheitsgefühl u.a.m. verschieden zum Ausdruck kommen. Der interkulturelle Vergleich der Mediendiskurse in europäischen Ländern, Russland eingeschlossen, kann sich in diesem Sinne sehr produktiv erweisen, denn dadurch können Erfahrungen gesammelt werden, die zur Stabilität und zur Weiterentwicklung der Informationsgesellschaft, sowie zur Verbesserung der Situation in den Großstädten beitragen können. Das Spektrum der Mediendiskurse, die in der Sektion zur Diskussion stehen, ist offen: Politik, Wirtschaft, Nachrichten, Werbung etc.
Im Rahmen des globalen Kongressthemas wurden zum Diskussionsgegenstand der Sektion die Mechanismen der Meinungsbildung in der Informationsgesellschaft, die in Ost und West in Massenmedien realisiert werden und ein nachhaltiges Echo in Großstädten finden:
- Welche Strategien benutzt man in verschiedenen Diskursarten und ob diese Strategien in Ost und West gleich sind;
- Wie beleuchten die Massenmedien die Probleme der Großstädte in Westeuropa und in Russland;
- Wie entstehen Stereotype über Andere und Autostereotype und welche Rolle spielen die Massenmedien dabei;
- Sind die Textsorten nationalspezifisch und ob es Probleme bei ihrem Verständnis gibt.
In der realen Sektionssitzung in Wien haben 7 Referentinnen vorgetragen; außerdem sind 6 virtuelle Beiträge vorhanden.
In dem Vortrag der Sektionsleiterin, Professorin der Interregionalen Akademie für Sozial- und Geisteswissenschaften (Samara, Russland) Olga Kostrova, und der Dozentin der Universität Orenburg (Russland) Anna Antonova wurden die Wahldiskurse in den Ländern mit entwickelten demokratischen Traditionen und in den Ländern mit beginnender demokratischer Entwicklung aus interkultureller Sicht zur Diskussion gestellt. Die Referentinnen behandelten den Wahldiskurs als Mechanismus der Machtbildung. Dabei stellten sie universelle und unterschiedliche Züge dieser Diskurse in Ost und West fest. Als universell haben sie den Manipulierungscharakter dieses Diskurses und seine Promissionsintention eingeschätzt. Doch das unterschiedliche Niveau der demokratischen Entwicklung, sowie Unterschiede in den Kulturen und Mentalitäten, beeinflussen die inhaltliche Seite der Diskurse. Im Westen ist er zukunftsorientiert, was mögliche Entwicklungsperspektiven vorzeichnet und die Eigeninitiative der Bürger fördert. In Russland ist er zum großen Teil rückwärts gerichtet, wobei die Wahlkandidaten an den Übeltaten der Gegenpartei oder ihrer einzelnen Mitglieder Kritik ausüben und somit nur wenige positive Lösungen in Aussicht stellen. In der Diskussion wurden die Möglichkeiten zur Erweiterung des Themas gezeigt – beispielsweise politische Karikaturen als perlokutive Wahlkampfmittel in Ost und West zu charakterisieren.
Die Professorin der Staatsuniversität Samara (Russland) Nina Danilova widmete ihren Vortrag dem strategischen Sprachhandeln in elektronischen Informations- und Meinungstexten. Die Referentin meinte, es handle sich um neue Informationstechnologien, die für schriftliche Internetprodukte (Informations- und Meinungstexte) charakteristisch sind. Sie hat elektronische Texte aus der kommunikativ-pragmatischen Perspektive untersucht, wobei im Mittelpunkt der Betrachtung die an den Partner gerichteten Botschaften (Zielsetzungen, Einstellungen, Gefühle) standen. Meinungstexte sind – so die Referentin – dazu berufen, das Verstehen zu manipulieren. Deshalb versuchen die Autoren durch die fiktive Verantwortungsübernahme (strategisches Kommunikationsmodell) oder Solidarität (interaktives Kommunikationsmodell) diese Tatsache zu tarnen. Der Autor versteckt sich hinter der typischen Ausdrucksweise, greift oft zu den Denkmustern, die jedem vertraut sind, und verzichtet quasi auf die eigene Wertschätzung, was den Leser irreführt. Anders sieht es in den Informationstexten aus, die von Anfang an objektiv sind, obwohl die Repräsentation des Referenzfeldes und der Ereignisstruktur sprachliches Handeln des Verfassers deutlich erkennen lässt. Neue Informationstechnologien, deren Ziel es ist, die Information schrittweise anzubieten, erlauben es, den Leser geschickt in eine Informationsfalle zu locken.
In dem Beitrag der Professorin der Interregionalen Akademie für Sozial- und Geisteswissenschaften (Samara, Russland) Marina Kulinich ging es um sekundäre Texte in der interkulturellen Medienkommunikation; und zwar um Digests der westlichen Artikel über die Geschichte und gegenwärtige Entwicklung der russischen Großstadt Samara in der russischen Wochenzeitung “Vlast. Kommersant”. Die Referentin verglich den Digest mit dem Originaltext und stellte den Inhalt der beiden Publikationen zur Diskussion. Die Ungleichheit der Texte wurde durch verschiedene Wahrnehmungserwartungen bestimmt. Für westliche Leser waren sowohl positive als auch negative Informationen von Interesse. Negative Informationen betrafen den Untergang der hölzernen Altstadt. Der russische Digest hatte den Titel „Sie über uns“ und enthielt nur Stellen mit negativer Einschätzung. In der Diskussion kam die gegenseitige Bildung von Stereotypen zur Sprache: im Westen entstehen die Russlandbilder aus eben westlichen Publikationen; in russischen Massenmedien wird betont, dass „sie“ nur Negatives über „uns“ schreiben.
Die Dozentin der Interregionalen Akademie für Sozial- und Geisteswissenschaften (Samara, Russland) Olga Adoevskaja sprach über stereotype Deutschenbilder, die russische Studierende unter dem Einfluss von einheimischen Massenmedien gewinnen. Die Referentin behandelte das Thema aus der Genderperspektive und zeigte die Übertragung der Autostereotype auf die Stereotypenbildung über die Fremden. So wirken immer noch Stereotype über die sowjetische Feminität („arbeitende Mutter“) nach, wenn sich auch Stereotype über neue Maskulinität der Frauen etabliert haben. Die Referentin führte unter den russischen Studierenden eine Befragung durch und systematisierte die Antworten. In den Fragebögen von Frauen und Männern kamen Unterschiede ans Licht. Bemerkenswert war, dass in den männlichen Fragebögen ethisch-moralische Charakteristiken ganz ausfielen. In der Diskussion wurde das als fehlende Moral bei dem männlichen Teil der russischen Gesellschaft ausgewertet – eine Schlussfolgerung, die unter anderem den russischen Massenmedien vorgeworfen werden kann.
Der Beitrag der Doktorantin aus Samara Olga Kolomiytseva war dem Problem des Terrorismus in den deutschen Zeitungen gewidmet. Die Referentin stellte fest, dass sich die Nominierungen von Terroristen in der deutschen Presse unterscheiden. Die in Europa handelnden Terroristen werden in der Bundespresse häufig Amokläufer, Fanatiker, Verrückte, Serienkiller und Massenmörder genannt. Ganz anders steht es um die Terroristen, die an der Geiselnahme im Moskauer Musiktheater an der Dubrowka, am Terroranschlag auf die Schule in Beslan, an mehreren Attentaten in der Moskauer Metro und an anderen zahlreichen gewaltsamen Angriffen schuldig sind. Diese werden Rebellen, Freiheitskämpfer, Widerständler, Gotteskrieger und manchmal sogar Märtyrer genannt. Es entsteht die Frage: Wo bleibt das Solidaritätsgefühl im internationalen Kampf gegen den Terrorismus? Wo bleibt die Verantwortung der Massenmedien, wenn sie die Terroristen rechtfertigen?
In dem Beitrag von Dozentin Tatjana Burdaeva aus Samara handelte es sich um die Expressivität des Fachtextes im interkulturellen Mediendiskurs. Neben der allgemeinen Charakteristik des Fachtextes wurde seine Rolle in der Informationsgesellschaft gezeigt. Durch fachliches Wissen wird die Information in einem interkulturellen Dialog zwischen den Wissenschaftlern – den Vertretern verschiedener Kulturgesellschaften – ausgetauscht, übertragen, verarbeitet. Für die effektive Kommunikation ist dabei die Wahl der sprachlichen Mittel wichtig. Die Referentin zeigte stilistische Änderungen des Fachtextes im Laufe der letzten fünfzig Jahre und schätzte ihre Einwirkung auf das Verständnis dieser Texte von russischen Studierenden.
Der Beitrag der Dozentin aus Samara Olga Makarova behandelte das Problem, ob jedes Kulturdiskurs das Geistige Leben der gegenwärtigen Gesellschaft positiv beeinflussen kann. Die Referentin analysierte Vintagezeitschriften in englischer Sprache aus den 50-er Jahren des 20. Jahrhunderts und ihre Umwandlung in Glanzzeitschriften unserer Zeit. Die Entwicklung der künstlerischen Formen brachte auch die Veränderung des Inhalts mit sich. Wenn die Vintagezeitschriften die Kunst als schöne Art darstellten, bringen die Glanzzeitschriften die Abbildungen von Installationen, die gegen jede Ästhetik sind. Trotz ihrer Glanzform geht in ihnen der ästhetische Schönheitswert verloren. Ob dieser Prozess positiv bewertet werden kann, ist eine große Frage.
Zum Schluss hat die Sektionsleiterin die Sektionsteilnehmer mit virtuellen Beiträgen bekannt gemacht
Im virtuellen Beitrag der Dozentin der staatlichen Universität Ivanovo (Russland) Raisa Babaeva und Karl Hahn aus der Westfälischen Wilhelmsuniversität (Münster, Deutschland) werden Slogans der deutschen und russischen Parteien verglichen. Die Autoren sprechen die Meinung aus, dass sich unter dem Einfluss der Globalisierung in weit voneinander entfernten Teilen der Welt ganz ähnliche Prozesse vollziehen. In verschiedenen Sprachen werden zunehmend für die gleichen Dinge und Ereignisse dieselben Wörter gebraucht, viele von ihnen sind Entlehnungen oder Internationalismen. Neben den einzelnen Wörtern können auch standardisierte Phrasen, die nicht selten sprachliche Zeichen ganzer Situationen darstellen, globalisierte Prozesse widerspiegeln. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten die Massenmedien und vor allem das Internet. Besonders berücksichtigt werden die Slogans, welche nur in einer Sprache vorkommen und eng mit den nationalen Traditionen und Besonderheiten des Landes verbunden sind.
Der virtuelle Beitrag der Dozentin aus Orenburg Anna Antonova behandelt die Manipulierungsstrategien in den Wahlreden der Politiker aus den U.S.A., Großbritannien und Russland, die in elektronischen Medien präsentiert werden. Die Autorin findet, dass diese Strategien ähnlich sind. Die Politiker appellieren an die Instinkte, Basisemotionen und Wahrnehmungsvermögen der Menschen. Dabei verwenden sie verschiedene Taktiken, je nachdem, ob sie einen kurzfristigen oder einen dauerhaften Perlokutionseffekt erreichen wollen.
Der virtuelle Beitrag der Dozentin der Staatsuniversität Samara Ekaterina Bespalova widmet sich dem Funktionieren von Massenmedien in Bezug auf Städtebau. Städtebau bleibt eines der brennendsten Probleme für Städtebewohner, Investoren und Politiker. Für Großstädter ist jedes neue Projekt Veränderung ihres Lebensraums, deswegen wollen sie auf architektonische Gestaltung Einfluss nehmen. Investoren haben oft Profit im Auge. Politiker versuchen sich an der Problematik ein positives Image zu verdienen. Die Massenmedien greifen das spekulative Thema auf, dienen als Diskursraum für Vertreter verschiedener Sehweisen, widerspiegeln Gegebenheiten der Realität, verhelfen zur bestimmten Meinungsbildung. Im Beitrag wird versucht am Beispiel von Projekten in Stuttgart (Bahnhof) und in Moskau (Peter-der-Große-Denkmal) die Reaktionen der Massenmedien zu analysieren. Die interkulturelle Spezifik zeigt sich in unterschiedlicher Bewertung von Projekten in deutschen und russischen Massenmedien.
Der virtuelle Beitrag der Doktorandin aus Samara Olessya Vasheluk ist dem Vergleich der Modalitäten in Nachrichten für die Innen- und Außenrezipienten gewidmet. Dazu wurden die Nachrichten der Fernsehkanale ARD und DW-TV untersucht. Die Autorin stellt fest, dass die Funktion der Massenmedien nicht nur die Widerspiegelung der Realität, sondern auch ihre Interpretation, Erläuterung, Bewertung ist. Die modalen Unterschiede in den analysierten Texten zeigen sich in der Themenauswahl, Repräsentationsart der Themen, sowie im Bewertungsgrad der Aussage und der Auswahl der lexikalischen Einheiten.
Der virtuelle Beitrag der Professorin aus Togliatti Galina Denissova enthält den Vergleich der Bordbücher der Fluggesellschaften „Lufthansa“ und „Aeroflot“. Die Autorin stellt fest, dass der gleiche Themenbestand und der überwiegend positive Ton der Texte in den beiden Bordbüchern in den pragmatischen Aufgaben der Bordbuchtexte Erklärung finden.
In der Abschlussdiskussion haben die Teilnehmer auf die Aktualität der besprochenen Problematik hingewiesen und wichtige Ergebnisse zusammengefasst. Interkultureller Dialog in den Massenmedien der Informationsgesellschaft spielt sich in den Köpfen der Menschen ab, die mindestens zweisprachig sind und den unmittelbaren Zugang zu verschiedenen Informationsquellen in Ost und West haben. Wir haben versucht, diesen virtuellen Prozess zu explizieren und manche Schwerpunkte hervorzuheben.
Perspektiven der weiteren Forschung ergeben sich in folgenden Bereichen:
- Sammlung der Erfahrungen aus der positiven Wirkung der Massenmedien;
- Fallstudien der von Massenmedien angeregten oder gestifteten Problemlösung in verschiedenen Ländern;
- Informationsvergleich in den Bereichen, die nicht behandelt wurden, die aber für die gesellschaftliche Entwicklung – vor allem in Großstädten – von erstrangiger Bedeutung sind (Bildung und Erziehung, Gesundheitswesen, Freizeitgestaltung, Jugend- und Seniorenprobleme u.a.m.).
Inhalt | Table of Contents Nr. 18
For quotation purposes:
Olga Kostrova: Sektionsbericht Interkultureller Dialog im Mediendiskurs der Informationsgesellschaft. –
In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 18/2011.
WWW: http://www.inst.at/trans/18Nr/II-14/sektionsbericht_2-15.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2011-06-21