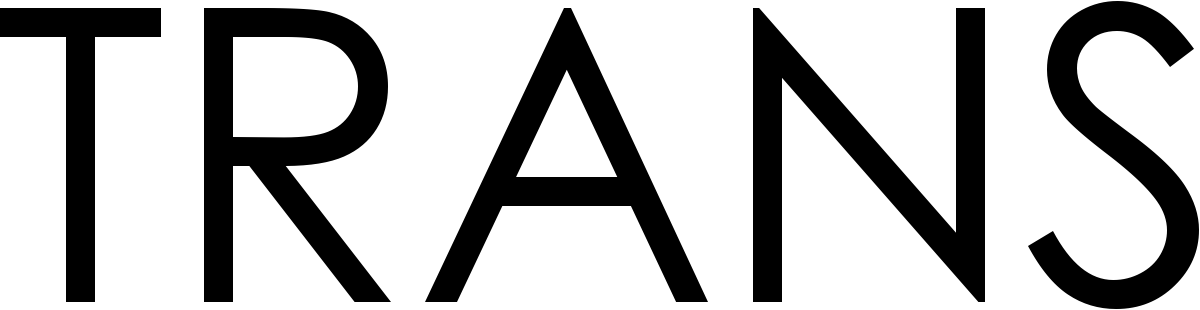Nr. 18 Juni 2011 TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften
Zwei Denkmodelle aus der deutschen Literatur
zur Bewältigung der Kriegskrise:
Seghers’ „Das Siebte Kreuz“ und Koeppens „Der Tod in Rom“ ¹
Abier Omar (Ain Shams Universität, Kairo)
Email: abier_omarhm@yahoo.com
Konferenzdokumentation | Conference publication
Der Krieg hat als ein Motiv in der Literatur seine Aktualität zu jeder Zeit. Heutzutage lebt man in einem Zeitalter voller zwischenstaatlichen Gewalthandlungen und Bürgerkriege. So sind zum Beispiel die Kriege im Kosovo, im Irak, im Libanon und neulich auch in Palästina zu nennen. Es mag sein, dass sich die Beweggründe für den Kriegsausbruch von einem Land zum andern unterscheiden. Was aber am Ende bleibt, sind die gemeinsamen Auswirkungen des Kriegs, die ganze Völker zerstören und den Nachwuchs bedrohen.
Diese Kriegsfolgen sollen deshalb trotz ihres verhassten schrecklichen Bildes durch die Literatur widergespiegelt werden, wodurch ein höherer Bewusstseinsgrad bei den Menschen über die Gefahren dieses Verbrechens erreicht wird. Im Folgenden werden zwei Denkmodelle aus der deutschen Literatur der Exils- und Nachkriegszeit dargestellt, die in ihrer Thematik eine laute Warnung vor dem zu jeder Zeit herrschenden Gefahr des Krieges darlegen und unterschiedliche Auffassungen zur Bewältigung der Kriegskrise zustande bringen.
„Das siebte Kreuz“ (1942) ist ein Exilroman, der von der jüdischen Mainzerin Netty Reilling, die unter dem Pseudonym Anna Seghers bekannt ist, geschrieben wurde. Seghers zählt zu den Exilautorinnen der faschistischen Ära. Die jüdische Herkunft, die aktive Teilnahme an der Aktivität der Kommunistischen Partei und ihre Zugehörigkeit zu der linken Literaturwelt zwangen sie zur Flucht vor der Hitler-Diktatur. Die Flucht der Autorin war keine passive Haltung, sondern ein neuer Weg für die Leistung eines erfolgreichen Widerstands gegen den Nationalsozialismus.
Die Machtergreifung Hitlers verlieh den revolutionären Ideen der Schriftstellerin eine neue Dimension, wobei sie sich auf die Ursachen des Nationalsozialismus und ihre Bekämpfung konzentrierte. Als exilierte Schriftstellerin stellte sie sich die Aufgabe, zu der Zerstörung des Faschismus und der Befreiung des eigenen Landes mit den im Exil verfügbaren Kampfmitteln beizutragen, und die Welt vor der faschistischen Gefahr zu warnen. Die Durchsetzung ihrer Texte mit Begriffen wie „Vaterlandsliebe“, „Volk“, „Menschheit“ und „Individuum“ war eine der Kampfmaßnahmen der Autorin. Die Realisierung dieser Aufgabe gelang ihr durch die Werke, die sie auf ihrer Flucht schrieb.
Als dominantes Motiv tritt die Flucht in erster Linie in den meisten Exilwerken der Autorin zwischen 1933 und 1945 auf und wird zu einer sich wiederholenden typischen Situation, die menschliche Erfahrungen und Erlebnisse in symbolischer Form darstellt. Aus diesem Fluchtmotiv bildet sich der Stoff des Romans „Das siebte Kreuz“. Anna Seghers begegnete auf ihrer Flucht vielen KZ-Flüchtlingen, die ihr von Vorkommnissen in den Konzentrationslagern erzählten. Einer von ihnen berichtete ihr von einer sonderbaren Begebenheit, nämlich von einem Kreuz, an das ein Häftling gebunden wurde, den man kurz nach seiner Flucht wieder gefangen hatte. Das war der Auslöser, der Anna Seghers dazu bewegte, diesen Roman zu schreiben. Die Romanhandlung spielt in einer Zeit, als sich das faschistische System im Inneren des deutschen Volkes gefestigt hatte. Die Arbeitslosigkeit war weitgehend beseitigt und die Lebensverhältnisse hatten sich verbessert. So herrscht scheinbar eine allgemeine Ruhe im ganzen Land. Die andere Seite der Wirklichkeit war jedoch, dass der faschistische Terror die Haltung der Menschen nicht unbeeinflusst ließ, obwohl der blutige Terror sich hinter den Gefängnismauern und in die Konzentrationslagern zurückgezogen hatte. Die scheinbare Ruhe unter der Masse enthält aber einen starken Willen einiger Gesellschaftsgruppen zum Aufruhr(2). Es ist den Widerstandskämpfern aber wegen unterschiedlicher Motive, entgegengesetzter politischer Ziele und unkoordiniertem Vorgehen nicht gelungen, eine effektive Front gegen Hitler zu bilden. Außerdem konnte das Regime die oppositionellen Kräfte durch ein gut funktionierendes Spitzelsystem zerschlagen(3).
Den Widerstandswillen ebenso wie die Widerstandsaktion gegen den Faschismus zeigt die Flucht in dem Roman „Das siebte Kreuz“, da sie als der Auslöser dieser Zustände fungiert, den Alltag der verschiedenen Menschen berührt und die Aktionen und Reaktionen jener darstellt, die die Häftlinge verfolgen, derjenigen, die ihnen helfen und sogar auch derer, die zufällig in das Geschehen hineingezogen werden.
Die Hauptfigur in diesem Roman ist der KZ-Flüchtling Georg Heisler, der eine Bedeutung dadurch erhielt, dass er der einzige Geflohene ist, dem die Flucht gelingt. Daher wird er zu einem Symbol der gelungenen Flucht, die ihrerseits die Ursache für die vielen Wandlungen ist, die allen mit ihm konfrontierten Figuren passieren.
Es hängt wohl mit der Charakterisierung Georgs die Frage zusammen, ob er nach der Flucht aus Deutschland Widerstand leisten wird oder ob es nur um die Rettung seines Lebens geht. Mit dieser Frage hat sich die literaturwissenschaftliche Debatte beschäftigt.
Marcel Reich-Ranicki vertritt die Meinung, dass Georg sein Leben retten, aber die Welt nicht verändern wollte. Tischer unterstützt dieselbe Auffassung Ranickis von der Flucht Heislers. Stephan Alexander führt die Flucht dagegen auf die Abenteuerlust dieser Figur zurück und sieht ihn in seinem Weg ins Exil(4)
weniger von einem ausgeprägten politischen Bewusstsein oder gar einem Parteiauftrag getrieben, als von jener merkwürdigen Abenteuerlust, die Anna Seghers schon in „Aufstand der Fischer von Santa Barbara“ und die „Gefährten“ gestaltet hatte.(5)
Wenden wir uns dem Roman zu, dann stoßen wir auf andere Begebenheiten, die gegen die vorigen Meinungen sprechen. Es ist aus dem Romangeschehen eindeutig zu ersehen, dass die Flucht Georgs aus Deutschland der Gefahr und Bedrohungen des Faschismus entspringt. Dass seine Flucht keinem politischen Auftrag folgt, spricht jedoch nicht gegen die Tatsache, dass sie von einem politischen Bewusstsein geprägt ist. Betrachten wir auch die Aussagen und Überlegungen des Flüchtlings, so können wir diese Meinung belegen.
Nein, Franz, wenn was passiert in Westhofen, dann bin ich nicht tot. (DsK, S.18.)(6)
Diese Aussage kommt in Franz’ – Georgs enger Freund – Erinnerung, als er zum ersten Mal von der Flucht hört und spiegelt indirekt eine verborgene Intention zum Aufbruch.
Es ist auch durch das Verhalten des Geflohenen festzustellen, dass es bei ihm keineswegs um die bloße Rettung des Lebens geht.
Obwohl er geflohen war, um dem sicheren Tod zu entrinnen – kein Zweifel, dass sie ihn und die anderen sechs in den nächsten Tagen zugrunde gerichtet hätten- erschien ihm der Tod im Sumpf ganz einfach und ohne Schrecken. Als sei er ein anderer Tod als der, vor dem er geflohen war, ein Tod in der Wildnis, ganz frei, nicht von Menschenhand. (DsK, S. 20.)
Aus der vorigen Passage lässt sich ein herausfordernder Ton Georgs gegenüber seinen faschistischen Verfolgern spüren, denn derjenige, der sich den freien Tod auswählt, ist doch keiner, der sein Leben retten möchte, sondern ein freier kühner Mensch, der seine Quäler verachtet. Diese verachtende Einstellung Heislers gegenüber dem Feind ist ja ein Ergebnis seines Lebens im KZ.
Der Roman resümiert im novellistischem Vorgang die Konsequenzen der Flucht für die Lagerinsassen:
Ein kleiner Triumph, gewiß, gemessen an unserer Ohnmacht, an unseren Sträflingskleidern. Und doch ein Triumph, der einen die eigene Kraft plötzlich fühlen ließ nach wer weiß wie langer Zeit, jene Kraft, die lang genug taxiert worden war, sogar von uns selbst, als sei sie bloß eine der vielen gewöhnlichen Kräfte der Erde, die man nach Maßen und Zahlen abtaxiert, wo sie doch die einzige Kraft ist, die plötzlich ins Maßlose wachsen kann, ins Unberechenbare. (DsK, S. 7.)
Dieser kleine Triumph bezieht sich hauptsächlich auf die gelungene Flucht des siebten Geflohenen. Diese Flucht hat also eine prägnante, motivierende Funktion, die die Hoffnung innerhalb des Konzentrationslagers auf Veränderung und möglichen Widerstand antreibt. Im Anschluss an dieser Szene endet der Roman mit einer Stelle, die den durch das Fluchtereignis hervorgehobenen Wert der inneren Kräfte der Menschen darstellt:
Wir fühlen alle, wie tief und furchtbar die äußeren Mächte in den Menschen hineingreifen können, bis in sein Innerstes, aber wir fühlten auch, daß es im Innersten etwas gab, was unangreifbar war und unverletzbar. (DsK, S. 380.)
Aus dieser Passage lässt sich erkennen, dass das geglückte Entkommen des Einzelnen sich auf die vielen zurückbezieht, die weiter unter dem Terror der KZ-Männer leiden.
Hier soll die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, dass die Zahl der Flüchtlingen für die Verfolger nicht von großer Bedeutung ist, da das Durchkommen des einen der Zusammenarbeit und der Kooperation anderer Menschen sowohl inner- als auch außerhalb des Konzentrationslagers zu verdanken ist. Deshalb gesteht der Lagerkommandant Fahrenberg in einer der letzten Passagen des Romans ein, dass er nicht hinter einem einzelnen her war, sondern hinter einer unabschätzbaren Macht. (Vgl. DsK, S. 377.)
So kann die Flucht der sieben Häftlinge – vor allem aber auch die gelungene Flucht des Siebten – die Frage nach der Allmacht des Faschismus neu stellen. Zum einen fasst Hermann, einer der KZ-Gefangenen, diese Flucht als „Bresche“, als „ein Zweifel an ihrer Ohnmacht“ auf. (Vgl. DsK, S. 76.)
Zum anderen empfinden die Lagerinsassen, die nichts von dem Fluchtplan wissen, diesen Sieg als einen Irrtum in dem ganzen System, der von den Allmächtigen begangen wird. Sie entlarven durch diese Gesinnung die gespielte Allmacht der Faschisten und entkleiden sie von allen übermenschlichen Zügen, die sie zu Allmächtigen machen. Der Zweifel an der Allmacht des Faschismus schlägt eine Bresche in ihr System, da der Ausbruch aus dem Konzentrationslager diese eingebildete totale Herrschaft in Frage stellt, denn es handelt sich hier um das Scheitern einer ihrer wichtigsten Aufgaben, nämlich die Vernichtung jedes Versuchs zum Widerstand. Es ist aus alle dem zu schließen, dass die Widerstandsleistung durch die Flucht die Intention der Flüchtlinge, die Unterstützung der Gemeinschaft, und den Mut zur Begegnung erfordert. Außerdem führt das Fluchtereignis selbst zur Herausforderung und Verwirrung des Feindes. Diese Voraussetzungen werden zum großen Teil bei der Hauptfigur des „Siebten Kreuzes“ Georg Heisler erfüllt; deshalb drücken seine gelungene Flucht und die daraus entstandenen Konsequenzen einen Widerstand gegen den Nationalsozialismus aus. Seine Flucht wird infolgedessen als Widerstandspotential betrachtet.
Viele Jahre nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus und des Kriegsendes bleibt das Thema „die Bewältigung der faschistischen Vergangenheit und die Warnung vor den Konsequenzen des Krieges der Schwerpunkt in den meisten Werken der Nachkriegszeit.
Wolfgang Koeppen gehört zu den Nachkriegsautoren, denen es gelang, durch sein literarisches Schaffen ein Bild der materiellen sowie seelischen Trümmer im Nachkriegsdeutschland zu schildern. Seine drei Nachkriegsromane „Tauben im Gras“ (1951), „Das Treibhaus“ (1953) und „Der Tod in Rom“ (1954) bilden eine Trilogie, deren Hauptthema „Die Deutschen nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches“(7) ist. Die drei Romane erzählen von der unmittelbaren Gegenwart der Nachkriegszeit.
Der Leser stößt in Koeppens Trilogie auf realistische Bilder bzw. Begebenheiten, die die Gesellschaft der Nachkriegszeit in ihrer Grausamkeit, Finsternis und ihren Trümmern darstellen. Diese wirklichkeitsnahe Darstellung folgt daraus, dass der Schriftsteller seine Romanereignisse aus der Wirklichkeit entnimmt. Darin liegt das schöpferische Vermögen des Autors, der sein literarisches Werk mit dem Alltag seiner Zeit verflochten hat. Wenn Koeppen in einem Gespräch meinte: „Ich komme mir selber sehr oft als eine Romanfigur vor“,(8) dann heißt das, dass er den Roman möglicherweise erlebt, den Tag zu seinem Roman und sich selbst zur Romanfigur gemacht hat. Die Realität der Zeit ist infolgedessen in der Fiktion des literarischen Schaffens Koeppens stark verankert.
In dem dritten und letzten Roman seiner Trilogie „Der Tod in Rom“ übt die Frage der Bewältigung der Nazivergangenheit eine scharfe Kritik an der Kontinuität der Nazis und der weiteren Existenz von Nazianhängern trotz des Endes des Dritten Reiches aus. Dieses Thema wird anhand von zwei faschistischen Familien, die sich in Rom treffen, um einen Konzert zu hören, dargestellt.
Die Romanhandlung zeigt fanatische nazistische Typen, die Eva, die Frau des SS-Generals Judejahn, vertritt. Sie träumt noch immer davon, dass ihr Mann wieder an die Macht kommt. Im Gegensatz zur fanatischen Eva steht die Gestalt der jüdischen Frau Ilse Kürenberg, die von Judejahn am Ende des Romans ermordet wird.
Diese Forschung möchte die Aufmerksamkeit auf die Familie Kürenberg lenken. Ilse Kürenberg ist die Tochter des im Konzentrationslager verstorbenen, jüdischen Kaufmannes Aufhäuser. Sie ist die Ehefrau des berühmten Dirigenten Kürenberg, der die Symphonie Siegfrieds aufführt, dessen Vater Pfaffrath bei den Mutmaßungen zu Aufhäusers Mord teilnahm, die Bitte Kürenbergs um die Entlassung seines jüdischen Schwiegervaters verweigerte und ihm riet, sich von der jüdischen Tochter des Kaufmannes scheiden zu lassen.
Die freiwillige Emigration von Kürenbergs und die vielen Reisen waren die Antwort auf die brutalen Maßnahmen in Deutschland. Sie repräsentieren damit – Momber zufolge – die „bürgerliche Weltaufgeschlossenheit deutscher Intellektueller“(9). Dies beweisen schon die verschiedenen Kochrezepte und Speisen, die sie in verschiedenen Ländern gesammelt und genossen haben.
Im Gegensatz zu der fanatischen Eva Judejahn, die ihr Leben nach der Niederlage in Trauer und Melancholie führt, lebt Ilse mit ihrem Mann trotz der schlechten Erinnerungen an die Vergangenheit in einer gewissen Harmonie und Zufriedenheit. Die beiden liebenden Figuren Ilse und Kürenberg, die in dem Roman fast miteinander identisch geschildert sind, erscheinen im Lauf des Romans ausgeglichen. Nach dem Komponisten Siegfried sind die Kürenbergs
der Mensch, der ich (Siegfried) sein möchte, sie waren sündelos, sie waren der alte und der neue Mensch, sie waren antik und Avantgarde, sie waren vorchristlich und nachchristlich, griechisch-römische Bürger und Flugreisende über den Ozean, sie waren in Körper gesperrt, aber in saubere gekannte und klug unterhaltene Leiber, sie waren Exkursanten, die sich’s in einer vielleicht unwirtlichen Welt wirtlich gemacht hatten und sich des Erdballs freuten. (DTR, 431.)(10)
Trotz der vorigen Schilderung stecken hinter dieser idealisierten Gestaltung Ilses doch Spuren der Verdrängung negativer Gefühle, wie dies weiter aufgedeckt wird. In Ilses Verhalten liegt die Begründung für diese Gefühle, die ihrerseits ihr harmonisches Leben und die Zufriedenheit nur als scheinbar erklären. Es heißt in dem Roman:
Sie hatte aber in ihrem Leben erfahren, daß es besser sei, Leid und Wehmut zu fliehen. Sie wollte nicht leiden. Nicht mehr. Sie hatte genug gelitten. Sie gab Bettlern verhältnismäßig große Summen, aber sie fragte sie nicht, warum sie bettelten. (DTR, S. 403.)
Das Vermeiden, etwas von den Problemen der anderen zu hören, gilt für sich als eine Flucht vor der bestehenden Wirklichkeit. Obwohl Ilse die schmerzhaften Gedanken an den Tod durch die Kunstliebe, die ideale Beziehung zu ihrem Gatten sowie die Weltöffentlichkeit durchzusetzen versucht, kann sie ihm in ihrem Bewusstsein nicht entfliehen
Auch diesen Versuch erläutert der Roman durch die satirische Erzählstrategie des Autors für gescheitert, indem er ein sehr scharfes Kontrastbild schildert, das eben eine gewisse Begrenzung der Heiterkeit von Kürenbergs bezeichnet:
Sie besuchten die Eroten, die Faune, die Götter und die Helden. Sie betrachteten die Ungeheuer der Sage und versonnen den schönen Leib der Venus von Cirene und das Haupt der schlafenden Eumenide. Dann schritten sie in die dämmerige, tief zwischen den hohen Häusern liegende schattenkühle Gasse hinter ihrem Hotel, einer langweiligen Allerweltsherberge, in der sie angenehm wohnten, betraten des Schlächters Laden, sahen an grausamen Haken die hängenden aufgeschnittenen Leiber, blutlos, frisch, kühl, sahen die Köpfe von Schaf und Rind, die Geopferten, sanft und stumm. (DTR, S. 405 f.)
Das Ansehen dieser grausamen Erscheinung beim Metzger nach dem langen Spaziergang zwischen den Zeichen der schönen alten Künste betrachten wir als Vorszene, die den Einbruch der Vergangenheit in Ilses ruhiges Leben vorbereitet. Dieser geschah im Laufe des Romans, als Ilse Judejahn und Pfaffraht im Konzert traf.
Infolge des gescheiterten Versuchs der Todesflucht, wie dies weiter im Laufe des Romans erläutert wird, gilt die Auswahl der Stadt Rom als Aufenthaltsort – Letsch zufolge – für „das Bemühen, nur die heitere Seite des Lebens wahrzunehmen.“(11) Denn Rom bietet dem emigrierten Ehepaar den Genuss der echten klassischen antiken Kunst, die im Nationalsozialismus verfemt und verbannt wurde(12).
Ilses gescheitertem Versuch, der Vergangenheit durch den schönen Genuß des Lebens zu verdrängen, steht die Haltung ihres Mannes entgegen.
Der Leser erfährt ausgeprägte Charakterzüge des berühmten Orchesterleiters anhand seiner Empfindungen von Siegfrieds Symphonie. Schon wirkt die erst ausdrückliche Beschreibung über Kürenberg ambivalent. Es heißt in dem Roman:
Kürenberg wirkte verschlossen, deutender gesagt, fest in sich ruhend und im Geistigen lebend, nie gab er sich ungeduldig und nie sentimental, und doch glaubte Ilse, daß die Förderung, die er Siegfried angedeihen ließ, gefühlsbetont war. (DTR, 404.)
Einen positiven Schritt in den Frieden übernimmt dann der Dirigent Kürenberg in diesem Roman. Seine Leitung für das Musikstück des revolutionären Komponisten Siegfried Pfaffrath betont seine Neigung zur Ersetzung des Friedens in der Welt. Abgesehen von den unharmonischen Klängen und dissonanten Tönen in der Symphonie verehrt Kürenberg die mutige Initiative Siegfrieds, die ihn veranlasst, aus dem Kriegsgefängnis einen Brief zu schicken, um Beispiele der Zwölftonmusik zu erhalten, die zur nationalsozialistischen Zeit verfemt und verboten war. Diese Bereitschaft hält Kürenberg für ein Zeichen, „eine Botschaft aus dem barbarisch gewordenen Europa, die Taube, die sagte, die Flutweiche zurück.“ (DTR, 395, 405.) Diese Haltung mischt Gesinnung und Sentimentalität zusammen. Denn als freiwilliger Emigrant aus dem Nazi-Deutschland und als Langmarkstürmer des ersten Weltkrieges sollte Kürenberg die Bedeutung des Friedens hochschätzen und jedes Friedenszeichen fördern, was seiner gesellschaftlichen Position als Intellektueller entspricht. Anders als seine Frau Ilse empfindet er die Siegfriedische Musik mit einem feinen artistischen Sinn und versucht sie zu besänftigen. Als ein „wissender Zauberer“ geschildert, führt Kürenberg die Symphonie auf und richtet ihre ziellosen Klänge ein.
Er konnte also die dissonante Musik in einen friedlichen, harmonischen Ton einbringen, ein Zeichen, das beweist, dass er mit der Harmonie seines Lebens die Ereignisse der Vergangenheit ersetzt. Und hier unterscheidet er sich von seiner Frau, die sich trotz der scheinbaren Ruhe von der Vergangenheit nicht loslösen kann. Thomas Richner führt eine völlige Gegenmeinung der vorigen Interpretation ein, indem er in Kürenbergs Förderung für die Symphonie eine „reaktionäre Regression“(13) durchschaut. Er geht von dem Rat Kürenbergs für Siegfried aus:
versuchen Sie nie, Wünsche zu erfüllen. Enttäuschen Sie den Abonnenten. Aber enttäuschen Sie aus Demut, nicht aus Hochmut! (DTR, 440.)
Daher hält Richner diese Förderung für widersprüchlich, weil er eine Symphonie dirigiert, die eine „aggressiv-fortschrittliche Komponente enthält“(14), was seiner ruhigen Sachlichkeit und höflichen Strenge entgegensteht. Diese Forschung sieht in der Haltung Kürenbergs eine sachliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, indem er die Aufführung einer Musik akzeptiert, die „geheimen Widerstand, blinzelnde, unterdrückte Gefühle“ ausdrückt. (DTR, 395.) Es handelt sich bei diesem Charakter nicht um die Verdrängung der Vergangenheit, wie es Ilse tut, sondern vielmehr um eine Abrechnung damit und eine Förderung eines neuen Lebens mit neuen Musiktönen und Klängen, die aus dem „Exprimentieren“ (DTR, 440) des Alltags entstammen. All dies sollte die Harmonie seines weiteren Lebens noch bewahren und seinen Charakter ausgeglichen halten, was diese Untersuchung als eine gelungene positive Bewältigung der Vergangenheit betrachtet.
Obwohl in Koeppens Romantrilogie – vor allem in „Der Tod in Rom“ – ein lauter Ton der Angst und Verzweiflung erklingt, lässt der Autor aber auch einen großen Raum für die Hoffnung und den Aufbau einer sicheren Zukunft.
Vorschläge und Möglichkeiten wie Freiheit, Humanität, Unabhängigkeit und Liebe, die zur Gründung einer friedlichen Welt notwendig seien, entwarf Koeppen zwischendurch bei der Schilderung seiner fiktiven Figuren und ihrer Beziehung zueinander. Selbst wenn diese Alternativen phantasievolle Entwürfe wären, dann stehen sie doch in seiner Trilogie als Fragmente für eine mögliche neue Zukunft.
Folgerichtig darf man aus der durchgeführten Auseinandersetzung mit Seghers Roman „Das siebte Kreuz“ und Koeppens Werk „Der Tod in Rom“ herleiten, dass sie zwei verschiedene Denkmodelle zur Vermeidung der Diktatur und des Kriegs darstellen.
Zum einen handelt es sich bei Anna Seghers um den aktiven Widerstand, der das politische Bewusstsein bei den einfachen Menschen erweckt und der die latenten humanistischen Werte sowie auch die politischen Beziehungen zwischen den verschiedenen aktiven gesellschaftlichen Gruppen wieder belebt.
Zum anderen betont Koeppen in seinem Nachkriegsroman die Rolle der Liebe und das Durchführen eines harmonischen Lebens als potentielle Alternative für den Krieg und die Angst. Es ist nicht zu übersehen, dass das Werk Koeppens, wie es der Fall bei Seghers ist, nicht von Widerstandsaktionen befreit ist. Dies kann man deutlich spüren bei der Haltung des Dirigenten Kürenberg sowie auch bei verschiedenen anderen Romanfiguren, die individuelle bzw. persönliche Widerstandsinitiative zu leisten versuchten.
Gemeinsam halten beide Autoren die menschlichen Werte – vor allem die Liebe und das Zusammenleben – für eine effektive Haltung für eine bessere Zukunft ohne Krieg oder diktatorische Herrschaft.
Sekundärliteratur
- Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit (Hg.): Fragen an die deutsche Geschichte: Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart. Historische Ausstellung im Reichstagsgebäude in Berlin, Katalog. Bonn 1986.
- Koeppen, Wolfgang: Gesammelte Werke in sechs Bänden. Hrsg. Von Marcel Reich-Ranicki in Zusammenarbeit mit Dagmar von Briel und Hans-Ulrich Treichel. Bd. 2; Frankfurt am Main 1986.
- Letsch, Felicia: Auseinandersetzung mit der Vergangenheit als Moment der Gegenwartskritik. Die Romane „Billard um halb zehn“ von Heinrich Böll, „Hundejahre“ von Günter Grass, „Der Tod in Rom“ von Wolfgang Koeppen und „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz. In: Hochschulschriften Gesellschafts- und Naturwissenschaften; 118: ser. Literatur und Geschichte. Köln: Pahl-Rugenstein, 1982.
- Momber, Eckhardt: Scheiterendes Gelingen. Zu Wolfgang Koeppen. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. Lili. September 2000. Jahrgang 30, Heft 119. S. 42-49.
- Reich-Ranicki, Marcel: Der Zeuge Koeppen. In: Ulrich Greiner (Hg.): über Wolfgang Koeppen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1976. S. 133–150.
- Richner, Thomas: Der Tod in Rom. Eine existential-psychologische Analyse von Wolfgang Koeppens Roman. Artemis Verlag, Zürich und München 1982.
- Seghers, Anna: Das siebte Kreuz. Philipp Reclam jun. Verlag, Leipzig 1979.
- Spies, Bernhard: Anna Seghers: Das siebte Kreuz. Grundlagen und Gedanken. Zum Verständnis erzählender Literatur. Diesterweg Verlag. Frankfurt a. M. 1993, s. 5. Zitiert nach: Omar, Abier: Flucht als Widerstandspotential bei Anna Seghers unter besonderer Berücksichtigung des Exilromans „Das siebte Kreuz“. Eine Magisterarbeit. Kairo 2000.
- Stephan, Alexander: Die deutsche Exilliteratur 1933–1945. Eine Einführung. München 1979.
Anmerkungen:
1 Dieser Artikel ist eine weitere Überarbeitung einiger Aspekte aus den von mir 2000 und 2009 geschriebenen Magister- und Doktorarbeit über Anna Seghers „Das siebte Kreuz“ und Wolfgang Koeppens Nachkriegstrilogie „Tauben in Grass“, „Das Treibhaus“ und „Der Tod in Rom“. 2 Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus fand gleich nach der Machtergreifung Hitlers statt. Viele sahen in der Emigration den Ausweg, während andere den Widerstand im Inneren geleistet haben. Sie organisierten sich in geheimen Gruppen, die in den ersten Jahren des Regimes vor allem aus Sozialdemokraten, Kommunisten und Männer der Kirche bestanden. Diese Gruppen fanden in den dem totalitären Machtsystem Hitlers und in seinen erkennbaren Kriegsabsichten einen starken Grund für ihren Widerstand (Vgl. Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit (Hg.): Fragen an die deutsche Geschichte: Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart; historische Ausstellung im Reichstagsgebäude in Berlin, Katalog. Bonn 1986, S. 326) 3 Vgl. Ebenda, S. 326 a.a.O. 4 Vgl. Stephan, Alexander: Die deutsche Exilliteratur 1933 – 1945. Eine Einführung. München 1979, S. 120. 5 Ebenda, S. 120 a.a.O. 6 Seghers, Anna: Das siebte Kreuz. Philipp Reclam jun. Verlag, Leipzig 1979. 7 Zit. nach: Reich-Ranicki, Marcel: Der Zeuge Koeppen. In: Ulrich Greiner (Hg.): Über Wolfgang Koeppen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1976, S. 133–150. Hier S. 139. 8 Greiner, Ulrich (Hg.): Über Wolfgang Koeppen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1976, S. 10. 9 Momber, Eckhardt: In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. LiLi., September 2000, Jahrgang 30, Heft 119, S. 36 10Die Bezeichnung (DTR) steht im Text für den Romantitel „Der Tod in Rom“ in: Wolfgang Koeppen: Gesammelte Werke in sechs Bänden. Hrsg. Von Marcel Reich-Ranicki in Zusammenarbeit mit Dagmar von Briel und Hans-Ulrich Treichel, Bd. 2, Frankfurt am Main 1986. 11 Letsch, Felicia: Auseinandersetzung mit der Vergangenheit als Moment der Gegenwartskritik. Die Romane „Billard um halb zehn“ von Heinrich Böll, „Hundejahre“ von Günter Grass, „Der Tod in Rom“ von Wolfgang Koeppen und „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz. In: Hochschulschriften Gesellschafts- und Naturwissenschaften; 118: Ser. Literatur und Geschichte. Köln: Pahl-Rugenstein, 1982, S. 25. 12 An dieser Stelle wäre die Hinweisung auf die „Selektion des Kulturlebens“ in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus bemerkenswert. „Diese Selektion entstammt nicht, so meint Bernhard Spies, aus einer reinen Kunstfeindschaft, sondern aus einem nationalsozialistischen motivierten Interesse an der Kunst, denn der Nationalsozialismus hielt jede künstlerische Äußerung für einen Ausdruck und Pflege der Staatsgesinnung. Daraus ergaben sich auch die Kriterien zur Selektion erwünschter und unerwünschter Kultur.“ (Spies, Bernhard: Anna Seghers: Das siebte Kreuz. Grundlagen und Gedanken. Zum Verständnis erzählender Literatur. Diesterweg Verlag. Frankfurt a. M. 1993, S. 5. Zitiert nach: Omar, Abier: Flucht als Widerstandspotential bei Anna Seghers unter besonderer Berücksichtigung des Exilromans „Das siebte Kreuz“. Eine Magisterarbeit. Kairo 2000, S. 25. 13 Richner, Thomas: Der Tod in Rom. Eine existential-psychologische Analyse von Wolfgang Koeppens Roman. Artemis Verlag, Zürich und München 1982, S. 85 f. 14 Ebenda: S. 86.
Inhalt | Table of Contents Nr. 18
For quotation purposes:
Abier Omar: Zwei Denkmodelle aus der deutschen Literatur zur Bewältigung der Kriegskrise:
Seghers’ „Das Siebte Kreuz“ und Koeppens „Der Tod in Rom“ –
In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 18/2011.
WWW: http://www.inst.at/trans/18Nr/II-15/omar18.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2011-07-08