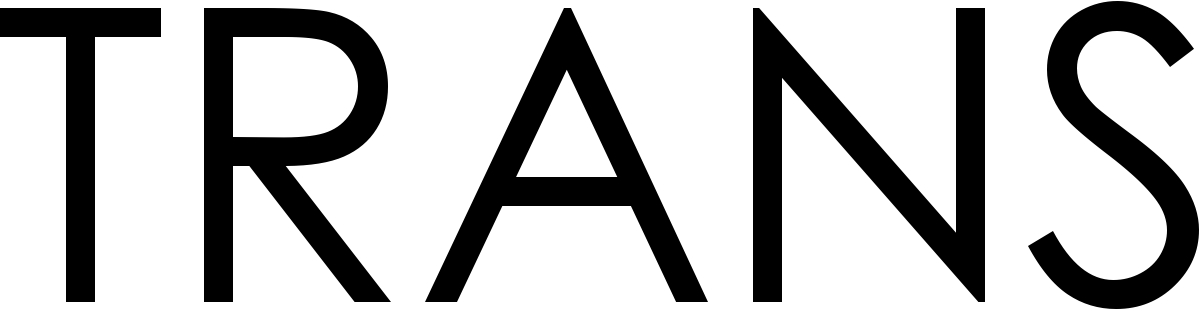Naoji Kimura (Tokyo):
Gesamtdeutsche Periode
Als Auslandsgermanist, der von den deutschen, österreichischen und schweizerischen Forschungsergebnissen viel zu lernen hat, gehe ich bei der genannten Fragestellung davon aus, daß diese Ergebnisse im Laufe der Geschichte bis spätestens zur Moderne eine gesamtdeutsche humanwissenschaftliche Kultur darstellen. Auch in meiner Münchner Studienzeit in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts war der österreichische Kunsthistoriker Hans Sedlmayr (1896-1984), dessen bekannte Werke Verlust der Mitte (1948) sowie Der Tod des Lichtes (1964) ins Japanische übersetzt worden sind, ein Nachfolger des bedeutenden Schweizer Kunsthistorikers Heinrich Wölfflin (1864-1945).
Über den Osten, auch über Ostasien wußten die Europäer in der Goethezeit immerhin sehr viel, wie vor allem aus dem umfangreichen Werk von Peter Kapitza, München: Japan in Europa. Texte und Bilddokumente zur europäischen Japankenntnis von Marco Polo bis Wilhelm von Humboldt. 2 Bde. u. Begleitband. München 1990 hervorgeht. Abgesehen von Marco Polo im 13. Jahrhundert, dessen Reisebeschreibung Goethe 1813 las, gelangte der deutsche Arzt Engelbert Kaempfer (1651-1716) aus Lemgo, Westfalen, Ende des 17. Jahrhunderts über Rußland, Baku, Persien, Indien, Java und Siam schließlich bis nach Japan. Ja, er besuchte schon Grabstätten des Hafis und Saadi in dem lieblichen Schiras von Persien.
1823-1830 hielt sich dann der deutsche Arzt und Naturforscher Philipp Franz von Siebold (1796-1866) aus Würzburg in Japan auf. Zu jener nach außen hermetisch verschlossenen Edo-Zeit durften sie allerdings aus religiösen Gründen angeblich nur als Holländer ins Land eingelassen werden. Denn im Jahre 1641 war die holländische Faktorei von Hirado nach Dejima, Nagasaki, verlegt worden. Holland war die einzige europäische Macht, mit der Japan Handel trieb. 1853 erfolgte erstmals die Ankunft einer amerikanischen Flotte unter Admiral Perry zur Erzwingung eines Handelsvertrags. Als Siebold in den Jahren 1859-1862 wieder nach Japan kam, nahm er seine beiden Söhne auf die Reise mit. Später war Alexander der Ältere bei der Englischen Botschaft und Heinrich der Jüngere bei der Österreichischen Gesandtschaft als Dolmetscher in Edo (Tokyo) tätig. Später hielt dieser den Kontakt mit Wiener Museen aufrecht und wirkte bei der Wiener Weltausstellung von 1873 mit. Dies dürfte eine der ersten diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Japan gewesen sein.
Es war im Jahre 1861, als durch die Preußische Ostasien-Expedition unter Graf zu Eulenburg der Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen den Shognat und Preußen zustande kam. Der Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen Österreich-Ungarn und Japan wurde am 18. Oktober 1869, also erst nach dem Deutschen Krieg abgeschlossen. In diesem Jahr (2019) feiert man offiziell das 150jährige Jubiläum auf beiden Seiten. Die im Jahre 1873 gegründete Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (O.A.G) hat wohl in mancher Hinsicht die drei deutschsprachigen Länder einbezogen, da sie durch die europäischen Alpen naturgeschichtlich miteinander eng verbunden sind. Damals bemühte man sich hier zulande, mit allen Mitteln die westliche, d.h. anglo-amerikanische und europäische Kultur überhaupt einzuführen. Es gibt bereits eine reichhaltige Forschungsliteratur darüber in deutscher und japanischer Sprache, z. B. Peter Pantzer: Japan und Österreich. Fotodokumentation. Die japanisch-österreichischen Beziehungen von 1869 bis zur Gegenwart. Wien 1987.
Außerdem liegt beim Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vor: Gabriele Pauer, Verzeichnis des deutschsprachigen Japan-Schrifttums 1992-1993 nebst Ergänzungen zu den Jahren 1980-1991 (Materialien zur Kultur- und Geistesgeschichte Asiens, Band 4). Diese mit österreichscher Gründlichkeit ausgearbeitete Bibliographie will alle seit 1980 in deutscher Sprache veröffentlichten japanbezogenen Schriften, und zwar sowohl selbständige Publikationen wie Monographien, Sammelwerke, Hochschulschriften, Ausstellungs- und Aukutionskataloge, als auch unselbständige Publikationen, wie Artikel in Periodika und Beiträge zu Sammelwerken möglichst umfassend dokumentieren. Kultur-, Gesellschafts- und wirtschaftswissenschaftliche Werke sind daher ebenso enthalten wie literarische Übersetzungen aus dem Japanischen und populärwissenschaftliche Bücher und Ratgeber sowie Quellen und Literatur aller Art zu Werken, die Japan zum Thema oder als Vorbild haben.
Auf dem Gebiet der geistigen Kultur waren allerdings die deutsche Literatur und Philosophie des 18. Jahrhunderts noch nach der Meiji-Zeit (1868-1912) lange führend, so daß man vor dem Zweiten Weltkrieg den starken Einfluß dieser deutschsprachigen Kultur einfach als deutsch zu bezeichnen pflegte. Der Germanist bedeutet eigentlich auf Japanisch „Deutsch- Literaturwissenschaftler“. So schreibt Sagara Morio, einer der bedeutendsten Germanisten Japans, noch in der Festschrift 100 Jahre Japan – Deutschland (Japanisch-Deutsche Gesellschaft e. V. Tokyo 1961) folgendermaßen: „Man sagt oft, Deutschland sei das Land der Philosophie und der Musik. Es gäbe viel zu denken, wenn wir uns einmal versucht fühlten, es mit dem deutschen Klima in Zusammenhang zu bringen. Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, und Wagners Musikdramen, Schönbergs Zwölftonmusik sogar und noch Hindemith mit seiner neuen Sachlichkeit – das ist die Kette deutscher Musiker, denen die japanischen Musikfreunde aus allen Schichten nach wie vor ihre begeisterte Hingabe schenken.“
Das 1969 erschienene Literaturlexikon Panorama der deutschen Literatur definierte dann eigens in der Einleitung für das japanische Lesepublikum den darin behandelten Umfang der deutschen Dichtung: „Wird im allgemeinen von der deutschen Literatur gesprochen, meint es eine in deutscher Sprache geschriebene Dichtung. Deshalb ist es zu beachten, daß sie nicht eine Literatur einer Naion wie die englische oder amerikanische bezeichnet. Die Nationen mit der deutschen Muttersprache, die sie umfaßt, beziehen sich also auf Westdeutschland, Ostdeutschland, Österreich, Schweiz usw. Aber ihre Staatsgrenzen haben sich oft im Laufe der Geschichte verändert. Daher sind unter den Schriftstellern der sog. deutschen Literatur in der Vergangenheit auch Leute enthalten, die gegenwärtig von der Sovietunion, Polen, Ungarn, Tschechien herstammen.“
Im Jahre 1973 erschien ein einführendes Sammelwerk Deutsche Literatur –Geschichte und Lektüre—für Germanistikstudenten in japanischer Übersetzung. Ihm lag eine beim Horst Erdmann Verlag, Tübingen und Basel, zusammengestellte Ausgabe zugrunde. Es handelte sich dabei grundsätzlich um kurze fragmentarische Erläuterungen einzelner Autoren und ihrer Werke, die selbstverständlich ihre Abstammuung nennen, aber auf die Problematik der deutschen bzw. österreichischen Frage kaum eingehen, zumal Deutschland selbst noch in BRD und DDR geteilt war. Auch in der 1977 erschienenen Deutschen Literaturgeschichte mit dem Autorenkollektiv der jüngeren Generation wurde es für 21 nummerierte Epochenabschnitte sorgfältig vermieden, nicht einmal zur Bezeichnung für die wilhelminische Zeit oder Jahrhundertwende, das Wort deutsch oder österreich zu verwenden.
Vor etlichen Jahren hieß es aber auf der Frankfurter Buchmesse überraschend: „Deutsche Literatur kommt aus Oesterreich“. Damals war der Autor von „Über allen Gipfeln ist Ruh“ in Mode, der angeblich in den einsamen Hochbergen einen Anruf aus Stockholm erwartete. Da mußte man sich erneut überlegen, was eigentlich die österreichische Literatur im Unterschied zur deutschen Literatur bedeutet. Bedienen sich doch die beiden Literaturen einer gleichen Sprache, auch wenn das mittelalterliche Heldenepos Nibelungenlied seinen Anfang im Rhein nimmt und an der Donau in Budapest seinen Abschluß findet, und Walther von der Vogelweide (um 1170-um 1230) seinerzeit von Bozen in Tirol, neuerdings von Feuchtwangen in Franken für einen Geburtsort in Anspruch genommen worden ist. Denn in einer hiesigen Urkunde von 1326 fand man einen Ortsnamen von Vogelweide im Besitz eines Ritters.
Außerdem war es gerade der österreichische Orientalist Joseph Hammer-Purgstall (in Graz geboren am 9. 6. 1774 und gestorben am 23. 11. 1856 in Wien), der durch seine zahlreichen literarhistorischen Arbeiten und Übersetzungen aus dem Türkischen, Persischen und Arabischen entscheidend zur Kenntnis des islamischen Orients in Europa beitrug. Bekanntlich regte besonders seine Übersetzung des „Diwan des Hafis“ (1812) Goethe zum West-östlichen Divan an. 1847-49 war er Präsident der auf seine Anregung hin neu gegründeten Akademie der Wissenschaften. Darüber hinaus waren es Karl Julius Schröer (Preßburg 1825-1900 Wien), Professor für Literatur an der Technischen Hochschule in Wien und sein Schüler Rudolf Steiner, die in der allerersten Zeit der japanischen Goethe-Forschung beeinflußten.
Ost und West sind selbstverständlich ein korrelatives Begriffspaar. Deshalb könnte man Goethe nicht nur aus west-östlicher Perspektive, sondern auch vom japanischen Standpunkt aus ebenfalls ost-westlich betrachten. Freilich kommt der erstere Gesichtspunkt zunächst in Frage, wenn Goethes Begriff der Weltliteratur als solcher wieder einmal in Erinnerung gerufen werden soll. Denn Goethes Idee einer allgemeinen Weltliteratur beruhte hauptsächlich auf der zeitgenössischen europäischen Literatur. Auch wenn er den West-östlichen Divan dichtete, lag dem Werk die Übersetzung von Joseph Hammer zugrunde, die im Unterschied zum Original des persischen Dichters Hafis sprachlich schon als ein Stück deutscher Literatur anzusehen ist, insoweit sie eben in deutscher Sprache wiedergegeben war. Die Geliebte Suleika im Gedichtzyklus, Marianne von Willemer, stammte ja auch aus Linz.
Getrennte Wege nach dem Deutschen Krieg
Das Heilige römische Reich deutscher Nation unter Führung der Habsburger bestand zwar formell bis 1806 – ich wohnte acht Jahre lang in der Donaustadt Regensburg, wo es geschichtlich zugrunde ging – aber ein japanischer Germanist Hiroshi Emura schrieb erst in seinen relativ jungen Jahren energisch die Biographien der Habsburger Herrscher hinter einander: Der letzte Kaiser des Mittelalters. Maximilian I. (Tokkyo 1987), Karl V. Die letzte Glorie des mittelalterlichen Europas (Tokyo 1992), Franz Joseph. Der letzte Kaiser der Habsburger Monarchie (Tokyo 1994) ; Maria Theresia und ihre Zeit (Tokyo 1992) , Die Frauen der Habsburger Kaiserfamilie (Tokyo 1993). Es gibt sonst noch einige Übersetzungen von ihm über die Habsburger.
Übrigens war der erste japanische Forscher, der noch vor dem Krieg, als nur von dem Bündnis Japans mit Deutschland die Rede war, die Erforschung der Habsburger Monarchie geschichtswissenschaftlich in Angriff nahm, Toshitaka Yada, Professor an der Hokkaido- Universität in Sapporo. Er sammelte fleißig eine erstaunlich mannigfaltige Fachliteratur wie im Anhang dokumentiert und hinterließ sie seiner Universität als eine wertvolle Grundlage zu einer gründlichen Österreich-Forschung im Nachkriegs-Japan.
Obwohl damals das Heilige römische Reich deutscher Nation fast vergessen war, fragte sogar Goethe in den Xenien nach diesem gesamtdeutschen Reich: „Deutschland? aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. / Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf.“ Auch das von Luden unter dem 13. Dezember 1813 überlieferte Wort von ihm müßte in diesem Sinne verstanden werden: „Auch liegt mir Deutschland warm am Herzen. Ich habe oft einen bittern Schmerz empfunden bei dem Gedanken an das deutsche Volk, das so achtbar im einzelnen und so miserabel im ganzen ist.“ Als Grillparzer Goethe in Weimar aufsuchte und der Romantiker Friedrich Schlegel nach Wien übersiedelte, hatten sie sicherlich ähnliche Lebensgefühle. Merkwürdigerweise wurde der katholische Dichter Eichendorff wahrscheinlich als Preuße verdächtigt und in Wien abgelehnt.
Ansonsten wird Stefan Zweig (1881-1942) in Ostasien gern gelesen. Davon zeugen das Stefan Zweig-Lesebuch oder seine Biographie von Marie-Antoinette in der chinesischen Übersetzung von Zhang Yushu. Seine größeren Werke, vor allem Joseph Fouché sowie Sternstunden der Menschheit sind in Japan in Einzelausgaben heute noch greifbar, und in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ist eine 19-bändige Gesamtausgabe in japanischer Sprache erschienen. Sie erlebte in wenigen Jahren eine zweite Auflage. Der Wiener Schriftsteller jüdischer Herkunft soll wahrscheinlich der meistübersetzte deutschsprachige Dichter der Zwischenkriegszeit gewesen sein. Aber offen gestanden fürchte ich, daß er heute zumindest unter japanischen Germanisten als ein Dichter von Gestern gilt. Wie so oft, ist ihre Energie auf dem Höhepunkt ihres etwas verspäteten Einsatzes für einen großen Schriftsteller fast erschöpft. Abgesehen von Rilke und Kafka sind zur Zeit Robert Musil und Ingeborg Bachmann, beide aus Klagenfurt, unter den österreichischen Autoren der Gegenwart am gefeiertsten. Früher stand in Japan Hermann Broch hoch an Ansehen, Peter Handke jedoch noch nicht.
Um die österreichische Frage zwischen dem Mittelalter und der Gegenwart zur Kenntnis zu nehmen, scheint es mir am besten zu sein, das von J. W. Nagl / J. Zeidler / E. Castle herausgegebene umfangreiche Standard-Werk Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte (2 Bde., Wien-Leipzig 1898) nachzuschlagen. Aufschlußreich sind vor allem die in der Einführung zitierten einleitenden Worte, mit denen die Herausgeber im April 1896 ihren detaillierten Plan an die vorgesehenen Mitarbeiter ausgesandt haben. Zuerst wird der gesamtdeutsche Gesichtspunkt hervorgehoben, wofür der Stephansdom in Wien ein Symbol abgibt. Denn er bekam den Namen von der dem Erzmärtyrer St. Stephan geweihten Kathedrale in Passau her, erst als die Diozöse Wien im Jahre 1480 selbständig wurde:
„Die gemeindeutsche Literatur ist das Product aller Stämme und Staaten, aus denen sich das große deutsche Volk zusammensetzt. Jede deutsche Landschaft hat sozusagen ihre Localfarbe beigegeben zum Zustandekommen des Gesammtgemäldes. Goethe und Schiller wurzeln eben so gut in Franken und Schwaben, wie Heinrich von Kleist in Preußen oder Franz Grillparzer in Österreich. Jedes Werk der Kunstdichtung enthält, wenn auch noch so zarte, Spuren der Bodenständigkeit seines Autors und erhält häufig gerade dadurch seine charakteristische Färbung. Die eigenthümliche Farbenmischung unserer Kunstdichtung ist nur richtig zu verstehen, wenn wir erkennen, welche Züge seines Wesens jeder einzelne deutsche Stamm dazu beigetragen hat. Darin liegt Wert und Berechtigung landschaftlicher Literaturgeschichte; ja die Localforschung wird noch lange an der Durcharbeitung der Regesten des geistigen Lebens der einzelnen Landschaften zu thun haben, bis wirkliche eine allgemeine deutsche Literaturgeschichte zustande kommen kann, welche nicht nur Dichtungs-, sondern auch Culturgeschichte ist. Gilt dies vom literarischen Leben aller deutschen Gaue, so gilt es umsomehr von jenen Theilen, welche durch ihre geschichtliche Entwicklung einen eigenen Bildungsweg, oft ganz abgesondert von dem Deutschlands, genommen haben: wie etwa die Schweiz oder die deutschen Länder, welche heute der österreichisch-ungarischen Monarchie angehören.
Die besonderen Geschicke, welche die Länder, die sich nach und nach um das alte ‚Ostarrich’ zum heutigen Kaiserthum gruppierten, durchzumachen hatten, haben der Volksseele ihrer Bewohner ganz eigenthümliche Charakterzüge aufgeprägt, welche sich in den Erzeugnissen der Literatur dieser Gebiete äußern. Niemand wird leugnen, daß der Norddeutsche der Dichtung Altösterreichs, die in Grillparzer und Raimund ihren classischen Ausdruck gefunden hat, befremdet gegenübersteht: so lange er die historischen Elemente nicht kennt, aus welchen sich die ganz eigenartige Weltauffassung zusammensetzt, die aus den Werken dieser Dichter uns entgegentönt.“
Zu diesem Zitat läßt sich zunächst einmal bemerken, daß in der japanischen Germanistik außer bei den Sprachforschern grundsätzlich nur „Kunstdichtung“ in Frage kommt. So hat es schon einige Leute gegeben, die sich mit Franz Grillparzer intensiv beschäftigten, aber kaum jemand, der sich speziell für Ferdinand Raimund literarisch interessiert hätte. Im Zusammenhang mit Josef Nadlers Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften (1912-28, 4 Bde., 1938-41 unter dem Titel Literaturgeschichte des deutschen Volkes) wurde vielmehr die österreichische Heimatdichtung seit dem steirischen Wald- und Gebirgsdichter Peter Rosegger (1843-1918) der großstädtischen Asphaltliteratur wie Berlin gegenübergestellt. Sie entartete aber in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu einer literaturgeschichtlichen Beschreibung der volkhaften Dichter ostmärkischer Herkunft. In Hermann Schäfers Buch Deutsche Dichter der Gegenwart. Ihr Leben und ihre Werke (Tokyo 1944) sind etwa angegeben: Richard Billinger, Graf Anton Bossi-Fedrigotti, Bruno Brehm, Franz Karl Ginzkey, Mirko Jelusich, Hans Kloepfer, Erwin Guido Kolbenheyer, Max Mell, Karl von Möller, Hubert Mumelter, Franz Nabl, Josef Georg Oberkofler, Josef Friedrich Perkonig, Erwin H. Rainalter, Franz Tummler, Karl Heinrich Waggerl, Josef Weinheber, Josef Wenter.
Was die österreichisch-ungarische Monarchie angeht, erstreckt sie sich nach Raimund Friedrich Kaindls Buch Oesterreich, Preußen, Deutschland. Deutsche Geschichte in großdeutscher Beleuchtung (Wien 1926) vor dem Zweiten Weltkrieg noch bis zu den Grenzgebieten in Siebenbürgen. Aber machtpolitische Auseinandersetzungen um Groß- oder Kleideutschland sind unter den japanischen Germanisten im allgemeinen wenig bekannt. Sie denken ja vorzüglich sprachlich, literarisch, höchstens kulturgeschichtlich. Sie gruppieren sich deshalb von Anfang an um die drei deutschsprachigen mitteleuropäischen Staaten – die frühere DDR bereitete ihnen viel Kopfzerbrechen — und beschränken sich in Forschung und Lehre auf deren Staatsgrenzen im engeren Sinne, also nicht einmal nach Ungarn hinüber, wofür andere Philologen und Literaturhistoriker zuständig sind. Ausnahmsweise gibt es nur wenige, die sich für die deutschsprachige Bukowina-Literatur mit den repräsentativen Schriftstellern spezialisieren: Alfred Margul-Sperber, Rose Ausländer, Moses Rosenkranz, Alfred Kittner und Paul Celan mit einer umfangreichen Sekundärliteratur.
Die Zeit der Moderne
Jede historische Epoche hat ihre Vorgeschichte, wie immer sie auch heißen mag. So hat denn auch die Wiener Moderne meiner Meinung nach einen Aspekt ihrer komplexen Vorgeschichte in den Anfängen der Goethe-Philologie, wie sie in Wien entstanden war. Unter der Moderne als Epochenbegriff in der deutschen Literaturgeschichte verstehe ich formal die Literatur der Jahrhundertwende und unterscheide die von Gotthart Wunberg definierte Wiener Moderne (1890-1910) nach den verschiedenen politisch-soziokulturellen Bedingungen von der durch Jürgen Schutte und Peter Sprengel abgesteckten Berliner Moderne (1885-1914). Zudem wäre auch noch die Literatur der Münchner oder Prager Moderne zu berücksichtigen. Aber wohin gehört Rainer Maria Rilke, der nicht nur in St. Pölten, sondern auch in München und in der Schweiz lebte?
Wie Moritz Csáky in seinem Beitrag „Die Wiener Moderne“ im Sammelband: Rudolf Haller (Hg.), Nach Kakanien. Annäherung an die Moderne (Wien/Köln/Weimar 1996) hervorhebt, hatte „bereits in den neunziger Jahren [des 19. Jahrhunderts] Hermann Bahr in seiner Rezension der Nagl’ schen Deutschösterreichischen Literaturgeschichte sich dagegen verwahrt, die deutschsprachigen Literaturen der Monarchie als deutsche Literatur zu bezeichnen und leitete damit die Wiener Moderne im engeren Sinne mit ein. Erschienen sind bisher in Japan außer einer vierbändigen Reihe europäischer Jugendstile Werkausgaben von Adalbert Stifter, Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus usw., weil sie nicht zuletzt auch enge literarhistorische Beziehungen zu Goethe aufzuweisen hatten. Von Stefan Zweig als Goethe-Verehrer gibt es, wie gesagt, aus den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts sogar eine 19bändige Gesamtausgabe in japanischer Sprache.
Nach der obengenannten Literaturgeschichte von Nagl und Zeidler bildet Grillparzer einen Wendepunkt in der Entwicklung der österreichischen Literatur: „Der Name Grillparzer wurde seitdem (des Dichters Leichenzug) Inbegriff österreichischer Dichtung für die heranwachsende Generation (…) Von hier aus setzte die Grillparzerforschung ein, und von ihr aus wuchs nach und nach das Interesse für andere Erscheinungen der Literatur Deutsch-Österreichs.“ Die Anzeichen für diese neuen Erscheinungen gab es freilich schon im Vormärz, die aber entweder als Junges Deutschland oder als Biedermeierzeit die literarischen Interessen japanischer Germanisten gespalten haben. Die politisch engagierten Forscher beschäftigten sich hauptsächlich mit Heine sowie Börne und haben meist mit der Literaturwissenschaft der DDR sympathisiert. Die andere Gruppe der selbst biedermeierlich eingestellten Forscher, die mit der idealistischen Klassik allein oder der überholten deutschen Romantik überdrüssig waren, fand aber im Realismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine große Forschungslücke. So bildeten sie als Epigonen im Sinne Karl Immermanns (1796-1840) eine neue Gruppe zur Erforschung der Literatur des 19. Jahrhunderts. Eine stille Stifter-Gemeinde stellte dabei eine Sondergruppe dar. Stifter war für sie nicht nur als Dichter des böhmischen Waldes anstelle der verloren gegangenen goethischen Naturfrömmigkeit bedeutsam, sondern wurde von ihr auch als Dichter der christlich-humanistischen Ehrfurcht vor den einfachen Dingen entdeckt.
Unterdessen brach in Österreich tatsächlich um 1848 eine neue nüchterne Literaturepoche auf, in der Altösterreich verschwunden war und, von der jedoch meist nur noch die alte klischeehafte Vorstellung des fröhlichen Lebens im Heurigenlokal mit Wein und Gesang beim Lesepublikum in Japan verbreitet ist. Glücklicherweise wurde jene reale Zeitsituation durch einen japanischen Soziologen Chikara Rachi in seinem reich bebilderten Buch Orgien an der blauen Donau. Wien 1848 (Tokyo 1985) ausführlich geschildert. Aber jetzt kommen für die japanischen Germanisten in Tokyo anders als der Berliner Expressionismus für Kyoto-Leute, die tiefenpsychologische Zeit von Sigmund Freud (1856-1939) sowie die Wiener Jahrhundertwende allmählich heran, für die sie sich mit dem Münchner Jugendstil zusammen als Moderne schlechthin außerordentlich interessieren. Der Begründer der Psychoanalyse war seit 1902 Professor in Wien. Wie er 1938 nach England ins Exil gehen mußte, entziehen sich nähere Einzelheiten leider meiner Kenntnis. Sein Rivale Carl G. Jung ist zwar in Japan ebenso bekannt – primär mit seiner Symbolforschung -, aber ich meine, Freuds Einfluß ist durch viele Übersetzungen in japanischer oder chinesischer Sprache viel größer.
Im Hinblick auf die Wiener Moderne ist richtungsweisend zum Beispiel die Feststellung eines Hermann Broch, der in seiner 1971 ins Japanische übersetzten Studie Hofmannsthal und seine Zeit die Wesensart einer Periode vornehmlich an ihrer architektonischen Fassade ablas: “die ist für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, (also für die Periode, in die des Dichters Geburt fällt), wohl eine der erbärmlichsten der Weltgeschichte.” Es sei die Periode des Eklektizismus gewesen, die des falschen Barocks, der falschen Renaissance, der falschen Gotik. Ferner heißt es: “Wo immer damals der abendländische Mensch den Lebensstil bestimmte, da wurde dieser zu bürgerlicher Einengung und zugleich zum bürgerlichen Pomp, zu einer Solidität, die ebensowohl Stickigkeit wie Sicherheit bedeutete. Wenn je Armut durch Reichtum überdeckt wurde, hier geschah es.” Angesichts dieser Hinweise kann man nicht umhin, an die Wiener Ringstraße zu denken, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von den Prachtbauten historischen Baustils umgeben wurde. Aber offen gestanden, wie sähe Wien heute mit der Kärntnerstraße allein aus?
Dabei erweist sich die japanische Übersetzung insofern als problematisch, als das Adjektiv “falsch” zu Barock, Renaissance und Gotik in sprachlicher Anlehnung an den Klassizismus wie Barockismus wiedergegeben, das Substantiv “Pomp” mit dem Beiwort “leer” bzw. “eitel” versehen und das Wort “Solidität” als “Solidarität” mißverstanden wurde. Außerdem wurden Armut als Armut an Gehalt und Reichtum als Reichtum an Außen interpretierend übersetzt. So dürfte die ganze Übersetzung bei kritischer Sprachbetrachtung weitergehen. Es ist aber hier nicht der Ort, auf die Übersetzungsfragen einzugehen.
Wenn die Zeit Hofmannsthals in dieser Weise als “eine der erbärmlichsten der Weltgeschichte” dargestellt hat, so muß auf der anderen Seite der geistige Versuch der jüngeren Generation, dagegen zu protestieren und sie durch eine innere Revolution zu überwinden, für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts kennzeichnend gewesen sein. Hermann Broch formuliert den Sachverhalt wie folgt: “Es geht um Verleugnung hinter ‘Dekoration’.” Zur Überwindung der Zeitkrise gibt es aber auch eine von Hofmannsthal so genannte konservative Revolution, die meist von dem Bildungsbürgertum der älteren Generation getragen wird.
Zu den Einzelheiten über den geschichtlichen Überblick bei Hermann Broch steht das bedeutende Werk Carl E. Schorskes Fin-de-siecle Vienna. Politics and Culture schon seit 1983 dem japanischen Lesepublikum in guter Übersetzung zur Verfügung. Da das Interesse der japanischen Gebildeten an Fin-de-siecle seit Jahren sehr groß ist, wurden übrigens auch William M. Johnstons The Austrian Mind. A Intellectual and Social Historiy 1848-1938 im Jahre 1986, Claudio Magris‘ Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur im Jahre 1990, sowie Die Belle Epoque von Willy Haas im Jahre 1985 ins Japanische übersetzt. Als ausgesprochene Literaturgeschichte wurde erstmals 1983 Ernst Joseph Görlich: Einführung in die Geschichte der österreichischen Literatur, Wien 1983 (im Anhang Hellmut Himmel: Die österreichische Literatur seit 1918) übersetzt. Anläßlich einer großen Kunstausstellung mit Klimt und Egon Schiele in Tokyo (Österreich und Japan 120) wurde übrigens der stattliche Bildband Wien um 1900. Klimt, Schiele und ihre Zeit vom Sezon-Museum herausgegeben, und zwar mit verschiedenen Beiträgen über die gesamte österreichische Kultur und mit einem Kapitel „Japonismus und österreichisch-japanische Beziehungen“. Dabei fand im Jahre 1990 auch an der Sophia-Universität, Tokyo, ein Symposium über die Wiener Kultur um die Jahrhundertwende statt, dessen Dokumentationsband von mir als dem Organisator herausgegeben worden ist. Er enthielt die nachstehend genannten Beiträge:
Yoshio Koshina: Kulturelles Pathos der Literatur der Jahrhundertwende
Yasusada Yawata: Schicksal der Ideen – Schicksal der Stadt
Ludwig Armbruster: Religös-ideelle Situation im Wien der Jahrhundertwende–
Herkunft von uns Österreichern
Akira Noda: Freud und Wien
Tetsuo Ito: Zur Entstehung der modernen Baukunst im Wien der Jahrhundertwende
Atsushi Tanigawa: Die Kunst im Wien der Jahrhundertwende oder Die Schlange Klimts
Hideki Tanabe: Jahrhundertwende der fröhlichen Musen — Operetten und Lokale in der Jahrhundertwende
Takao Suzuki: Schattenseite Wiens um die Jahrhundertwende
Gabriele Andreae: Die von Schnitzler dargestellten Frauen
Naoji Kimura: Goethe-Renaissance in Wien
In Japan sind es also nicht nur Germanisten, sondern auch viele andere Wien-Liebhaber, die sich jeweils aus einer anderen Fachrichtung mit der österreichischen Kultur beschäftigen. So haben sich im Jahre 2010 eine Reihe Germanisten, Romanisten, Journalisten, Baugeschichtler und Musikwissenschaftler wieder zusammengesetzt, um mit einer neuen Perspektive einen Sammelband Wien – Fuga des multikulturellen Volkes auszuarbeiten. Er enthielt in der Tat die folgenden Beiträge mit neuartigen Themenaufstellungen. Gefehlt hätte nur noch ein philosophisches Thema mit etwa Ludwig Wittgenstein (1889-1951) und dem Wiener Kreis, der eine 1922/36 in Wien tätige Philosophenschule des Neu-Positivismus bildete:
Masahiko Kato: Die Stadt des multikulturellen Volkes
Tetsuo Ito: Stadtraum und Baukunst in Wien
Takao Aeba: Wiener Barock—seine Gestalt und Denken
Masayasu Komiya: Das Geheimnis der Musikstadt Wien
Minoru Nishihara: Theaterstadt Wien und die Welt der Opern—Zur Bildung der Singspiel-Kultur
Tetsuhiko Hiyama: Interdisziplinäre Stadt Wien
Tatsuji Hirata: Licht und Schatten der Kulturmetropole Wien
Anders als in der Literatur und Musik ist allerdings in der schönen Kunst eine rückwärtsgewandte Tendenz bemerkbar, die dem japanischen Schönheitsinn für Klimt entgegenkommt. In den Jahren 1992 sowie 1998 fanden mindestens noch zwei Kunstausstellungen statt, und entsprechende schöne Kataloge kamen heraus: Der Glanz des Hauses Habsburg (Tobu Museum of Art): (Geschichte der fünf prachtvollen hapsburgischen Königinnen (unter Mitwirkung des Wiener Kunsthistorischem Museum). Soziale Fragen wie im sog. Josephinismus oder religiöse Fragen wie Auseinandersetzungen um die Jesuiten interessieren im allgemeinen das japanische Publikum nicht.
Eine konservative Goethe-Verehrung in Wien
Auf der anderen Seite war eine der fortschrittlichen Wiener Moderne entgegengesetzte Literaturbewegung – wohl als eine konservative Revolution anzusprechen – bemerkbar. Es handelte sich dabei um Schröers, des Lehrers Rudolf Steiners, Bemühungen um die literarische Bildung der Schuljugend in Budapest. So gab er z.B. Geschichte der deutschen Literatur. Ein Lehr- und Lesebuch für Schule und Haus (Pest 1853) heraus. Um ihm dafür zu danken, publizierte ein gewisser Robert Zilchert sogar Jahrzehnte später eine Gedenkschrift: “Den Manen weiland Tobias Gottfried Schröers (Chr. Oeser) und weiland Karl Julius Schröers in dankbarem Gedenken geweiht” Goethe “Wehe der Nachkommenschaft, die Dich verkennt!” Ein Bekenntnis (Gießen / Leipzig 1932). Durch diese Widmung stellt sich übrigens heraus, daß mit Chr. Oesers Briefen über die Hauptgegenstände der Aesthetik, die Adalbert Svoboda 1888 in neuer Auflage herausgab, das Werk von Schröers Vater gemeint war.
Rudolf Steiner selbst wurde auf Schröers Empfehlung hin 1884 von Joseph Kürschner eingeladen, innerhalb der von ihm veranstalteten „Deutschen Nationalliteratur“ Goethes naturwissenschaftliche Schriften mit Einleitungen und fortlaufenden Erläuterungen herauszugeben. Schröer versah denn auch den ersten der von ihm besorgten Bände mit einem einführenden Vorwort. Er setzte darin auseinander, wie Goethe als Dichter und Denker innerhalb des neuzeitlichen Geisteslebens stehe. Es versteht sich von selbst, daß er in der Weltanschauung, die das auf Goethe folgende Zeitalter gebracht hatte, einen Abfall von der durch Goethe erreichten geistigen Höhe sah.
Als sein geschätzter und geliebter Schüler bald darauf im Salon einer mondänen Dichterin öfter zu verkehren begann, mußte er jedoch rigoros von seinem Lehrer Abschied nehmen. Steiner beschrieb seine schmerzliche Betroffenheit und stellte angesichts des Generationswechsels in Wien einen tiefgreifenden Gegensatz nicht nur in der Goetheauffassung, sondern auch im Lebensgefühl fest: „Schröer konnte in leidenschaftliche Erregung kommen, wenn er eine Versündigung gegen die als Schönheit wirkende Harmonie in der Kunst wahrnahm. Er wandte sich von (Marie Eugenie) delle Grazie ab, als er diese Versündigung nach seiner Auffassung bemerken mußte. Und er betrachtete bei mir die Bewunderung, die ich für die Dichterin behielt, als einen Abfall von ihm und von Goethe zugleich.“
Steiner mußte nach einigen Jahren Wien verlassen, da er aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistungen mit der Edition der naturwissenschaftlichen Schriften in der Weimarer Sophienausgabe beauftragt wurde: „In diese Zeit (1888) fällt meine erste Reise nach Deutschland. Sie ist veranlaßt worden durch die Einladung zur Mitarbeiterschaft an der Weimarer Goethe-Ausgabe, die im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen durch das Goethe-Archiv besorgt wurde. Einige Jahre vorher war Goethes Enkel, Walther von Goethe, gestorben; er hatte Goethes handschriftlichen Nachlaß der Großherzogin als Erbe übermacht. Diese hatte damit das Goethe-Archiv begründet und im Verein mit einer Anzahl von Goethe-Kennern, an deren Spitze Herman Grimm, Gustav von Loeper und Wilhelm Scherer standen, beschlossen, eine Goethe-Ausgabe zu veranstalten, in der das von Goethe Bekannte mit dem noch unveröffentlichten Nachlaß vereinigt werden sollte.“ Aber seine Pionierarbeit in der Kürschner’schen Deutschen Nationalliteratur gehört zweifellos zu den Anfängen der Goethe-Philologie in Wien. Ohne einfacher Goethephilologe zu bleiben, entwickelte er sich schließlich zu einem Theosophen und Anthroposophen goethischen Gepräges, was mir jedoch wiederum für die Wiener Moderne spricht. Steiners Einfluß ist in Japan so groß, daß fast alle seine Werke einschließlich seiner Kommentare zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften ins Japanische übersetzt worden sind.
Das Hauptziel, das sich der von Schröer angeregte Wiener Goethe-Verein setzte, bestand darin, ein Goethe-Denkmal für Wien zu errichten. Es war ein seelisches Bedürfnis des bürgerlichen Zeitalters, das geistige Vorbild in monumentaler Größe sichtbar anzuschauen. Um dieses Ziel in absehbarer Zeit erreichen zu können, wies Schröer immer wieder auf die Bedeutung Goethes und Schillers für das deutsche Volk und über die Grenzen des deutschen Volkstums hinaus hin. Er ging dabei von der Annahme aus, die Popularität Schillers sei bei dem deutschen Volk immer noch die größere. Dementsprechend nahte sich das Schiller-Denkmal vor der Wiener Akademie der bildenden Künste damals schon seiner Vollendung. Es ist typisch für die Zeitströmung nach dem Scheitern der März-Revolution 1848, daß Schiller immer als deutscher Nationaldichter in den Vordergrund gestellt wurde.
Alle kulturellen Veranstaltungen des Vereins zielten deshalb darauf aus, das Verständnis für Goethe zu vertiefen und so eine Schiller ebenbürtige Verehrung für Goethe zu erwecken. Da aber die Idee des Zusammenwirkens beider als Höhepunkt deutscher Kultur schon im Weimarer Denkmal von Ernst Rietschel ausgesprochen war, scheute man sich den schönen Gedanken der Dioskuren zu wiederholen. Statt dessen sollte Goethes Universalität, wie Schiller sie als der erste erkannt hatte, sichtbar gemacht werden. So sollte diese Bedeutung Goethes ursprünglich durch sein Standbild neben der Universität ausgesprochen werden. Seine Beziehung zur Dichtkunst hätte hinreichend angedeutet werden können durch das Burgtheater, das schräg dem Denkmal gegenüber stehen würde. Mit der Betonung von Goethes Universalität sollte wahrscheinlich der Verdacht einer nationalistischen Bewegung wie beim Schiller-Denkmal vermieden werden.
Als der Standort des geplanten Goethe-Denkmals 1894 für die Ecke des Opernrings entschieden wurde, zog sich Schröer von dem ganzen Projekt zurück und bedauerte die seiner Gesinnung entgegengesetzte Kunstentwicklung in Wien: “Wir wissen wol, dass die stürmische Jugend, die immer Neues will, vielfach anderen Zielen zustrebt, als unsere Ideale, z.B.: in der Kunst dem sogenannten Naturalismus. Darüber vergisst die Welt, was das Auftreten Goethes bedeutet. Ruhig lässt man den üblichen Ausspruch gelten, dass die Werke unserer Klassiker für die Ewigkeit sind: indem doch der Fortschrittsdrang der Jugend sie nicht verhindert, Goethes und Schillers noch unerreichte Werke veraltet zu finden!” Mit dieser konservativen Ansicht hätte er vermutlich wenig Verständnis für die bald heraufkommende literarische Moderne in Wien aufgebracht, wenngleich Hermann Bahr ebenso den Berliner Naturalismus zu überwinden suchte. Denn wie Gotthart Wunberg hervorhob, wollten die Jung-Wiener zuerst als Realisten und Naturalisten beginnen.
Nebenbei bemerkt: Die Chronik des Wiener Goethe-Vereins brachte in 4. Jg. / Nr. 5 vom 18. Mai 1889 nach dem Auslandsbericht der Allgemeinen Zeitung einen interessanten Artikel “Goethe und Schiller in Japan”, in Japan erscheine eine Monatsschrift Von West nach Ost in deutscher Sprache. Das bereits erschienene Heft enthalte außer dem Vorwort “Was wir wollen” eine Abhandlung von Dr. med. Rintaro Mori über das japanische Haus vom ethnographischen und hygienischen Standpunkt aus und eine andere von Dr. Kitao über die Spectralanalyse. Sodann soll eine Anzahl von Preisaufgaben, Übersetzungen berühmter Stücke aus der japanischen Literatur ins Deutsche für strebsame japanische Studenten ausgeschrieben worden sein.
Der Mediziner Rintaro Mori mit dem Dichternamen Mori Ogai war sprachlich sehr begabt und begann nach seinem vierjährigen Deutschlandaufenthalt tatsächlich im Jahre 1889 viele zeitgenössische Werke der deutschen Literatur ins Japanische zu übersetzen. Darunter befanden sich auch Werke der literarischen Moderne in Wien. Es handelte sich dabei um die Werke wie Schnitzlers Dämmerseelen, Der Tod des Junggesellen, Die Frau mit dem Dolche, Der tapfere Cassian, Weihnachtseinkäufe, Liebelei; Hofmannsthals Der Tor und der Tod, Ödipus und die Sphinx; Peter Altenbergs See-Ufer; Zwölf; Hermann Bahrs Die tiefe Nacht. Wie damals in Japan die Wiener Musik als deutsche Musik schlechthin galt, machte man zu jener Zeit keinen wesentlichen Unterschied zwischen deutscher und österreichischer Literatur. Für japanische Germanisten gehören Schriftsteller wie Hugo von Hofmannsthal, Hermann Broch oder Robert Musil nicht nur der deutschen, sondern auch der europäischen Literatur, ja der Weltliteratur an, und keinem von ihnen fällt es ein, sie in die eng begrenzte österreichische Literaturgeschichte einzuordnen. Faszinierend und attraktiv für sie ist gerade, daß die Wiener Moderne im Zeitalter des Nationalismus so international eingestellt war.
Was die Bezeichnung Wiener Moderne anbelangt, so müßte man zuerst nach der Bedeutung von “modern” überhaupt fragen. Denn Goethe gebraucht das Wort schon oft beinahe im Sinne von “romantisch” im Hinblick auf die jungen Dichter und Künstler um die Jahrhundertwende am Ende des 18. Jahrhunderts. Die deutsche Literatur von damals hatte das klassische oder klassizistische Weimar von Goethe und Schiller gleichsam als einen stillen Mittelpunkt, um den die jungen Romantiker in Jena, Heidelberg und Berlin herumkreisten. Nach dem Tode Schillers schielte Heinrich Heine aus Paris eifersüchtig herüber nach Weimar, und Goethe hielt durch verschiedene Vermittlungen Umschau nach Wien, um das ernste Repertoire des Weimarer Hoftheaters mit Wiener Operetten zu bereichern.
Obgleich er in der Kunstanschauung mehr klassizistisch als klassisch einzuordnen war und sich mit seinen Preisaufgaben in den Propyläen für die jungen, romantisch gesinnten Künstler wie Philipp Otto Runge (1777-1810) fast als steif erwies, war er doch in der Dichtungstheorie genau so modern eingestellt wie die Romantiker. Sind doch alle vier Romane Goethes zeit- und gesellschaftsbezogen, so daß man sie wohl mit Recht als sehr modern charakterisieren könnte. Wenn er auch in der Iphigenie den antiken Stoff behandelte, fiel das angeblich klassische Werk nicht tragisch im griechischen Sinne aus, sondern entsprechend dem modernen Lebensgefühl “verteufelt human”. Es war eben im deutschen Geist und nicht in der griechischen Natur verwurzelt.
Nach Gotthart Wunberg wurde der Begriff “Moderne” von Eugen Wolff geprägt. Es war auch Johannes Schlaf, der diesem nahestehend und auf der Suche nach einem modernen Deutschtum gerade in Goethe zunächst einmal die zeitgemäße Modernität entdeckte. In seinem Beitrag zu einer Festschrift von 1899 lehnte er die Romantiker strikt ab, weil sie mit ihrer Hinwendung zu Gotik und Mittelalter einen schwerwiegenden politischen und sozialen Fehler begangen hätten. Dagegen weist er darauf hin, daß zur Ausbildung des modernen Deutschtums wieder niemand so vorbildlich sein könne wie Goethe, und schreibt: “Und zwar fangen wir an zu gewahren, wie ungeachtet alles antiken, rokokohaften und geheimrätlichen Zopfes, gerade seine späteren Werke, seine beiden großen Romane, vor allem die Wahlverwandtschaften, die Iphigenie und der Tasso dieses modernen Deutschtums überreich sind, das in diesen Werken als eine intime Verbindung der neuzeitigen monistischen Weltanschauung mit allen Geistes- und Gemütsgewalten der deutschen Volksseele darstellt.”
Was mit der neuzeitigen monistischen Weltanschauung gemeint ist, wird aus diesem Text nicht eindeutig klar. Aber man könnte darunter jene vitalistisch-biologische Weltauffassung verstehen, die Ernst Haeckel bzw. Wilhelm Bölsche unter Berufung auf Goethes Morphologie in ihrer darwinistisch ausgerichteten Popularphilosophie propagiert haben oder auch die europäische Lebensphilosophie im allgemeinen, besonders aber bei Nietzsche. Auf jeden Fall kommt es hier auf einen Paradigmenwechsel in der Goethe-Auffassung an, der sich dann auf die literarische Produktion der Moderne fruchtbar auswirkte.
Österreichisches Interesse am Bushido
Umgekehrt ist noch zu erwähnen, wie sich die Österreicher seit der Weltausstellung für die alte japanische Kultur und Geschichte interessieren. Was das Feudalsystem bzw. das Lehenswesen im Mittelalter anbelangt, so läßt sich der japanische Samurai-Stand seit der Kamakura-Zeit (1186-1300) am besten zum Vergleich mit dem europäischen Rittertum heranziehen. Das Feudalsystem bildete hier wie dort den gesellschaftlichen Hintergrund, und die meisten Samurai dienten üblicherweise wie die Ministeriale in Deutschland einem Dienstherrn am Hof als treue Gefolgschaft. Der Dienstherr bekam seinerseits sein Lehen von dem Shogun als dem höchsten Herrscher Japans, der formal vom Tenno, dem japanischen Kaiser, die Legitimation zur Herrschaft über ganz Japan erhalten hatte. Die theokratische Stellung und Würde des Tenno waren seit dem Anfang der japanischen Geschichte irgendwie mythologisch begründet, wie der König oder Kaiser in der Christenheit ihre politische Macht letztlich auf Gott zurückführen mußten. Auf diese Weise bestand auch in Japan eine Hierarchie innerhalb des Samurai-Standes. In der Edo-Zeit (1603-1867), wo es keinen Bürgerkrieg mehr gab, waren die Samurai keine Krieger mehr, sondern stellten vielmehr das Beamtentum dar in der vergleichsweise absolutistischen Monarchie des Tokugawa-Shogunats.
Ein gutes Beispiel für das japanische Mittelalter ist der umfangreiche schöne Ausstellungskatalog Samurai und Bushido. Der Spiegel Japans. Nagoya und die Einheit des Reiches 1550-1867, der 1999 vom Historischen Museum der Stadt Wien herausgegeben wurde. Das wissenschaftliches Konzept stammte von Günter Düriegl, Peter Pantzer und Susanne Winkler, die in der Hauptsache öffentliche Sammlungen mehrerer Museen der Stadt Nogoya verwerteten. Damals vertrat Peter Pantzer den Bonner Lehrstuhl des österreichischen Japanologen Josef Kreiner, der vorübergehend die Leitung des Deutschen Kulturinstituts in Tokyo zu übernehmen hatte. In dem von diesem herausgegebenen Sammelband Japan und die Mittelmächte im Ersten Weltkrieg und in den zwanziger Jahren (1986) schrieb Pantzer einen Aufsatz über „Japan und Österreich zwischen beiden Kriegen“.
Schon im April 1997 konnte Nagoya, Japans drittgrößte Stadt, mit der Ausstellung „Wien—Ein Schicksal in Europa“ die Geschichte und die schönen Künste der Stadt Wien zeigen. Sie fand begeistertes Echo in ganz Japan, da die Stadt Wien, ihre reiche Geschichte und prägende Rolle in Europa erstmals in Japan in dieser Ausführlichkeit vorgestellt wurden. Jetzt war Nagoya daran, Österreich die eigene Stadt mit ihrer geschichtlichen Entwicklung zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert vorzustellen. Es ist die Zeit, in der die Samurai politisch und kulturell das öffentliche Leben prägten, und in der das Bürgertum erstmals in Erscheinung trat. Daher kommt der Titel der Ausstellung.
Etwa in der geographischen Mitte zwischen den beiden großen Städten Osaka und Edo (Tokyo) gelegen, war es die verkehrsgünstige und strategisch einflußreiche Position und gleichzeitig ihre dynastische Nähe zur Shogunsfamilie, die die Entwicklung Nagoyas zu einem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum förderten. In der Begrüßung des Katalogs machte der Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien Michael Häupl in wunderbarer Weise auf folgendes aufmerksam: „Im Vordergrund der gegenwärtigen Beziehungen zwischen Österreich und Japan stehen zweifellos die Wirtschaft und der Handel. Die Voraussetzung dafür bildet jedoch der rege kulturelle Austausch, den es bereits seit langem zwischen diesen beiden traditionsreichen Ländern gibt. Heuer jährt sich zum 130. Mal die Unterzeichnung des ersten Freundschaftsvertrags zwischen den beiden Ländern.“ Der Bürgermeister faßte denn auch den gegenwärtigen Stand des Kulturaustauschs zwischen Österreich und Japan treffend zusammen:
„So verschieden die beiden Kulturkreise auch sind, so groß ist doch die gegenseitige Anziehungskraft. Ich denke nur an den japanischen Einfluß auf die weltberühmte Kunstepoche des Wiener Jugendstils oder an den sensationellen Erfolg Japans bei seiner ersten Auslandspräsentation anläßlich der Wiener Weltausstellung im Jahr 1873. Umgekehrt hat das reiche musikalische Schaffen der klassischen Wiener Komponisten gerade in Japan besonders viele Freunde gefunden, wie die zahlreichen Tourneen österreichischer Orchester und Ensembles immer wieder beweisen, ebenso wie die große Anzahl japanischer Musikstudenten, die in der Kulturmetropole Wien ihre Ausbildung absolvieren — alles Belege für das enge und herzliche Verhältnis zweier so unterschiedlicher Kulturkreise.“
Der Katalog für die Ausstellung „Samurai und Bushido“ ist in die fünf Abteilungen gegliedert: I. Japanische Schönheit, II. „Bushido“ – der Weg des Kriegers (Peter Pantzer: 1. Der Kriegerstand—Samurai, Daimyo, Shogun. 2. Christentum – Der fremde Glaube. 3. Das Schwert. 4. Tsuba—Das Schwertstichblatt, eine Kunstform. 5. Feuerwaffen; Erich Pauer: Die Entwicklung der Technik in der Edo-Zeit. ), III. Nagoya – eine japanische Stadt (1. Von Männern und Frauen. 2. Bilder aus einer Stadt; Mikio Ogawa: Die Region Owari und ihre Bedeutung in der japanischen Geschichte; Naoki Tani: Burg und Burgstadt von Nagoya. 3. Täglicher Erwerb. 4. „Nogaku“ – Die Bühnenkunst des Kriegeradels. Inoue Yuichi: Nô und Kyôgen—Das Theater des Kriegeradels. 5. Kunde von der Natur. 6. Reisen und Handel.) IV. Traditionen und Form in Japan (1. Tee. Franziska Ehmcke: Der Tee-Weg zwischen Kunst, Handel und Politik. 2. Keramik. 3. Lack. 4. Religion. Josef Kreiner: Religion und Brauchtum der Edo-Periode. 5. Hokusai – ein Maler.), V. Im Spiegel Europas. (Hans Dieter Ölschläger: Von der Tradition in die Moderne – Japan auf dem Weg in das 21. Jahrhundert; Günter Düriegl: Japonismus, anders; Susanne Winkler, Fremdsein in Japan.) Anhang: Chronologie der japanischen Geschichte 1180-1912. Auf der Rückseite jeder Abteilungsüberschrift und auch sonst ist ein Haiku-Gedicht des bekannten Dichters Bashô (1644-94) als Beispiel der klassischen japanischen Lyrik angeführt:
Die Glocke hat den Tag
Hinausgeläutet. Der Duft
Der Blüten läutet nach.
Der Frühling geht –
Die Vögel schrein ihm nach,
in den Augen der Fische sind Tränen.
Wir schliefen alle unterm gleichen Dach:
Dirnen und Ginsterblüten,
der Mond und ich.
Am Neujahrstag, ach,
Bedenkt man wohl, wie einsam
Des Herbstes Abend.
Durch Morgengrauen
Und dichten Nebel wirbelt
Der Ruf der Glocken.
Meine kritischen Bemerkungen über Bushido befinden sich in meiner Aufsatzsammlung Spiegelbild der Kulturen (Bern 2018). Die Begeisterung für die japanische Schönheit sogar bei tödlichen Waffen wie Schwerter geht sicherlich auf die Wiener Weltausstellung in der Meiji-Zeit zurück. Nach der Auskunft von Pantzer brachen von Triest aus im April 1873 etwa siebzig japanische Beamte und Fachleute nach Wien auf, um als offiziele Vertreter ihres Landes die diplomatischen Beziehungen mit Österreich aufzunehmen und Japan von Mai bis November auf der Wiener Weltausstellung zu repräsentieren. Eine weitere Aufgabe war es, im Rahmen der Modernisierung Japans die öffentlichen Einrichtungen der österreichisch-ungarischen Monarchie zu studieren.
In den Jahren 1873-1914 vertraten vierzehn diplomatische Gesandte Japan in Wien. Seit 1892 wirkte Heinrich Graf Coudenhove-Kalergi an der österreisch-ungarischen Gesandtschaft in Tokyo. Seiner Ehe mit der Japanerin Mitsuko entsprangen sieben Kinder, eines davon ist Nikolaus Richard Coudenhove, der Begründer der Paneuropa-Bewegung, die schließlich zur Europäischen Union führte. Am 13. März 1938 wurde Österreich dem nationalsozialistischen Deutschland angeschlossen. Da das Büro der Paneuropäischen Bewegung beschlagnahmt wurde, ging Richard Coudenhove zunächst in die Schweiz ins Exil und 1940 weiter in die USA. Auch die 6. Kunstausstellung 1900 der Wiener Secession war ansonsten eine Art japanische Kunstausstellung. Gezeigt wurden unter anderem Holzschnitte und Metallarbeiten, deren Auswirkung in vielen Kunstschöpfungen des Wiener Jugendstils zu spüren ist.
Hervorzuheben ist besonders der Major des Generalstabs Theodor von Lerch, der sich 1911 in Japan aufhielt, um die japanische Truppenausbildung zu studieren. Er ist dabei als „Vater des japanischen Schilaufs“ in die Geschichte eingegangen. Sportbegeistert wie er war, wollte von Lerch in seiner Freizeit den Winter genießen. Die den Japanern völlig neue Sportart war faszinierend und von Lerch wurde um Unterricht gebeten. Bereits nach einem Jahr gab es einen japanischen Schiclub mit 6000 Mitgliedern. Ein sehr interessantes Werk darüber ist Hannes Schneiders Buch „Auf Schi in Japan“ (Tyrolia-Verlag / Innsbruck-Wien-München 1935).
Als Schilehrer von Jugend auf international bekannt – im Jahre 1920 hatte er auch am Film „Wunder des Schneeschuhes“ mitgewirkt – bekam er am 31. Jänner 1930 telegraphisch einen Auftrag, in Japan Schikurse zu erteilen. Durch Sibirien kam er auf Umwegen endlich Mitte März des gleichen Jahres über Korea in Japan an, fuhr „am Fusse des heiligen Berges vorbei nach Tokyo“, wie es in einem Kapitel heißt, und wurde bei der Ankunft in Tokyo „von 5000 Menschen begrüßt“. So geht sein Reisebericht mit 74 Bildern weiter im Erzählton und läßt durchblicken, wie ein Österreicher das Japan vor dem Zweiten Krieg erlebt hat. Daß der Autor überall bis nach Hokkaido so feierlich empfangen wurde, hatte eine besondere Bewandtnis. Anläßlich der Bemerkungen über einen endlich erkannten Fehler der Japaner beim Schilaufen werden nähere Umstände seiner Berufung nach Japan wie folgt geschildert:
„Der Kronprinz Chichibu, der in Mürren in der Schweiz schilaufen war, lernte dort unsere Schihütten kennen. Er erkannte ihre Zweckmäßigkeit und ließ den japanischen Schiklubs und Studenten einige solcher Schihütten nach europäischem Muster bauen, die er ihnen zum Geschenk machte. Als der Kronprinz eines Abends auf einer solchen Hütte weilte, wurde das oben besprochene Thema eingehend behandelt. Chichibu soll den Vorschlag gemacht haben, man möge versuchen, Hannes Schneider auf einige Wochen nach Japan kommen zu lassen.“ Wohl daher kommt es, daß das deutsche Wort „Hütte“ in phonetischer Umschrift bald in den japanischen Wortschatz aufgenommen wurde, wie so manche andere Ausdrücke des Wintersports aus dem Deutschen ins Japanische in der Originalsprache eingebürgert wurden. Aber das gehört zu einem anderen Kapitel, wie aufschlußreich es auch für den Kulturaustausch zwischen Japan und Österreich sein mag.
Apropos: um vor allem die japanischen Alpen und den Berg Fuji kennenzulernen, kam ein deutscher Bergsteiger Willhelm Steinitzer bereits im Jahr 1911 nach Japan und schrieb ein erlebnisvolles Buch Japanische Bergfahrten. Wanderungen fern von Touristenpfaden (Verlag von Ernst Reinhardt. München 1918). Da es eine Anzahl von Erinnerungsfotos aus dem Volksleben im alten Japan enthält, ist es gleichfalls von unschätzbarer volkskundlicher Bedeutung. Er schreibt denn auch im Vorwort: „Auch habe ich auf meinen bergigen Wegen im Innern Japans fern von allen Pfaden, die der Fremde gewöhnlich wandert, so viele charakteristische Züge und Eigentümlichkeiten des Volkes bemerkt, so viele Schönheiten einer unberührten Natur geschaut, daß ich hoffen darf, bei jedem, der sich mit diesem sympathischen Land beschäftigt, ein wenig Interesse zu finden.“
Wie Steinitzer kritisch bemerkte, scheinen sich die europäischen Großstädter damals schon aus der Sehnsucht nach Einsamkeit und ungestörtem Naturgenuß in die fernsten Alpengebiete gewälzt und statt Ruhe und Einsamkeit nur Lärm und lautes Getriebe gefunden zu haben. Da seien immer zahlreicher geworden die, welche die entschwindendeAlpeneinsamkeit in fernen Ländern suchten: Im Kaukasus, Tianschan, den Anden. So gelangten wahrscheinlich ebenfalls die japanischen Berge mit ihren einsamen und noch so wenig bekannten Schönheiten in den Kreis des alpinen Interesses. Wer heutzutage mit derartiger Erwartung die japanischen Alpen besteigen wollte, könnte allerdings schwer enttäuscht sein, weil der Alpinismus in Japan mittlerweile zu sehr zivilisiert und popularisiert ist. Aber es gibt sicherlich noch viele unerwartete, urwüchsige und esoterische Naturschönheiten, sofern man sich nicht vom äußeren Volksleben ablenken läßt.
Beitrag zur japanischen Goethe-Rezeption
Goethe war nie in Wien, aber nicht zu vergessen, daß Franz Grillparzer frühzeitig den Dichter in Weimar besuchte und freundlich aufgenommen wurde. Auch der geistreiche Theaterkritiker Hermann Bahr (1863-1934) aus Linz hat ihn dauernd zitiert. Wie es von August Sauer: Goethe und Österreich, Weimar 1902-1903 (Schriften der Goethe-Gesellschaft 17-18) dokumentiert ist, war Goethes Beziehung zu Wien durch wiederholte Aufenthalte in den böhmischen Badeorten sehr eng. In der Goethe-Forschung ist Heinz Kindermanns bekanntes Buch Das Goethebild des 20. Jahrhunderts, 2. verbesserteAusgabe 1966 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt) heute noch für jeden Goetheforscher unentbehrlich. Er würdigte auch den großen Historiker Heinrich Ritter von Srbik folgendermaßen: „Daß dieses sehr maßvolle Bild des politischen Goethe bei den radikalen Kreisen des Dritten Reiches als nicht ganz befriedigend empfunden wurde, versteht sich. Aber Srbik, wohl einer der bedeutendsten deutschsprachigen Historiker unseres Jahrhunderts, ließ sich bei aller Liebe zu Deutschland von der historischen Wahrheit nicht entfernen.“ In der Tat heißt es mit Recht in Srbiks Friedrich Meinecke gewidmetem Hauptwerk Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart (2 Bde., München/Salzburg 1950):
„Goethe sah die Geschichte als Statik und als Dynamik, er sann der historischen Methodik nach und er wurde selbst in der Farbenlehre zum Wissenschaftshistoriker großen Stiles, der auch dem Historismus- und Wertproblem und der Frage nach den zeitlichen Grundkräften der menschlichen Geschichte ohne positivistische Hingabe an die empirische Tatsachenforschung allein und ohne Hegelsche Vernunftkonstruktion auf dem psychologischen Weg der Geisteswissenschaften nachgegangen ist. Nur wenn man das Ganze des Goetheschen Weltbildes und seine Anschauung über das geschichtliche Einzelne und die Totalität geschichtlichen Werdens zu begreifen sucht, erkennt man seine unmeßbare Bedeutung auch für die Geschichtswissenschaft.“
Die literarwissenschaftliche Beschäftigung mit dem Dichter begann m. E. weltweit in den Bemühungen um eine Goethe-Philologie in den akademischen Kreisen, als Wilhelm Scherer sie allmählich an der Universität Wien heranbildete. Er ging allerdings bald über Straßburg nach Berlin, und sein bedeutendster Straßburger Schüler Erich Schmidt, der in Graz geboren sein soll, wurde von Wien über Weimar nach Berlin als Nachfolger Scherers berufen, wo er dann sogar eine sogenannte Faust-Philologie ins Leben rief. Auch Rudolf Steiner war, wie gesagt, an der Herausgabe der naturwissenschaftlichen Schriften in der Weimarer Ausgabe Goethes beteiligt. Dadurch wurde Wien paradoxerweise als geistig-künstlerischer Raum zumindest für eine unbefangene, lebendige Goethe-Rezeption in Japan frei.
Wie Heinrich Heine in seiner Romantischen Schule Goethes Faust die “Weltbibel der Deutschen” genannt hatte, wurde nach Goethes Tode darüber so viel gegrübelt, daß Gutzkow vor allem über die Faust-Kommentatoren spottete: “Liest man die Deutungen, die unsere literaturgeschichtliche Philologie schon in vielen voluminösen Werken von Faust vorgebracht hat, so kann man sich oft von einem dringenden Verlangen beseelt fühlen, nur noch allein die Worte des Dichters selbst zu vernehmen und sie in der ganzen Natürlichkeit, ja unbestimmten Vieldeutigkeit auf sich wirken zu lassen, die gerade ihre anregendste Schönheit ist und ohne Zweifel den Stimmungen eines wahren Dichtwerkes auch am meisten entspricht.” Das war genau der Standpunkt, den später der italienische Literaturkritiker Benedetto Croce vertreten und der Initiator der Wiener Moderne Hermann Bahr in seinen Fußstapfen verfechten sollte.
Nach Gymnasialprofessor Friedrich Braitmaier, der in seiner Streitschrift Göthekult und Göthephilologie u.a. die Wiener Schule in Berlin aufs Korn nahm, verbündete sich ihre trockene Goethe-Philologie mit dem geistreichen Goethekult eines Herman Grimm: “W. Scherer heiratete H. Grimm. Scherer-Grimm zeugte E. Schmidt und die zahlreiche Schar zünftiger Goethephilologen.” Wissenschaftsgeschichtlich muß allerdings die Bedeutung Wilhelm Scherers (1868-1872) objektiv im historischen Kontext gewürdigt werden. In Bezug auf die Wiener Germanistik unterscheidet Peter Wiesinger / Daniel Steinbadchs Dokumentationsschrift 150 Jahre Germanistik in Wien (Wien 2001) zwischen der außeruniversitären Frühgermanistik von 1815 bis 1850 und der Universitätsgermanistik von 1845/50 bis 1872 und führt über den Vertreter des verschrienen Positivismus aus:
„Da Scherer in politischer Hinsicht ‚großdeutsch’ eingestellt war und es angesichts der österreichischen Konsolidierung diesbezüglich auch zu Kontroversen mit dem Ministerium kam, verschlechterte sich Scherers Position zusehends. So kam ihm 1872 der Ruf an die nach der Gründung des Deutschen Reiches neueingerichtete Universität Straßburg sehr gelegen, wozu sein 1871 für Ottokar Lorenz’ ‚Geschichte des Elsaß’ verfaßter Beitrag über die Geschichte der elsäsischen Literatur die Voraussetzung geschaffen hatte. Von Straßburg, wo er bis 1877 blieb, und dann von Berlin aus, wo er bis zu seinem plötzlichen Tod 1886 wirkte, entfaltete Scherer eine überreiche, fruchtbare Forschungs- und Lehrtätigkeit als einer der letzten Germanisten, die in vollkommener Weise das Gesamtfach mit Sprachwissenschaft sowie älterer und neuerer Literaturwissenschaft beherrschten.“
Damals hatte aber noch kaum ein japanischer Germanist an der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin studiert. Außerdem wurde die Geschichte der deutschen Literatur (1880-83) von Scherer fast anachronistisch erst nach dem Zweiten Weltkrieg ins Japanische übersetzt. Deshalb ist sein unmittelbarer Einfluß auf die japanische Germanistik kaum bemerkbar. Aber Erich Schmidt mit seiner Faust-Philologie spielte schon für die spätere Generation eine große Rolle, zumal seine Ausgabe des Urfaust auch in den japanischen Fachkreisen viel Aufsehen erregt hatte. Aber Schröers kommentierte Faust-Ausgabe wurde schon in der Meijizeit nach Japan eingeführt, und Steiners Erklärungen der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes wurden allmählich von entscheidender Wichtigkeit für die japanischen Goetheforscher.
Aber in kultureller Hinsicht hörten vorerst die österreich-japanischen Beziehungen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs bald auf. Denn im 20. Jahrhundert kam unglücklicherweise ein Zeitalter herauf, wo es hieß, J. Sydney Jones: Hitlers Weg begann in Wien 1907-1913 (Limes Verlag, Wiesbaden und München 1980) und von Wolfgang Speiser: Paul Speiser und das rote Wien (Jugend und Volk Verlagsgesellschaft, Wien-München 1979) die Rede war. Der erstere Autor J. Sydney Jones, 1948 geboren und Amerikaner irischer Abstammung, studierte Publizistik in Wien und Oregon. Wien war damals ohne Zweifel eines der intellektuellen Zentren Europas, aber gleichzeitig voller sozialer Spannungen. Adolf Hitler kam mit 18 Jahren nach Wien. Es waren nicht nur die persönlichen Enttäuschungen, die ihn prägten. Jones zeichnet nach, wo die Wurzeln von Hitlers Antisemitismus, seines Hasses und seiner Komplex liegen. Die Europäische Geistesgeschichte (1953) des geistreichen Kulturkritikers Friedrich Heer (1916-83) wurde schon lange ins Japanische übersetzt, aber sein wichtiges Buch Der Glaube des Adolf Hitler. Anatomie einer politischen Religiosität (München 1968) liegt leider noch nicht in japanischer Übersetzung vor.
Der letztere Autor, der Sohn des späteren Stadtrates im „Roten Wien“, berichtet über den Werdegang seines in St. Pölten geborenen Vaters. Wolfgang Speiser, geb. 1909, war Obmann der Sozialistischen Studenten, nach 1934 im Untergrund gegen das Dollfuß-Regime tätig und wirkte nach 1945 am Aufbau der Wiener und Österreichischen Volkshochschulen, die für das INST so wichtig werden sollten, mit. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der die österreich-japanischen Kulturbeziehungen noch nicht wieder angeknüpft werden konnten, war für die meisten kunstliebenden Japaner unvorstellbar:
„Der Faschismus und der Zweite Weltkrieg machten das große Werk der österreichischen Sozialdemokratie zunichte. 1945, Wien stand noch in Flammen, wurde Paul Speiser zu seiner dritten großen Aufgabe berufen: Als einer der ältesten noch lebenden Gründer des ‚Roten Wien’ von 1919 wurde er zum Motor des Wiederaufbaus. In diesen Jammertagen brachte er nicht nur Elektrizität, Gas und Straßenbahn wieder zum Funkzionieren; als Wiener Vizebürgermeister und Parteiobmann wurde er auch zur Schlüsselfigur für das Wiedererstehen der sozialistischen Bewegung.“ (Vorwort)
Aber auch ohne Goethe-Philologie war ein gewisser Goethekult in den gebildeten Gesellschaftskreisen vor der Jahrhundertwende möglich. Während die ehemaligen Wiener Professoren W. Scherer und E. Schmidt in Berlin die Goetheforschung immer mehr zu einer philologischen Disziplin entfalteten, verbreitete sich in Wien eine andersartige Goetheverehrung unter den Gebildeten der älteren Generation. Hervorzuheben ist besonders der obengenannte Karl Julius Schröer, Initiator des 1878 gegründeten Wiener Goethe-Vereins.
Der aus Ungarn gebürtige Schröer beschäftigte sich zu jener Zeit mit der Kommentierung einiger Dramenbände von Goethe in der Kürschner’schen Deutschen Nationalliteratur. Sein begabter Schüler Rudolf Steiner bemerkte zu dessen wissenschaftlicher Stellung in Wien folgendes: „Ich wußte schon damals, wie Schröer von den Bekennern der herrschend gewordenen literarhistorischen Methoden wegen seiner Schriften, namentlich wegen seiner ‚Geschichte der deutschen Dichtung im neunzehnten Jahrhundert’ angefeindet wurde. Er schrieb nicht so wie etwa die Mitglieder der Scherer-Schule, die wie ein Naturforscher die literarischen Erscheinungen behandelten. Er trug gewisse Empfindungen und Ideen über die literarischen Erscheinungen in sich und sprach diese rein menschlich aus, ohne viel das Auge im Zeitpunkt des Schreibens auf die ‚Quellen’ zu lenken.“ Das entsprach genau der japanischen Mentalität.
Es ist aber merkwürdig und seltsam, daß je eifriger die Goethe-Philologie unter den Germanisten gepflegt wurde, desto weniger die Literaten und Literaturkritiker damit einverstanden, ja zufrieden waren. So schreibt wie Gutzkow seinerzeit z.B. Rudolf Huch in seinem zuerst Ende 1899 erschienenen Büchlein Mehr Goethe: “Geredet wird in der deutschen Literatur allerdings sehr viel mehr als genug über Goethe und sein Werk. Aber das ist die schlechte Komödie, die schale Ironie, die sich in der Geschichte der Künste so gut findet wie in der der großen Welt, daß von einem wirklichen Einflusse Goethes auf die Literatur unserer Zeit nichts, aber auch gar nichts zu spüren ist.” Daß Rudolf Huch des 150. Geburtstages von Goethe mit dem Bewußtsein der Moderne gedenkt, geht aus seinem Hinweis darauf hervor: “Es gibt kaum eine Frage der Kunst oder Wissenschaft, sie sei auch noch so ‘modern’, in die nicht vornehmlich, unüberhörbar das Wort Goethes schallt.” Aber eben nur theoretisch lasse sich sein Wort nicht überhören. In der Praxis hätten unsere bald glanzlosen, bald fieberleuchtenden Augen und das große, helle Goetheauge nichts mit einander gemein. Rudolf Huchs Goethebild beruhte dabei im Gegensatz zur gelehrten Goethe-Philologie in Berlin auf einer inneren Einheit von Natur und Vernunft, nämlich der Natur in ihrer Reinheit und ihrem Reichtum einerseits und der bis jetzt erreichten höchsten menschlichen Vernunft andererseits.
Anhang:
eine von Toshitaka Yada gesammelte Fachliteratur über die Habsburger Monarchie.
- Ernest von Koerber und das Verfassungsproblem im Jahre 1900 : osterreichische Nationalitaten- und Innenpolitik zwischen Konstitutionalismus, Parlamentarismus und oktroyiertem allgemeinem Wahlrecht / Alfred Ableitinger. – Wien : Bohlau , 1973. – (Studien…
- Otto Bauer und der dritte Weg : die Wiederentdeckung des Austromarxismus durch Linkssozialisten und Eurokommunisten / Detlev Albers … et al. (Hg.). – Frankfurt/Main ; New York : Campus Verlag , 1979
- The Socialist Republic of Romania / edited by Arnaldo Alberti. – Milano : Edizioni del Calendario , c1979
- The Concert of Europe / by Rene Albrecht-Carrie. – New York : Harper & Row , c1968. – (Documentary history of Western civilization ; )
- Metternich und die Frage Ungarns / Erzsebet Andics ; Aus dem Ungarischen ubersetzt von Zoltan Jokai. – Budapest : Akademiai Kiado , 1973
- Wenzel Jaksch und die sudetendeutsche Sozialdemokratie / von Martin K. Bachstein. – Munchen : R. Oldenbourg , 1974. – (Veroffentlichungen des Collegium Carolinum ; Bd. 29)
- Stephen Szechenyi and the awakening of Hungarian nationalism, 1791-1841 / by George Barany. – Princeton, N.J. : Princeton University Press , 1968
- Die Osterreichische Revolution / Otto Bauer. – Wien : Wiener Volksbuchhandlung , c1965
- The Austrian solution : international conflict and cooperation / edited by Robert A. Bauer. – Charlottesville : Published for the Johns Hopkins Foreign Policy Institute, School of Advanced International Studies, the Johns Hopkins University by the Unive…
- Osterreich 1918 : Zustandsbild eines Jahres / Karl Bednarik, Stephan Horvath. – Wien ; Munchen : Jugend & Volk , c1968
- Die Monarchie des Hauses Osterreich : ein historisches Essay / Heinrich Benedikt. – Munchen : R. Oldenbourg , 1968
- Osterreichische Parteiprogramme 1868-1966 / herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Klaus Berchtold. – Wien : R. Oldenbourg Munchen , c1967
- The development of the manufacturing industry in Hungary (1900-1944) / I.T. Berend, Gy. Ranki. – Budapest : Akademiai Kiado , 1960. – (Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae ; 19)
- Hungary : a century of economic development / I.T. Berend and G. Ranki. – Newton Abbot : David & Charles. – New York : Barnes & Noble , 1974. – (National economic histories ; )
- Der einsame Konig : Erinnerungen an Ludwig II. von Bayern / von Werner Bertram. – Munchen : Herpich , 1936
- Wahlrechtsfragen im Vormarz : die Wahlrechtsanschauung im Rheinland, 1815-1849 und die Entstehung des Dreiklassenwahlrechts / Heinz Boberach ; hrsg. von der Kommission fur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. – Dusseldorf : Dros…
- Die bohmischen Lander im Habsburgerreich 1848-1919 ; burgerlicher Nationalismus und Ausbildung einer Industriegesellschaft. – Stuttgart : A. Hiersmann , 1968. – (Handbuch der Geschichte der bohmischen Lander / hrsg. im Auftrag des Collegium Carolinum vo…
- Victor und Friedrich Adler : zwei Generationen Arbeiterbewegung / Julius Braunthal. – Wien : Verlag der Wiener Volksbuchhandlung , c1965
- Otto Bauer : eine Auswahl aus seinem Lebenswerk / Julius Braunthal ; mit einem Lebensbild Otto Bauers. – Wien : Verlag der Wiener Volksbuchhandlung , c1961
- From Sadowa to Sarajevo : the foreign policy of Austria-Hungary, 1866-1914 / F.R. Bridge. – London ; Boston : Routledge and K. Paul , 1972. – (Foreign policies of the great powers ; )
- Great Britain and Austria-Hungary, 1906-1914 : a diplomatic history / F.R. Bridge ; with a foreword by James Joll. – London : London School of Economics and Political Science : Weidenfeld and Nicolson , c1972. – (L.S.E. research monographs ; )
- The last Habsburg / Gordon Brook-Shepherd. – London : Weidenfeld and Nicolson , c1968
- Festigung der Organisation : vom Privilegienparlament zum Volkshaus (1889 bis 1907) / von Ludwig Brugel. – Wien : Wiener Volksbuchhandlung , 1923. – (Geschichte der osterreichischen Sozialdemokratie / von Ludwig Brugel ; Bd. 4)
- Parteihader, Propaganda der Tat, Einigung (1878 bis 1889) / von Ludwig Brugel. – Wien : Wiener Volksbuchhandlung , 1922. – (Geschichte der osterreichischen Sozialdemokratie / von Ludwig Brugel ; Bd. 3)
- Dokumente der Reaktion 1848 / von Ludwig Brugel. – Wien : Wiener Volksbuchhandlung , 1922. – (Geschichte der osterreichischen Sozialdemokratie / von Ludwig Brugel ; Bd. 1, Anhang)
- Revolution and reaction, 1848-1852 : a mid-century watershed / Geoffrey Bruun ; an Anvil original under the general editorship of Louis L. Snyder. – Princeton, N. J. : Van Nostrand , 1958. – (An Anvil original ; no.31)
- Das Zeitalter Bismarcks / von Walter Bussmann. – Konstanz : Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion Dr. Albert Hachfeld , c1957
- Das Ende der Massenpartei : am Beispiel Osterreichs / Joseph Buttinger. – Frankfurt, a.M. : Neue Kritik , c1972
- The United States and Eastern Europe / Edited by Robert F. Byrnes. – Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall , 1967. – (A Spectrum book ; )
- Fascist movements in Austria : from Schonerer to Hitler / F.L. Carsten. – London ; Beverly Hills : Sage Publications , c1977. – (Sage studies in 20th century history ; v. 7)
- Franz Joseph and Bismarck : the diplomacy of Austria before the War of 1866 / Chester Wells Clark. – New York : Russell & Russell , 1968, c1934. – (Harvard historical studies ; v. 36)
- Western policy and Eastern Europe / ed. by David S. Collier & Kurt Glaser. – Chicago : Regnery , c1966. – (Foundation for Foreign Affairs series ; No. 10)
- Kaiser Franz Joseph / Egon Caesar Conte Corti, Hans Sokol. – Graz : Styria , 1965. – 2. Aufl
- The Habsburgs : portrait of a dynasty / Edward Crankshaw. – New York : Viking Press , c1971. – (A Studio book ; )
- Europe between revolutions, 1815-1848 / Jacques Droz ; translated by Robert Baldick. – New York : Harper & Row , c1967. – 1st U.S. ed.. – (History of Europe ; )
- Les revolutions allemandes de 1848 / Jacques Droz ; d’apres un manuscrit et des notes de E. Tonnelat. – Paris : Presses universitaires de France , 1957. – (Publications de la Faculte des lettres et sciences humaines de l’Universite de Clermont-Ferrand ;…
- Bismarck and the German Empire / by Erich Eyck. – New York : Norton , 1964, c1958. – (The Norton library ; N235)
- The Frankfurt Parliament, 1848-1849 / Frank Eyck. – London ; Melbourne etc. : Macmillan. – New York : St. Martin’s P. , 1968
- Der Herrenstand in Oberosterreich : Ursprunge, Anfange, Fruhformen / Peter Feldbauer. – Munchen : R. Oldenbourg , 1972. – (Sozial- und wirtschaftshistorische Studien ; )
- Beitrage zur neueren Geschichte Osterreichs / herausgegeben von Heinrich Fichtenau und Erich Zollner. – Wien : H. Bohlau , 1974. – (Veroffentlichungen des Instituts fur Osterreichische Geschichtsforschung ; Bd. 20)
- Die osterreichisch-ungarische Monarchie als Wirtschaftsgemeinschaft : Ein historischer Beitrag zu aktuellen Integrationsproblemen. – Munchen : R. Trofenik , 1968. – (Sudosteuropa-Schriften ; Bd. 9)
- Fritz: the story of a political assassin / by Ronald Florence. – New York : Dial Press , 1971
- Der osterreichisch-ungarische Ausgleich von 1867 : Vorgeschichte und Wirkungen / herausgegeben vom Forschungsinstitut fur den Donauraum, Wien ; gesamtredaktion Peter Berger. – Wien : Herold , c1967
- Der Donauraum : im Zeitalter des Nationalitatenprinzips (1789-1918) / Emil Franzel. – Bern : Francke Verlag , c1958. – (Dalp-Taschenbucher ; Bd. 343)
- Deutscher Liberalismus im Vormarz : Heinrich von Gagern, Briefe und Reden 1815-1848 / herausgegeben vom Bundesarchiv und der Hessischen Historischen Kommission Darmstadt ; bearbeitet von Paul Wentzcke und Wolfgang Klotzer. – Gottingen : Musterschmidt ,…
- Les Habsbourg / par Michel Georis. – Lausanne : Rencontre , c1969. – (Grandes dynasties d’Europe ; )
- Sokol und Arbeiterturnvereine (D.T.J.) der Wiener Tschechen bis 1914 : zur Entwicklungsgeschichte der nationalen Bewegung in beiden Organisationen / von Monika Glettler. – Munchen ; Wien : R. Oldenbourg , 1970. – (Veroffentlichungen des Collegium Caroli…
- Restoration, revolution, reaction : economics and politics in Germany, 1815-1871 / by Theodore S. Hamerow. – Princeton, N.J. : Princeton University Press , c1958
- Ideas and institutions. – Princeton, N.J. : Princeton University Press , 1969. – (The social foundations of German unification, 1858-1871 / by Theodore S. Hamerow ; )
- Karl Renner und seine Zeit : Versuch einer Biographie / Jacques Hannak. – Wien : Europa , c1965
- Das Staatsdenken Friedrich Naumanns / Wilhelm Happ. – Bonn : H. Bouvier , 1968. – (Schriften zur Rechtslehre und Politik ; Bd. 57)
- Die osterreichische Arbeiterbewegung vom Vormarz bis 1945 : Sozialokonomische Ursprunge ihrer Ideologie und Politik / Hans Hautmann, Rudolf Kropf ; Mit einem Vorwort von Karl R. Stadler. Mit Diagr. u. Tab.. – Wien : Europaverlag , c1974. – (Schriftenrei…
- Die Anfange der linksradikalen Bewegung und der Kommunistischen Partei Deutschosterreichs, 1916-1919 / Hans Hautmann. – Wien : Euripa Verlag , c1970. – (Veroffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft fur Geschichte der Arbeiterbewegung in Osterreich ; 7)
- Poland & Czechoslovakia / Frederick G. Heymann. – Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall , c1966. – (The Modern nations in historical perspective ; ). – (A Spectrum book ; )
- Liberales Denken im Zeitalter der Paulskirche : Droysen und die frankfurter Mitte / von Wolfgang Hock. – Munster : Aschendorff , 1957. – (Neue Munstersche Beitrage zur Geschichtsforschung ; Bd. 2)
- Historisches Geschehen im Spiegel der Gegenwart : Osterreich-Ungarn 1867-1967 / herausgegeben Institut fur Osterreichkunde. – Wien : Verlag Ferdinand Hirt , c1970
- The dissolution of the Habsburg monarchy. – Chicago : University of Chicago Press , 1961. – (Phoenix books ; P70)
- Ende und Anfang Osterreich 1918/19 : Wien und die Bundeslander. – Salzburg : Salzburger Nachrichten , c1969. – (Politik konkret ; )
- The Austrian electoral reform of 1907 / by William Alexander Jenks. – New York : Columbia University Press , 1950. – (Studies in history, economics and public law ; no. 559)
- Die Krise des parlamentarismus in Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen : Wissenschaftliche Tagung des Johann Gottfried Herder-Forschungsrates, Fruhjahr 1966 : Referate und Diskussionen / herausgegeben von Hans-Erich Volkmann. – Marburg : J.G.…
- Empire reform / by Robert A. Kann. – New York : Octagon , 1970. – (The multinational empire : nationalism and national reform in the Habsburg monarchy, 1848-1918 / by Robert A. Kann ; v. 2)
- Empire and Nationalities / by Robert A. Kann. – New York : Octagon , 1970. – (The multinational empire : nationalism and national reform in the Habsburg monarchy, 1848-1918 / by Robert A. Kann ; v. 1)
- Intellectual and social developments in the Hapsburg Empire from Maria Theresa to World War I : essays dedicated to Robert A. Kann / edited by Stanley B. Winters and Joseph Held ; in collaboration with Istvan Deak and Adam Wandruszka. – Boulder, Colo. :…
- The problem of restoration : a study in comparative political history / by Robert A. Kann. – Berkeley : University of California Press , 1968 c1967
- An outline of Czechoslovak history / by Frantishek Kavka ; translated from the Czech by Jarmila and Ian Milner. – Prague : Orbis , 1960
- Die deutsche Revolution, 1848-1849 / Kurt Kersten. – Franckfurt am Main : Europaische Verl.-Anst. , c1955
- Austria in World War II : an Anglo-American dilemma / Robert H. Keyserlingk. – Kingston : McGill-Queen’s University Press , 1988
- Kaiserhaus, Staatsmanner und Politiker / Aufzeichnungen des k.k. Statthalters, Erich Graf Kielmansegg. – Wien : R. Oldenbourg , 1966
- Die Revolution im Kaisertum Osterreich 1848-1849 / Rudolf Kiszling ; mit beitragen von J. Diakow … et al.. – Wien : Universum Verlagsges , c1948
- Die Revolution im Kaisertum Osterreich 1848-1849 / Rudolf Kiszling ; mit beitragen von J. Diakow … et al.. – Wien : Universum Verlagsges , c1948
- Dokumentation zur osterreichischen Zeitgeschichte, 1938-1945 / herausgegeben von Christine Klusacek, Herbert Steiner, Kurt Stimmer. – Wien : Jugend und Volk , 1980. – 3. Aufl. – (J & V Dokumentation ; )
- Das osterreichische Parlament von 1848-1966 / Oswald Knauer. – Wien : Bergland , c1969. – (Osterreich-Reihe ; Bd. 358/359-360/361)
- Dokumentation zur osterreichischen Zeitgeschichte, 1945-1955 / herausgegeben von Josef Kocensky. – Wien : Jugend und Volk , 1984. – 4. Aufl. – (J & V Dokumentation ; )
- Die nationale Frage in der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie, 1900-1918/ Redigiert von Peter Hanak ; unter Mitwirkung von Zoltan Szasz. – Budapest : Akademiai Kiado , 196.
- Wirtschaft und Verfassung in Osterreich : Dr. Franz Korinek zum 65. Geburtstag. – Wien : Herder , c1972
- The contest with Napoleon, 1799-1814 / by Enno E. Kraehe. – Princeton, N.J. : Princeton University Press , 1963. – (Metternich’s German policy / by Enno E. Kraehe ; v. 1)
- The Metternich controversy / edited by Enno E. Kraehe. – New York : Holt, Rinehart and Winston , c1971. – (European problem studies ; )
- Die Deutschen und die bohmische Revolution, 1848 / Karl Kreibich ; ins Deutsche ubertragen von Franz Ehlemann. – Berlin : Rutten & Loening , 1952
- Am Beispiel des Austromarxismus : sozialdemokratische Arbeiterbewegung in Osterreich von Hainfeld bis zur Dollfuss-Diktatur / Peter Kulemann. – Hamburg : Junius , 1979
- Otto Bauer : Tragodie oder Triumph / Otto Leichter. – Wien : Europa Verlag , c1970
- Zwischen Reformismus und Bolschewismus : der Austromarxismus als Theorie und Praxis / Norbert Leser. – Wien ; Frankfurt ; Zurich : Europa Verlag , c1968.
- The emancipation of the Austrian peasant, 1740-1798 / by Edith Murr Link. – New York : Octagon Books , 1974, c1949
- Politics in Austria : still a case of consociationalism / edited by Kurt Richard Luther and Wolfgang C. Muller. – London ; Portland, Or. : Frank Cass , 1992
- Austro-German relations in the Anschluss era / Radomir Luza. – Princeton, N.J. : Princeton University Press , c1975
- Independent Eastern Europe : a history / by C.A. Macartney and A.W. Palmer. – London : Macmillan
- A Magyar tortenettudomany valogatott bibliografiaja 1945-1968. – Budapest : Akademiai Kiado , 1971
- Die wirtschaftlichen Ursachen der Revolution von 1848 in Osterreich / von Julius Marx. – Graz ; Koln : Hermann Bohlaus Nachf. , 1965.. – (Veroffentlichungen der Kommission fur neuere Geschichte Osterreichs ; 51)
- The passing of the Hapsburg Monarchy, 1914-1918 / by Arthur J. May. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press , 1966
- The passing of the Hapsburg Monarchy, 1914-1918 / by Arthur J. May. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press , 1966
- 1848 : Protokolle einer Revolution : eine Dokumentation / von Kurt Mellach ; eingeleitet von Gerhard Fritsch. – Wien : Jugend & Volk , c1968
- Mitteleuropa in German thought and action, 1815-1945 / by Henry Cord Meyer. – The Hague : Martinus Nijhoff , 1955.. – (International scholars forum : a series of books by American scholars ; 4)
- The European powers and the German question, 1848-71 : with special reference to England and Russia / by W.E. Mosse. – Cambridge : Cambridge University Press , 1958
- Der Anschluss Osterreichs und das Echo im Reich (1918-1922) / W. Munch. – Bad Kreuznach : Munch , 1968
- Die ungarische Revolution von 1848-49 und die demokratische Bewegung in Deutschland / Karl Obermann ; herausgegeben von der Kommission der Historiker der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Ungarn ; unter der Redaktion von Laszlo Ben…
- Faschismus in Osterreich und international / herausgegeben von der Osterreichischen Gesellschaft fur Zeitgeschichte ; Redaktion: Bertrand Perz, Hans Safrian und Karl Stuhlpfarrer. – Wien : Locker , c1982. – (Jahrbuch fur Zeitgeschichte ; 1980/81)
- Osterreichische und europaische Geschichte : in Dokumenten des Haus-, Hof-, und Staatsarchivs. – Wien : Selbstverlag des Osterreichischen Staatsarchivs , 1965. – 2. veranderte Aufl. – (Publikationen des Osterreichischen Staatsarchivs ; Serie 3 ; Kataloge)
- Das Jahr 1934 : in der Osterreichischen Geschichte : Katalog der Archivalienausstellung. – Wien : Haus-, Hof- und Staatsarchiv , 1975
- Metternich / Alan Palmer. – London : Weidenfeld & Nicolson , 1972
- Hitler and the forgotten Nazis : a history of Austrian National Socialism / Bruce F. Pauley. – London : Macmillan , 1981
- The Czech revolution of 1848 / Stanley Z. Pech. – Chapel Hill : University of North Carolina Press , c1969
- Die Minderheitenfrage und das Deutsche Reich 1919 – 1933/34 / Helmut Pieper. – Hamburg : Institut fur Internationale Angelegenheiten der Universitat Hamburg. – Frankfurt/Main : In Kommission beim A. Metzner , 1974. – (Darstellungen zur auswartigen Polit…
- Sozialismus in Osterreich : von der Donaumonarchie bis zur Ara Kreisky / Walter Pollak. – Wien ; Dusseldorf : Econ Verlag , 1979. – 1. Aufl
- Die deutsche Einheits- und Freiheitsbewegung in der Munchner Studentenschaft (1826-1850) / Gotz Freiherr von Polnitz. – Munchen : Knorr & Hirth , 1929
- The little dictators : the history of Eastern Europe since 1918 / Antony Polonsky. – London ; Boston : Routledge & K. Paul , 1975
- Die Revolution in Deutschland, 1848/49 : Auswahl aus dem Sammelwerk Die Revolutionen 1848/49 / herausgegeben von F.W. Potjomkin und A.I. Molok ; ubersetzt von Werner Meyer. – Berlin : Dietz , 1956-
- Die Fuhrungsschichten in Osterreich und Preussen (1804-1918) : mit einem Ausblick bis zum Jahre 1945 / von Nikolaus von Preradovich. – Wiesbaden : F. Steiner , c1955. – (Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Geschichte Mainz ; Bd. 11)
- Prag und Wien 1848 : Probleme der nationalen und sozialen Revolution im Spiegel der Wiener Ministerratsprotokolle / Friedrich Prinz. – Munchen : R. Lerche , 1968. – (Veroffentlichungen des Collegium Carolinum ; Bd. 21)
- The rise of political anti-Semitism in Germany and Austria / P.G.J. Pulzer. – New York : Wiley , 1964. – (New dimensions in history, essays in comparative history series ; )
- Altosterreichische Unternehmer : 110 Lebensbilder / R. Granichstaedten-Czerva, J. Mentschl, G. Otruba. – Wien : Bergland , c1969. – (Osterreich-Reihe ; Bd. 365/367)
- The provisional Austrian regime in Lombardy-Venetia, 1814-1815 / R. John Rath. – Austin : University of Texas Press , c1969
- The Viennese Revolution of 1848 / R. John Rath. – Austin : University of Texas Press , 1957
- Scheidewege einer Republik : Osterreich, 1918-1968 / Ludwig Reichhold. – Wien : Herder , c1968
- Zu gross fur Osterreich : Seipel und Bauer im Kampf um die Erste Republik / Viktor Reimann. – Wien : Molden , c1968
- Das Volkermanifest kaiser Karls vom 16. Oktober 1918 : letzter versuch zur Rettung des Habsburgerreiches / Helmut Rumpler. – Munchen : R. Oldenbourg , 1966. – (Osterreich Archiv ; )
- Max Hussarek : Nationalitaten und Nationalitatenpolitik in Osterreich im Sommer des Jahres 1918 / Helmut Rumpler. – Grraz ; Koln : Hermann Bohlaus Nachf. , 1965. – (Studien zur Geschichte der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie ; Bd. 4)
- Austromarxismus : Texte zu Ideologie und Klassenkampf von Otto Bauer, Max Adler, Karl Renner, Sigmund Kunfi, Bela Fogarasi und Julius Lengyel / herausgegeben und eingeleitet von Hans-Jorg Sandkuhler und Rafael de la Vega. – Frankfurt am Main : Europaisc…
- Zwanzig Jahre demokratische Erwachsenenbildung in den Bohmischen Landern 1918-1938 : Vorgeschichte, Einrichtungen, Gesetze und Leistungen der deutschen offentlichen Bildungspflege / Elisabeth M. Schenk. – Berlin : Munchen-Pullach , 1972
- Osterreichs Schicksal im Kartenbild : der AZ-Geschichtsatlas / von Manfred Scheuch ; Kartenskizzen von Elisabeth Dirr. – Wien : Verlag der SPO , 1982
- Metternich’s diplomacy at its zenith, 1820-1823 / by Paul W. Schroeder. – New York : Greenwood Press , 1969, c1962
- Metternich : the coachman of Europe : stateman or evil genius / edited with an introduction by Henry F. Schwarz. – Boston : Heath , c1962. – (Problems in European civilization ; )
- Eastern Europe between the wars, 1918-1941 / by Hugh Seton-Watson. – Hamden, Connecticut : Archon Books , 1962. – 3rd ed.
- The transformation of Austrian socialism / Kurt L. Shell. – New York : State University of New York , 1962
- Jenseits der Klassen : Osterreichs Sozialdemokratie seit 1934 / Kurt L. Shell. – Wien : Europa Verlag , c1969
- Klerikalfaschismus : zur Entstehung und sozialen Funktion des Dollfussregimes in Osterreich : ein Beitrag zur Faschismusdiskussion / Klaus-Jorg Siegfried. – Frankfurt a.M. : Lang , 1979. – (Sozialwissenschaftliche Studien ; Bd. 2)
- Jakobiner in der Habsburger-Monarchie : ein Beitrag zur Geschichte des aufgeklarten Absolutismus in Osterreich / Denis Silagi. – Wien ; Munchen : Herold , c1962. – (Wiener Historische Studien ; Bd. 6)
- The troubled alliance : German-Austrian relations, 1914 to 1917 / Gerard E. Silberstein. – Lexington : University Press of Kentucky , c1970
- History of Hungary / Denis Sinor. – Westport, Conn. : Greenwood Press , 1976, c1959
- Osterreich in der deutschen Geschichte / von Heinrich Ritter von Srbik. – Munchen : F. Bruckmann , c1936
- Metternich : der Staatsmann und der Mensch / Heinrich Ritter von Srbik. – Munchen : F. Bruckmann , c1957. – 3. Aufl
- Metternich : der Staatsmann und der Mensch / Heinrich Ritter von Srbik. – Munchen : F. Bruckmann , c1957. – 3. Aufl
- The birth of the Austrian Republic, 1918-1921 / Karl R. Stadler. – Leyden : A.W. Sijthoff , 1966
- Geschichte Sudosteuropas / Georg Stadtmuller. – Munchen : R. Oldenbourg , 1950
- Kathe Leichter : Leben und Werk / herausgegeben von Herbert Steiner. – Wien : Europaverlag , c1973. – (Veroffentlichungen des Ludwig-Boltzmann-Instituts fur Geschichte der Arbeiterbewegung ; )
- Die Kommunistische Partei Osterreichs von 1918-1933 : Bibliographische Bemerkungen / Herbert Steiner. – Wien : Europa Verlag , 1968. – (Marburger Abhandlungen zur politischen Wissenschaft ; Bd. 11)
- Osterreichs Aristokratie im Vormarz : Herrschaftsstil und Lebensformen der Furstenhauser Liechtenstein und Schwarzenberg / Hannes Stekl. – Wien : Verlag fur Geschichte und Politik , 1973. – (Sozial- und wirtschaftshistorische Studien ; )
- Sozialdemokratie in Ungarn : zur Rolle der Intelligenz in der Arbeiterbewegung 1899-1910 / Tibor Sule. – Koln : Bohlau , 1967. – (Beitrage zur Geschichte Osteuropas ; Bd. 6)
- Political parties and elections in Austria / by Melanie A. Sully. – London : Hurst , 1981
- Der Einfluss der Herderschen Ideen auf die Nationsbildung bei den Volkern der Habsburger Monarchie / Holm Sundhaussen. – Munchen : Oldenbourg , 1973. – (Buchreihe der Sudostdeutschen Historischen Kommission ; Bd. 27)
- Die osterreichischen Volksgruppen : Tendenzen ihrer gesellschaftlichen Entwicklung im 20. Jahrhundert / Arnold Suppan. – Munchen : R. Oldenbourg , 1983. – (Osterreich Archiv ; )
- A brief history of Hungary / text and selection of illustrations by Andras Szekely ; translated by Elek Helvey ; revised by Miriam F. Levy. – Budapest : Corvina Press , c1973
- Romanticism and revolt : Europe 1815-1848 / J. L. Talmon. – London : Thames & Hudson , 1967
- Graf Leo Thun im Vormarz : Grundlagen des bohmischen Konservativismus im Kaisertum Osterreich / Christoph Thienen-Adlerflycht. – Graz : Hermann Bohlaus Nachf. , 1967. – (Veroffentlichungen des Osterreichischen Ost- und Sudosteuropa-Instituts ; Bd. 6)
- Liberalism, nationalism and the German intellectuals (1822-1847) : an analysis of the academic and scientific conferences of the period / R. Hinton Thomas. – Cambridge : Heffer , 1951
- Russia, Bolshevism, and the Versailles peace / John M. Thompson. – Princeton, N.J. : Princeton University Press , 1966 i.e. 1967. – (Studies of the Russian Institute ; )
- Parteien und Reichstagswahlen in Ungarn 1848-1892 / Adalbert Toth. – Munchen : R. Oldenbourg , 1973. – (Sudosteuropaische Arbeiten ; 70)
- Aufzeichnungen uber die Geschichte des nationalen und politischen Kampfes in Bohmen im Jahre 1848 / I.I. Udalzow. – Berlin : Rutten & Loening , 1953. – 1. Aufl.
- 1848 : chapters of German history / Veit Valentin ; translated from the German by Ethel Talbot Scheffauer. – London : George Allen & Unwin Ltd. , 1965. – 1st ed 2nd impression
- The end of Austria-Hungary / Leo Valiani. – London : Secker and Warburg , 1973
- Die Italiener in der osterreichisch-ungarischen Monarchie : eine volkspolitische und nationalitatenrechtliche Studie / Theodor Veiter. – Munchen : R. Oldenbourg , c1965. – (Osterreich Archiv ; )
- Der verspielte Ballhausplatz : vom schwarzen zum roten Osterreich / Alexander Vodopivec. – Wien ; Munchen ; Zurich : Molden , c1970
- The Hungarian Soviet Republic, 1919 : an evaluation and a bibliography / by Ivan Volgyes. – Stanford, Calif. : Hoover Institution Press , c1970. – (Hoover Institution bibliographical series ; 43)
- Metternich’s Europe / edited by Mack Walker. – London ; Melbourne : Macmillan , 1968. – (The documentary history of Western civilization ; )
- Schicksalsjahr 1866 / Adam Wandruszka. – Graz : Styria , 1966
- The House of Habsburg : six hundred years of a European dynasty / Adam Wandruszka ; translated from the original German by Cathleen and Hans Epstein. – Garden City, N.Y. : Doubleday , 1965, c1964. – (Anchor books ; A453)
- Darstellungen und Quellen zur Geschichte der deutschen Einheitsbewegung im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert / im Auftrage der Gesellschaft fur Burschenschaftliche Geschichtsforschung ; herausgegeben von Paul Wentzcke. – Heidelberg : C. Winter , 1…
- Romantismus, Restauration und Fruhliberalismus im osterreichischen Vormarz / Eduard Winter. – Wien : Europa Verlag , c1968
- Revolution, Neoabsolutismus und Liberalismus in der Donaumonarchie / by Eduard Winter. – Wien : Europa Verlag , c1969
- Osterrike-ungern i bosniska krisen, 1908-1909 / av Georg Wittrock. – Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri. – Leipzig : Otto Harrassowitz , 1939. – (Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala ; 33)
- Serf, seigneur, and sovereign : agrarian reform in eighteenth-century Bohemia / by William E. Wright. – Minneapolis : University of Minnesota Press , c1966
- Das Staatslexikon von Rotteck und Welcker : eine Studie zur Geschichte des deutschen Fruhliberalismus / Hans Zehntner. – Jena : Fischer , 1929. – (List-Studien : Untersuchungen zur Geschichte der Staatswissenschaften / herausgegeben von Erwin v. Beckera…
- The break-up of the Habsburg Empire, 1914-1918 : a study in national and social revolution / Z.A.B. Zeman. – London : Oxford University Press , 1961
- Twilight of the Habsburgs : the collapse of the Austro-Hungarian Empire / Z.A.B. Zeman. – London : BPC Unit 75 , c1971. – (Library of the 20th century ; )
- Prague spring : a report on Czechoslovakia 1968 / Z.A.B. Zeman. – Harmondsworth : Penguin , 1969. – (Penguin special ; S271)
Der kurhessische Bauer im 19. Jahrhundert und die Grundlastenablosung / Eihachiro Sakai. – Melsungen : Bernecker-Verlag , 1967. – (Hessische Forschungen zur geschichtlichen Landes- und Volkskunde ; Heft 7)