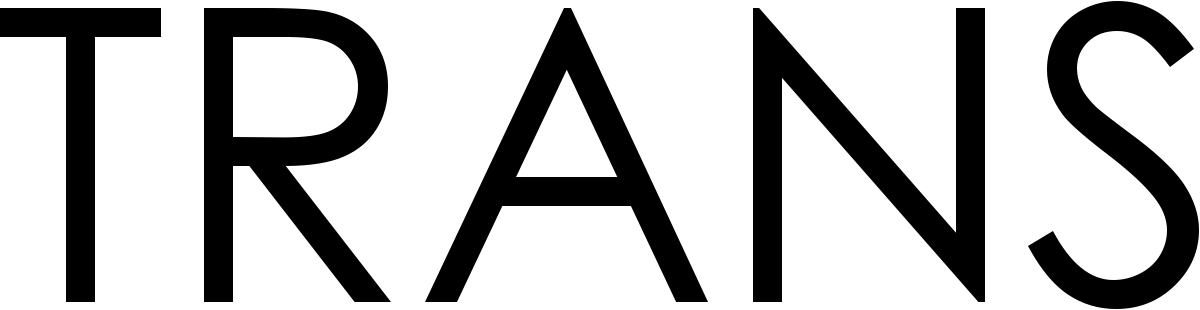In der von Gunter E. Grimm und Klaus-Michael herausgegebenen Reihe „Einführungen Germanistik“ befindet sich auch eine Einführung in die Kulturwissenschaft. Hier heißt es eingangs: „Seit mehr als dreißig Jahren streiten die Literaturwissenschaftler über Methoden und Theorien. In diesen Debatten übt der Begriff Kulturwissenschaft zur Zeit einen unge- wöhnlichen Reiz aus.“1 Dann wird von der „neuerlichen Einführung eines Begriffes“ die Rede, ohne Hinweis darauf, wann dieser Begriff früher schon einmal in der deutschen Literatur- wissenschaft verwendet worden ist. Am Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts, also noch vor 1968 sprach man in germanistischen Kreisen von der populären Kulturgeschichte, die auf dem Buchmarkt beliebt war, deshalb verächtlich, weil es ihr an Theorie fehle.
Aber Walther Linden (1895-1943), der im Jahre 1940 unter Verwendung des Preußischen Geheimen Staatsarchivs ein aufschlußreiches Humboldt-Buch schrieb, plädierte darin nach- drücklich für eine Kulturwissenschaft, wie sie durch Alexander von Humboldt praktizert wurde. Auch wenn er nach dem Zweiten Weltkrieg als NS-Literaturhistoriker verschrieen und heutzutage verschwiegen wird, legt das folgende Zitat Zeugnis davon ab, daß der Begriff einer Kulturwissenschaft damals schon gebräuchlich war: „Er beschäftigte sich mit chinesischen Romanen und verband gerade hier seine kultur- und naturwissenschaftlichen Studien in der fruchtbarsten Weise, indem er in seinem Werke Zentral-Asien (1843 bis 1844) das Gebirgs- system Innerasiens sowohl nach seinen eigenen Reisebeobachtungen wie nach den geographi- schen Angaben der von deutscher und französischer Forschung erschlossenen chinesischen Quellen völlig neu aufbaute. Die lebensvolle Einheit natur- und kulturwissenschaftlicher Studien erweist sich hier ebenso wie in dem geschichtlichen Teile des Kosmos […].“2 Humboldts Gesamttätigkeit darüber hinaus wird anschließend folgendermaßen gewürdigt: „wobei alle diese Bestandteile seines Wirkens, Naturforschung, Kulturwissenschaft, wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit und diplomatische Tätigkeit, ständig miteinander verbunden und in wechselseitiger Förderung erscheinen.“
Etwas störend ist allerdings die Betonung des deutschen Menschen, was sich als propagan- distische Tendenz im Dritten Reich erweist: „Aus dem Gesamt dieser vier Teile [des Kosmos] erklärt sich die weltweite Wirksamkeit des großen deutschen Forschers.“ Das wiederholt sich im Schlußwort: „Mitten im Kanonendonner der Jahreswende 1939/40 lief der erste deutsche Reichsfor- schungsdampfer vom Stapel. Er trägt den Namen ‚Alexander von Humboldt’, den Namen des Mannes, der der Wissenschaft den höchsten Rang erwies: künstlerische Lebendig- keit mit wissenschaftlicher Charakterhaltung zu vereinen als menschheitsfördernde völker- verbindende Macht, als Künderin des Glaubens an das ewig sich erneuernde Leben.“ Der Satz nach dem Doppelpunkt soll allerdings in der erneut publizierten Ausgabe von 1948 einfach weggelassen worden sein. Aber der bekannte Humboldt-Kenner Hanno Beck bemerkt dazu: „Ansonsten ist das Buch durchaus beachtlich.“3 Denn Walther Linden habe im Kosmos das erste große Gesamtbild der Welt auf wissenschaftlicher Grundlage gesehen, ohne jede Ein- mischung religiös kirchlicher Vorstellungen. Auch belegten die von ihm ausgewählten Zitate einen beträchtlichen Kenntnisstand.
Im Nachwort des Herausgebers Albert Erich Brinckmann (1881-1958) wird übrigens die entsprechende Stelle aus der zweiten Auflage aus Walther Lindens Geschichte der deutschen Literatur (1940) zitiert: „Er (=Alexander von Humboldt) arbeitete die Leistungen der Natur- philosophie organisch-lebendig in eine bewegt geschaute Wirklichkeit ein.“ Die Stelle findet sich in der dritten Auflage weiter ausgeführt und bezieht statt der Kulturwissenschaft die Geisteswissenschaten ein: „Nicht minder [als Philosophie] sieghaft ist der Aufschwung der Naturwissenschaft, deren Hauptvertreter Alexander von Humboldt die Leistungen der Naturphilosophie organisch-lebendig in eine bewegt geschaute Wirklichkeit einarbeitet, und der Geisteswissenschaften, die in der Vereinigung geschichtlichen Geistes und geschulten Kunsturteils mit dem Volkstumsgedanken und der mythischen Weltansicht einen ragenden Gipfel erreichen.“ 4 Aus diesem Zitat könnte man wohl ersehen, daß der Begriff der überhol- ten Naturphilosophie inzwischen mit dem der zeitgemäßen Naturwissenschaft beinahe ersetzt wurde und daß die Geisteswissenschaften für den NS-Volkstumsgedanken sowie die mythische Weltansicht weithergeholterweise in Anspruch genommen worden sind. Der Begriff der Kul- turwissenschaft traf anscheinend für Alexander von Humboldt nicht mehr zu.
Aber im ersten Band des Kosmos, seines allerletzten Werks, und zwar in der zweiten Einführung „Begrenzung und wissenschaftliche Behandlung einer physischen Weltbeschrei- bung“ ist davon die Rede, daß Humboldt als Naturwissenschaftler grundsätzlich aus der Analyse ausgeht: „Dem Charakter meiner früheren Schriften, wie der Art meiner Beschäfti- gungen treu, welche Versuchen, Messungen, Ergründung von Tatsachen gewidmet waren, beschränke ich mich auch in diesem Werk auf eine empirische Betrachtung.“ (Darmstädter Ausgabe, VII/1, S. 58) Sie sei der alleinige Boden, auf dem er sich weniger unsicher zu bewegen verstehe. „Diese Behandlung einer empirischen Wissenschaft oder vielmehr eines Aggregats von Kenntnissen, schließt nicht aus die Anordnung des Aufgefundenen nach leitenden Ideen, die Verallgemeinerung des Besonderen, das stete Forschen nach empirischen Naturgesetzen.“ Die empirische Behandlung einzelner Naturerscheiungen (sprich: Kultur- phänomene) würde sich also zumindest zu den Kulturwissenschaften im Plural eignen.
Es soll jedoch an dieser Stelle nicht weiter auf die Frage nach einer Definition der Kultur- wissenschaft eingegangen werden, die nur auf gängige unfruchtbare Methodendebatten in den letzten Jahrzehnten hinauslaufen kann, wenn nicht die Begriffsverwendung seit der Jahr- hundertwende berücksichtigt wird. Im folgenden geht es vorwiegend darum, bewußt zwischen der Kulturwissenschaft im Singular und Kulturwissenschaften im Plural zu unterscheiden. Unter der ersteren wird m. E. ein geisteswissenschaftliches Verfahren im Sinne der Kultur- philosophie der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts verstanden, während die letzteren sich als mittlerweile spezialisierte Disziplinen Einzelwissenschaften, also cultural studies darstellen. Insofern sind diese mit Recht als interkulturelle Germanistik (Intercultural German Studies) zu bezeichnen.
Markus Fauser definiert zwar in seiner Einführung folgendermaßen: „Unter dem Terminus Kulturwissenschaft versteht diese Einführung ein fächerübergreifendes Regulativ.“ 5 Dabei knüpft er an einige haltbare Errungenschaften der Kulturdebatte um 1900. Aber man kann die Kulturwissenschaft im Sinne einer Kulturphilosophie beispielsweise Albert Schweitzers philosophischen Auseinandersetzungen entnehmen, die ursprünglich auf sein afrikanisches Manuskript Wir Epigonen. Kultur und Kulturstaat (München 2005) von 1899 zurückgehen. Wie in seinen autobiographischen Schriften Aus meiner Kindheit und Jugendzeit sowie Zwischen Wasser und Urwald ausgeführt, äußerte Albert Schweitzer damals Skepsis gegenüber der zeitgenössischen Kultur, also der mehr ästhetisch als ethisch ausgerichteten europäischen Kultur der Belle Epoque überhaupt und hatte vor, sie zunächst einmal genau zu analysieren. Sein Anliegen entwickelte sich 1915, als der Erste Weltkrieg ausbrach, zu einem Plan, ein vierbändiges kritisches Werk zum Wiederaufbau der Kultur in Zukunft zu schreiben. Das Gesamtkonzept hat er aber im Laufe seiner Arbeit aufgegeben. Dessen erster Teil „Über die Krise der Kultur und ihre geistige Ursache“ entspricht dem Werk Verfall und Wiederaufbau der Kultur, Kulturphilosophie, erster Teil, das im Jahre 1923 zusammen mit dem zweiten Teil Kultur und Ethik erschien. In der Vorbemerkung mit dem Datum von Februar 1923 steht geschrieben: „Die ersten Entwürfe dieser Kulturphilosophie, deren zwei erste Teile jetzt veröffentlicht werden, gehen auf das Jahr 1900 zurück. Ausgearbeitet wurde sie in den Jahren 1914 bis 1917 im Urwald Afrikas.“ Dieses Hauptwerk Albert Schweitzers liegt heutzutage in neuer Ausstattung und mit dem ursprünglichen Titel in der Beck’ schen Reihe wieder vor.
Vom Verlag aus hervorgehoben wird, daß „Schweitzer hier erstmals die Ethik der Ehr- furcht vor dem Leben entfaltet und auf die berühmte, bis heute aktuelle Formel zugespitzt hat: ‚Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.’“ So trug er zehn Jahre dar- auf auch zu einem kulturwissenschaftlichen Sammelband als Einleitung einen Aufsatz mit dem Titel „Ehrfucht vor dem Leben“ bei. Darin befindet sich die zitierte Formel in dem nachste- hende Kontext: „Denken heißt etwas denken. Die unmittelbarste Tatsache des Bewußtseins des Menschen lautet: ‚Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.’ Als Wille zum Leben inmitten von Willen zum Leben erfaßt sich der Mensch in jedem Augenblick, in dem er über sich selbst und über die Welt um ihn herum nachdenkt.“6 Dabei geht er von der moralischen Kulturaufassung aus, als das Wesentliche der Kultur sei die ethische Vollendung der Einzelnen wie der Gesellschaft anzusehen, zugleich aber habe jeder geistige und jeder materielle Fortschritt Kulturbedeutung.
Deshalb betont Claus Günzler in seinem Nachwort, daß Schweitzers ethische Richtlinie Hingebung an Leben aus Ehrfurcht vor dem Leben kulturphilosophisch fundiert ist, und daß es gerade die kulturphilosophischen Argumente sind, die dem Schweitzerischen Werk eine bis heute frappierende Aktualität verleihen, so daß sie nicht übersprungen werden dürfen: „Denn Schweitzer hat seine kulturphilosophischen Perspektiven weithin nicht am europä- ischen Schreibtisch, sondern in seinem Urwaldspital in Lambarene entwickelt, hat also die europäische Kultursituation aus großer Distanz diagnostiziert und seine Ethik immer auch in Auseinandersetzung mit den Erfahrungen im afrikanischen Urwald entworfen.“7
Claus Günzler macht aber auch darauf aufmerksam, daß um 1900 in Fachkreisen eine Blütezeit der Kulturphilosophie war und Schweitzer sich davon anregen ließ: „Ab 1893 hatte er an der Universität Straßburg mit dem Neukantianer Wilhelm Windelband einen wichtigen Kulturphilosophen zum Lehrer, besuchte 1899 in Berlin auch Lehrveranstaltungen bei Georg Simmel und wurde so vom kulturphilosophischen Zeitgeist ganz selbstverständlich ergrif- fen.“8 Nach Ende des Ersten Weltkrieges neigten allerdings viele Kulturphilosophen dazu, sich von den aufklärerischen Begriffen wie Vernunft, Fortschritt oder Humanität abzuwen- den, weil sie ihnen nach den Kriegserfahrungen trügerisch erschienen. Damals verknüpfte Oswald Spengler dieses allgemeine Unbehagen plakativ mit seiner angeblich im Sinne Goethes morphologischen Geschichtsphilosophie in seinem sensationellen zeitkritischen Buch der Weimarer Republik Der Untergang des Abendlandes.9 Dagegen hielt Schweitzer am Erbe der Aufklärung fest und wollte die Leitidee der Humanität in neuer Weise begründen. Neben- bei bemerkt, setzte der Wiener Historiker Friedrich Heer im Jahre 1949 dem faustischen Kulturpessimismus eines Spengler unter dem provozierenden Buchtitel Aufgang Europas eine Studie zu den Zusammenhängen zwischen politischer Religiösität, Frömmigkeitsstil und dem Werden Europas im 12. Jahrhundert entgegen.
Nach Claus Günzler soll Schweitzer schließlich den Fachphilosophen nur als Außenseiter gegolten haben. Wenn aber ihre hochspezialisierte philosophische Fachsprache an den Jeder- mannsfragen vorbeiläuft, will er doch als Ethiker praktische Wirkung erzielen und bejaht so eine lebendige Popularphilosophie. Immerhin widmet der zweite Band „Kultur und Ethik“
seiner Kulturphilosophie im Stil seines Lehrers Windelband gleich 13 ihrer 22 Kapitel der ethischen Problemgeschichte, um so seine eigene Ethik der Hingebung als Ergebnis einer weitgehenden kritischen Betrachtung der Denkgeschichte zu entwerfen. Es handelt sich dabei um Ethik und Kultur etwa bei Griechen sowie Römern, Renaissance-Menschen, Denkern im 17. und 18. Jahrhundert wie Hobbes, Locke, Helvetius, Bentham, Hume, Smith, Shaftesbury, Kant, Spinoza, Leibniz, Fichte, Schiller, Goethe, Schleiermacher, Hegel, Beneke, Feuerbach, Laas, Comte, Stuart Mill, Schopenhauer, Nietzsche u. a. m. Ganz neu bei Schweitzer sind Auseinandersetzungen mit der Ethik der Inder und Chinesen, die aber teilweise in dem anderen Werk Das Christentum und die Weltreligionen (1924) dokumentiert sind.
Daß der Urwalddoktor im Grunde genommen ethisch eingestellt war, zeigen nicht nur seine vier Goethe-Reden, sondern auch der Titel seiner Akademierede „Le Problème de l’éthique dans l’évolution de la pensée humaine, die er 1952 bei der Aufnahme in l’Academie française hielt. Danach sind in seinem Wortgebrauch Ethik aus dem Griechischen und Moral aus dem Lateinischen letzten Endes identisch, was sich als für das richtige Verständnis seiner Kultur- philosophie sehr wichtig erweist. Denn eine hohe ästhetische Kultur kann sich unter Umstän- den unmoralish auswirken, worauf Stefan Zweig in dem Kapitel „Eros Matutinus“ seiner Autobiographie Die Welt von gestern unumbunden hinweist: „Von der ungeheuren Ausdeh- nung der Prostitution in Europa bis zum Weltkriege hat die gegenwärtige Generation kaum mehr eine Vorstellung.“10 Auch hängt die Ethik nach Schweitzer mit einer bestimmten Welt- anschauung zusammen, und die Weltbejahung führt zur Entwicklung der Ethik, während die Weltverneinung sie daran hindert.
Problematisch erscheint dennoch das Kapitel XVI seines Hauptwerkes „Der Ausgang des abendländischen Ringens um Weltanschauung“ insofern, als auch Naturphilosophie aufge- griffen wird und u.a. Eduard von Hartmann, Henri Bergson, Houston Stewart Chamberlain, Hermann Keyserling besprochen werden. Aber hier wird Alexander von Humboldt mit seiner humanistischen Naturforschung gar nicht erwähnt. Schweitzer ging doch nur geistes- wissenschaftlich von dem Resultat aus, „die Versuche der spekulativen Philosophie, Ethik aus der Erkenntnis des Wesens der Welt zu begründen, sind gescheitert. Die naturwissenschaft- lich und sozialwissenschaftlich denkende Ethik erweist sich als kraftlos.“11 Dabei war er nicht nur durch Goethe, Schopenhauer und Nietzsche, sondern auch durch die Stoiker, die altchi- nesische Philosophie und die französischen Philosophen Alfred Fouillée und Jean Marie Guyau beeinflußt. Nur rechnete er philosophisch mit ihnen negativ ab, indem er meinte: „Fouillée und Guyau sind also elementare Ethiker, wie Schopenhauer und Nietzsche. Aber sie fahren nicht, wie diese, mit festgebundenem Steuer im Kreise der Welt- und Lebens- verneinung oder der Welt- und Lebensbejahung herum, sondern halten mit sicherem Emp- finden den Kurs auf die geheimnisvolle Vereinigung von Weltbejahung, Weltbejahung und Lebensverneinung, welche die ethische Lebensbejahung ausmacht… Dieser Kurs aber führt sie auf den endlosen Ozean hinaus. Land erreichen sie nicht.“12
Auf der anderen Seite war Alexander von Humboldt bekanntlich vor seiner Forschungs- reise nach Südamerika nicht nur mit einzelwissenschaftlichen Naturerscheinunngen, sondern auch mit kulturwissenschaftlichen Problemen beschäftigt.13 Der angehende Amerikaforscher war nämlich vor seiner Reise in die iberoamerikanische Welt, die in mancher Hinsicht von der alten europäischen Welt grundverschieden war, gut vorbereitet. In Göttingen lernte er beim Physiker Lichtenberg und beim Anthropologen Blumenbach die moderne Naturwissen- schaft in ihren Anfängen kennen. Er erlebte dann in Begleitung seines berühmten Lehrer- freundes Georg Forster das erschütterte Europa nach der Französischen Revolution. Nach- dem er in Hamburg Fremdsprachen, vor allem Spanisch erlernt hatte, studierte er in Frei- berg/Sachsen an der Bergakademie bei Abraham G. Werner. Daran schloß sich ein Prakti- kum als Assessor im fränkischen Bergwerk in Bayreuth. Mittlerweile unternahm er einerseits über Wien naturforschende Wanderungen nach Böhmen und andererseits über Salzburg in die bayerischen, italienischen und schweizerischen Alpen. Diese erste kleine Forschungsreise wurde unter dem Aspekt der sogenannten Physikalischen Geographie ausgeführt, wobei er sich vor allem darin übte, mit verschieden- artigen Meßinstrumenten umzugehen. Zuletzt erfreute er sich in Jena der näheren Bekanntschaft mit Schiller und Goethe. Unter dem Begriff „physikalische Geographie“ verstanden übrigens die Geographen des 19. Jahrhun- derts reine Naturgeographie.
Was die Naturphilosophie im traditionellen Sinne anbelangt, so wird nach der einschlägi- gen Literatur generell gesagt: „Wir verstehen jetzt unter Naturphilosophie einerseits eine Metaphysik der Natur (d. h. der Körperwelt), also einen besonderen Teil der Metaphysik, andererseits eine Wissenschaftslehre der Naturwissenschaft, also eine angewandte Erkennt- nistheorie und Logik. Für die zweite Aufgabe wird auch wohl der Name ‚Philosophie der Naturwissenschaft’ verwandt.“14 Die letztere Bezeichnung wird allerdings bei Humboldt nie gebraucht. In Frage kommt also für einen Begriff der Naturphilosophie bei Humboldt nur die erstere mit der Bedeutung „Metaphysik der Natur“ im Unterschied zur Naturgeschichte, d. h. Metaphysik im Sinne des philosophisch-synthetischen Nachdenkens über die analytisch er- folgte Einzelforschung der Naturdinge. Dieser Bedeutungsgehalt wird durch seine verschiede- nen Aussagen bestätigt. Der 25jährige schrieb doch im Anfang seiner wissenschaftlichen Karriere bereits unter dem 6. August 1794 an Schiller: „Wie man die Naturgeschichte bisher trieb, wo man nur an den Unterschieden der Form klebte, die Physiognomik von Pflanzen und Tieren studierte, Lehre von den Kennzeichen, Erkennungslehre, mit der heiligen Wissenschaft selbst verwechselte, so lange konnte unsere Pflanzenkunde, z. B. kaum ein Objekt des Nachdenkens spekulativer Menschen sein. Aber Sie fühlen mit mir, daß etwas Höheres zu suchen, daß es wiederzufinden ist.“15
Was Humboldt in der Naturforschung suchte, war also von Jugend an etwas Höheres: „Ein denkendes Erkennen, ein vernunftmäßiges Begreifen des Universums würden allerdings ein noch erhabeneres Ziel darbieten.“ (VII/1, S. 58 f.) Er wollte schon im Hinblick auf das Tellu- rische das Physische vom Intellektuellen nicht trennen, damit die Physik der Welt zu einer bloßen Anhäufung empirisch gesammelter Einzelheiten herabsinkt. Diese Art Metaphysik der Natur hat eine ähnliche Bewandnis mit der Kulturwissenschaft im Singular, die nach Fausers Begriffsbestimmung ein fächerübergreifendes Regulativ dastellt. Es besteht gewiß sowohl im Altertum als auch in der deutschen Romantik die Gefahr, daß eine rein ideelle Naturphilosophie ohne Empirie viel Nachteile mit sich bringt. Aber „ernste, der Philosophie und der Beobachtung gleichzeitig zugewandte Geister sind jenen Saturnalien fremd geblie- ben.“ (VII/1, S. 59) Der Weisheit letzter Schluß ist daher bei Humboldt: „Der Inbegriff von Erfahrungskenntnissen und eine in allen ihren Teilen ausgebildete Philosophie der Natur (falls eine solche Ausbildung je zu erreichen ist) können nicht in Widerspruch treten, wenn die Philosophie der Natur, ihrem Versprechen gemäß, das vernunftgemäße Begreifen der wirklichen Erscheinungen im Weltall ist.“ (VII/1, S. 59)
Als geistig Verwandter von Schelling bekennt Humboldt in der Tat: „Nicht völlig unbekannt mit dem Geiste des Schellingschen Systems, bin ich weit von der Meinung entfernt, als könne das echte naturphilosophische Studium den empirischen Untersuchungen schaden, und als sollten ewig Empiriker und Naturphilosophen als streitende Pole sich einander abstoßen.“ (I, S. 45). Nachdem er seine eigenen Erfahrungen detailliert im Naturgemälde mitgeteilt hat, sagt er selbstbewußt sogar folgendes: „Ich darf mir schmeicheln, daß selbst dem Naturphilosophen, der alle Mannigkeit der Natur den Elementaraktionen einer Materie zuschreibt und der den Weltorganismus durch den nie entschiedenen Kampf widerstrebender Kräfte begründet sieht, eine solche Zusammenstellung von Tatsachen wichtig sein muß.“ (I, S. 102)
Und mit Hegel stellt er sonst noch eine rhetorische Frage, man möge die Natur dem Bereich des Geistigen entgegensetzen, als wäre das Geistige nicht auch in dem Naturganzen enthalten. Aber er ist der Meinung, es sei schon im Jugendalter der Menschheit, in der einfachsten Betrachtung der Natur, in dem ersten Erkennen und Auffassen eine Anregung zu naturphilosophischen Ansichten gewesen. Nach ihm gehört zur derzeit erreichten höchsten Stufe eine mathematische Naturphilosophie: „Je mehr aber während einer glänzenden Erweiterung aller Naturwissenschaften das Material des sicheren empirischen Wissen anwuchs, desto mehr erkaltete allmählich der Trieb, das Wesen der Erscheinungen und ihre Einheit, als ein Naturganzes, durch Konstruktion der Begriffe aus der Vernunfterkenntnis abzuleiten. In der uns nahen Zeit hat der mathematische Teil der Naturphilosophie sich einer großen und herrlichen Ausbildung zu erfreuen gehabt.“ (VII/1, S. 60) Für ihn ist Wissenschaft, kurzgefaßt „der Geist, zugewandt zu der Natur“, wobei es im Sinne Kants auf die formgebende Kraft des Ordnens im Geist ankommt: „Bei der reichen Fülle des Materials, welches der ordnende Geist beherrschen soll, ist die Form eines solchen Werkes, wenn es sich irgend eines literarischen Vorzugs erfreuen soll, von großer Schwierigkeit.” (VII/1, S. 8)
Hmboldt zog folgerichtig in den späteren Jahren ein naturphilosophisches Fazit daraus und arbeitete sein naturwissenschaftliches Hauptwerk Kosmos heraus, das über die physika- lische Geographie hinaus allenfalls kulturwissenschaftliche Themen erörtert. Vor allem im zweiten Band (1847) seines summarischen Werkes befindet sich ein großangelegtes Kapitel „Geschichte der physischen Weltanschauung“ mit 8 Abschnitten. Da die Weltanschauung ausdrücklich mit dem Beiwort „physisch“ versehen ist, könnte man eventuell die Nicht- beachtung durch Schweitzer einigermaßen rechtfertigen, der für seine Ehrfuchtethik haupt- sächlich mit den Begriffen von Lebensbejahung und –verneinung operierte.
Aber Humboldt war in seiner Naturforschung durchaus ethisch eingestellt, weil sie seit Ansichten der Natur auch anthropologische Aspekte einbezogen hat. Zum Schluß des langen Kapitels „Naturgemälde“ im ersten Band des Kosmos , der der Geschichte der physischen Weltanschauung im zweiten Band entspricht, schreibt er: “Indem wir die Einheit des Menschengeschlechts behaupten, widerstreben wir auch jeder unerfreulichen Annahme von höheren und niederen Menschenrassen. Es gibt bildsamere, höher gebildete, durch geistige Kultur veredelte, aber keine edleren Volksstämme. Alle sind gleichmäßig zur Freiheit bestimmt, zur Freiheit, welche in roheren Zuständen dem einzelnen, in dem Staatenleben bei dem Genuß politischer Institutionen der Gesamtheit als Berechtigung zukommt.“(VII/1, S.325 f.) Humboldts schärfste Stellungnahme zur „unerfreulichen Annahme“ ist in der Originalanmerkung 421 deutlicher ausgesprochen: „Das unerfreulichste und in späteren Zeiten so oft Wiederholte über die ungleiche Berechtigung der Menschen zur Freiheit und über Sklaverei als eine naturgemäße Einrichtung findet sich leider! sehr systematisch entwickelt in Aristoteles Politica I, 3, 5, 6.“ In der oben erwähnten Akademierede kommt Schweitzer gleichfalls darauf zu sprechen, Plato und Aristoteles sowie andere Denker hätten nur die Griechen ins Auge gefaßt und sie als die über dem Lebensunterhalt erhabenen freien Menschen gedacht, so daß diejenigen, die nicht zu dieser Adelsklasse gehörten, niedere Menschen seien und bräuchten nicht weiter gekümmert zu werden. Er hätte also Humboldt in dessen ethischer Grundhaltung völlig zugestimmt.
Der Humboldt-Kenner Hanno Beck fordert nun in seiner Einführung in die Alexander- von-Humboldt-Studienausgabe dazu auf, diejenigen, die aus dessen Werk eine Philosophie ableiten wollten, sollten es möglichst bald tun, damit sich endlich darüber diskutieren lasse und das Stadium bloßer Behauptungen verlassen werden könne.16 Es scheint also, daß die Aufgabe noch nicht geleistet worden ist, zumindest nicht genügend aufgearbeitet worden ist.
Humboldt selbst hat sich gewiß nie für einen Philosophen gehalten. Aber in seiner Erstlingsarbeit nach der Rückkehr aus Südamerika Ideen zu einer Geographie der Pflanzen nebst einem Naturgemälde der Tropenländer (Tübingen und Paris 1807) 17 schreibt er eingangs in dem Abschnitt „Naturgemälde der Tropenländer“ ausdrücklich: „Das Gleichgewicht, welches mitten unter den Perturbationen scheinbar streitender Elemente herrscht, dies Gleichgewicht geht aus dem freien Spiel dynamischer Kräfte hervor, und ein vollständiger Überblick der Natur, der letzte Zweck allen physikalischen Studiums, kann nur dadurch erreicht werden, daß keine Kraft, keine Formbildung vernachlässigt und dadurch der Philosophie der Natur ein weites, fruchtversprechendes Feld vorbereitet wird.“ (I/70 f.) Dadurch wird implizite gesagt, daß der Begriff von Naturphilosophie bei ihm wesentlich mit dem sogenannten Naturgemälde zusammenhängt, da ein allgemeines, d. h. generelles Naturgemälde seinerseits eine Übersicht der Erscheinungen im Kosmos darstellt.
Dazu bemerkt Hanno Beck: „Hier weist A. v. Humboldt deutlich auf die Möglichkeit einer ‚Philosophie der Natur’ hin; sie soll in seinem Sinn aber erst später auf dem empirischen Substrat einer Physikalischen Geographie möglich werden.“ (I, S. 71) Zum Schluß des Abschnitts „Naturgemälde der Tropenländer“ stellt er tatsächlich seine auf den Einzelbeobachtungen aufgebaute eigene Naturphilosophie in Aussicht: „Ich darf mir schmeicheln, daß selbst dem Naturphilosophen, der alle Mannigfaltigkeit der Natur den Elementaraktionen einer Materie zuschreibt und der den Weltorganismus durch den nie entschiedenen Kampf widerstrebender Kräfte begründet sieht, eine solche Zusammenstellung von Tatsachen wichtig sein muß. (I, S. 102) Die einander ergänzende methodische Gegen- überstellung wird anschließend folgendermaßen formuliert: „Der Empiriker zählt und mißt, was die Erscheinungen unmittelbar darbieten, der Philosophie der Natur ist aufbehalten, das allen Gemeinsame aufzufassen und auf Prinzipien zurückzuführen.“
So stellt sich also das Naturgemälde als die empirische Grundlage und Vorarbeit für eine denkende, d. h. philosophische Betrachtung heraus, die dann ohne weiteres als Philosophie der Natur bezeichnet wird. Nach den Ausführungen der Einzeltatsachen in der Pflanzen- geographie kommt Humboldt denn auch gewissermaßen zu seiner induktiven Philosophie der Natur zurück: „Doch ich verlasse spekulativ Vermutungen, welche sich doch nur auf unvollständige Induktionen gründen, und kehre, meinem Plan getreu, zu dem zurück, was die empirische Beobachtung unmittelbar gibt.“(I, S. 144) Wie Hanno Beck wieder vermerkt, ist es ein wichtiger Grundsatz der Physikalischen Geographie A. v. Humbodts. Nebenbei bemerkt, hat Humboldt einmal den Ausdruck „ein physikalisches Gemälde“ (I, S. 69) gebraucht. Nach Hanno Beck folgte er hier mehr dem von ihm im Französischen benutzten Wort „tableau physique“.
Bei dem solcherart umrissenen Naturgemälde handelt es sich, wie aus der Vorrede hervorgeht, um keine bloße Anhäufung einzelner Tatsachen, sondern um die Hauptresultate der von ihm beobachteten Erscheinungen, die in ein allgemeines Bild zusammengefaßt worden sind. So wird das Werk, das er gegenwärtig den Naturforschern vorlegt, von Anfang an als „Naturgemälde“ bezeichnet: „Ich stelle in diesem Naturgemälde alle Erscheinungen zusammen, welche die Oberfläche unseres Planeten und der Luftkreis darbietet, der jenen einhüllt.“ (I, S. 44) Es erweist sich somit als eine vorläufige Naturphilosophie Humboldts und enthält die Hauptresultate der Arbeiten, die er im Laufe der Jahre nach der Amerikareise entwickeln wird. Grundsätzlich geht er aber davon aus, daß sein Werk nur allgemeine Ansichten, sichere und durch Zahlen auszudrückende Tatsachen aufstellen sollte.
Alles in einem berührt Humboldts Begriff des Naturgemäldes gleichsam alle Erscheinungen, mit denen er sich fünf Jahre lang während seiner Expedition nach den Tropenländern beschäftigt hat. „Eine solche Schilderung der Natur heißer Klimate schien mir nicht bloß an sich selbst interessant für den empirischen Physiker [=Naturforscher], sondern ich schmeichelte mir auch, daß sie besonders lehrreich und fruchtbar durch die Ideen werden würde, die sie in dem Geiste derer erregen könnte, welche Sinn für allgemeine Naturlehre haben und dem Zusammenwirken der Kräfte nachspüren. In der großen Verkettung von Ursachen und Wirkungen darf kein Stoff, keine Tätigkeit isoliert betrachtet werden.“(I, S. 70)
Außerdem machen sich beim graphischen Naturgemälde zwei weitere Gesichtspunkte geltend, die nicht leicht miteinander zu vereinbaren sind: “In dieser geographischen Vorstellung sollten zwei sich oft ausschließende Bedingungen zugleich erfüllt werden, Genauigkeit der Projektion und malerischer Effekt. Wie weit es uns geglückt ist, diese Schwierigkeit zu überwinden, müssen wir der Entscheidung des Publikums überlassen.“(I, S. 74) Das Naturgemälde der Tropenländer umfaßt doch alle physikalischen Erscheinungen, welche die Oberfläche der Erde und der Luftkreis von dem 10. Grad nördlicher bis zum 10. Grad südlicher Breite darbietet. Hier sieht man klar ein, warum Humboldt nicht die gesamte Tropenzone in sein Naturgemälde in Text und Profil einschließen will. Denn sein Naturgemälde stellt schließlich einen senkrechten Durchschnitt nach einer Fläche dar, die durch den Rücken der Andenkette, von Osten gegen Westen, gerichtet ist. Er bemüht sich zwar redlich, „diesem Naturgemälde eine größere Vollständigkeit zu geben”, fürchtet aber, daß botanische Karten „sich ihrer Vollkommenheit allmählich nur dadurch nähern, daß sich die Zahl genauer Beobachtungen und Messungen vermehrt“ (I, S. 72).
Von der Zweckmäßigkeit dieser Methode ist er fest überzeugt, so daß er es später nach- drücklich wiederholt: „Vierzehn Skalen, welche das Bild einschließen, enthalten gleichsam das Resultat von dem, was die Naturlehre in ihrem gegenwärtigen Zustand in Zahlen dar- bietet.“ (I, S. 102); „In einer Materie, über welche es noch sehr an genauen und vervielfältigten Erfahrungen fehlt, ist es vorsichtiger, statt sich in Vermutungen zu verirren, die Resultate, wie sie aus den bisherigen Beobachtungen folgen, unverändert zu liefern.“ (I, S. 107); „In der beschreibenden Geognosie, welche eine zuverlässige Wissenschaft ist, kommt es auf den gegenwärtigen Zustand der Dinge an und nicht auf Vermutungen über den Ursprung und die frühesten Katastrophen der Natur.“ (I, S. 138 f.)
In der Vorrede deutet er jedoch gleichzeitig eine grundlegende Voraussetzung fast wie in der romantischen Naturphilosopie an, die sich auf „die streitenden Elemente“ in der Natur beruft: „Im Angesichte der Objekte, die ich schildern sollte, von einer mächtigen, aber selbst durch ihren inneren Streit wohltätigen Natur umgeben, am Fuße des Chimborazo, habe ich den größeren Teil dieser Blätter niedergeschrieben.“ (I, S. 44) Auch wenn er Harmonie in der Natur betont, war sie im Sinne der streitenden Elemente das Ergebnis eines Kampfes dynamischer Kräfte, worauf auch Goethe in seinem Versuch einer Witterungslehre hinwies: „Es ist offenbar, daß das, was wir Elemente nennen, seinen eigenen wilden wüsten Gang zu nehmen immerhin den Trieb hat. Insofern sich nun der Mensch den Besitz der Erde ergriffen und ihn zu erhalten Pflicht hat, muß er sich zum Widerstand bereiten und wachsam erhalten. Aber einzelne Vorsichtsmaßregeln sind keineswegs so wirksam, als wenn man dem Regellosen das Gesetz entgegenzustellen vermöchte, und hier hat uns die Natur aufs herrlichste vorgearbeitet, und zwar indem sie ein gestaltetes Leben dem Gestaltlosen entgegensetzt.“18
Bei seiner Bemerkung setzt Humboldt allerdings einer spekulativen Naturphilosophie der Romantiker19 bewußt eine empirische Naturforschußung entgegen, die zu seiner eigentlichen Naturphilosophie leiten soll: „Dem Felde der empirischen Naturforschung getreu, dem mein bisheriges Leben gewidmet gewesen ist, habe ich auch in diesem Werk die mannigfaltigen Erscheinungen mehr nebeneinander aufgezählt, als, eindringend in die Natur der Dinge, sie in ihrem inneren Zusammenwirken geschildert.“ (I, S. 44) Humboldt schließt trotz allem die Möglichkeit nicht aus, „einst ein Naturgemälde ganz anderer und gleichsam höherer Art natur- philosophisch darzustellen.“ (I, S. 45) Eine solche „Reduktion aller Naturerscheinungen, aller Tätigkeit und Gebilde, auf den nie beendigten Streit entgegengesetzter Grundkräfte der Materie“ liegt im allgemeinen den romantischen Philosophen sehr nahe, wenngleich ihrer Naurphilosophie ein empirisches Substrat weitgehend fehlt.20
Erst in seinem Hauptwerk Kosmos kommt Humboldt darauf, „zwei Arten des Genusses“ (VII/1, S. 14) der Natur zu unterscheiden und läßt einen höheren Genuß aus der Einsicht in die Ordnung des Weltalls und in das Zusammenwirken der physischen Kräfte entspringen. Er bemerkt dann deutlich genug, klare Erkenntnis und Begrenzung träten an die Stelle dumpfer Ahnungen und unvollständiger Induktionen, indem die Philosophie der Natur, ihrem dichterischen Gewand entzogen, den ernsten Charakter einer denkenden Betrachtung des Beobachteten annehme21. Denn der Mensch beginnt die Natur zu befragen und den engen Raum seines flüchtigen Daseins zu überschreiten. So erläutert Humboldt sein wissen- schaftliches Vorhaben mit dem Naturgemälde nachhinein wie folgt: “Indem das allgemeine Naturgemälde von den fernsten Nebelflecken und kreisenden Doppelsternen des Weltraums zu den tellurischen Erscheinungen der Geographie der Organismen (Pflanzen, Tiere und Menschen- rassen) herabsteigt, enthält es schon das, was ich als das Wichtigste und Wesentlichste meines ganzen Unternehmens betrachte: die innere Verkettung des Allgemeinen mit dem Besonderen; den Geist der Behandlung in Auswahl der Erfahrungssätze, in Form und Stil der Komposition.“ (VII/1, S. 10)
In der Vorrede bemüht er sich einigermaßen auch darum, auf diese Weise diesem wissenschaftlichenWerk einen literarischen Vorzug zu geben, wie oben in einem anderen Kontext angeführt: „Bei der reichen Fülle des Materials, welches der ordnende Geist beherrschen soll, ist die Form eines solchen Werkes, wenn es sich irgend eines literarischen Vorzugs erfreuen soll, von großer Schwierigkeit.“ (VII/1, S. 8) Sind doch rein literarische Geistesprodukte in den Tiefen der Gefühle und der schöpferischen Einbildungskraft verwurzelt, was für ihn als Wissenschaftler kein Negativum ist.22 Schließlich ist es das Naturgemälde, das den Geist bei Betrachtung der Natur in ihren einzelnen Erscheinungen erfreut: „Naturgemälde, nach leitenden Ideen aneinandergereiht, sind nicht allein dazu bestimmt, unseren Geist angenehm zu beschäftigen; ihre Reihenfolge kann auch die Graduation der Natureindrücke bezeichnen, deren allmählich gesteigerten Intensität wir aus der einförmigen Leere pflanzenloser Ebenen bis zu der üppigen Blütenfülle der heißen Zone gefolgt sind.“ (VII/1, S. 17)
Im Kosmos spricht Humboldt gleichfalls vom Kampf der Elemente: „Bald ergreift uns die Größe der Naturmassen im wilden Kampf der entzweiten Elemente“ (VII/1, S. 15), wobei es sich im Grunde um „den unermeßlichen Schauplatz schaffender und zerstörender Kräfte“ (VII/2, S. 62) in der Natur handelt. Aber „da, wo in dem Kampf der streitenden Elemente das Ordnungsmäßige, Gesetzliche nicht bloß geahnt, sondern vernunftmäßig erkannt wird“, wird man dabei einen Naturgenuß finden, der aus Ideen entspringt. „Um diesen Naturgenuß […] bis zu seinem ersten Keim zu verfolgen, bedarf es nur eines flüchtigen Blickes auf die Entwicklungsgeschichte der Philosophie der Naur oder der alten Lehre vom Kosmos.“ (VII/1, S. 26) Es ist also der Zwiespalt der Elemente, der scheinbare Widersprüche der Erscheinungen verursachen: „Wie die Weltgeschichte […], so würde auch eine physische Weltbeschreibung, geistreich und mit gründlicher Kenntnis des bereits Entdeckten aufgefaßt, einen Teil der Widersprüche heben, welche die streitenden Naturkräfte in ihrer zusammen- gesetzten Wirkung dem ersten Anschauen darbieten.“ (VII/1, S. 30 f.) Der Aspekt wird über Geschichte und Natur hinaus am Ende des 1. Band des Kosmos sogar ins Mystische einbezogen: „Der Begriff der Belebtheit ist so an den Begriff vom Dasein der treibenden, unablässig wirksamen, entmischend schaffenden Naturkräfte geknüpft, welche im Erdkörper sich regen, daß in den ältesten Mythen der Völker diesen Kräften die Erzeugung der Pflanzen und Tiere zugeschrieben, ja der Zustand einer unbelebten Oberfläche unsres Planeten in die chaotische Urzeit kämpfender Elemente hinaufgerückt wurde.“ (VII/1, S. 310)
Demnach wird die alte pythagoreische Lehre vom Kosmos als eine Art Naturphilosophie angesehen, wie sich Humboldt als seine Philosophie der Naur vorstellt. Jene alte Natur- philosophie befindet sich gleichsam zwischen dem instinktiven Rudiment der Stämme und den begabten Individuen: „Was bei einzelnen mehr begabten Individuen als sich als Rudiment einer Naturphilosophie, gleichsam als eine Vernunftanschauung darstellt, ist bei den ganzen Stämmen das Produkt instinktiver Empfänglichkeit. Auf diesem Weg, in der Tiefe und Lebendigkeit dumpfer Gefühle, liegt zugleich der erste Antrieb zum Kultus, die Heiligung der erhaltenden wie der zerstörenden Naturkräfte.“ (VII/1, S. 26) Hier ist aber die Diktion mit dem Kultus etwas anders geworden als bei den antiken Elementen.
Apropos, zum Schluß der Einleitung zu dem Naturgemälde im Kosmos ist statt der Naturphilosophie von der Weltanschauung die Rede, wo „der bisher so unbestimmt aufgefaßte Begriff einer physischen Erdbeschreibung durch erweiterte Betrachtung und das Umfassen alles Geschaffenen im Erd- und Himmelsraum in den Begriff einer physischen Welt- beschreibung übergeht“. (VII/1, S. 41) Es sei aber die Weltbeschreibung oder Lehre vom Kosmos, […] nicht etwa ein enzyklopädischer Inbegriff der allgemeinen und wichtigsten Resultate. Das Zitat wird von Hanno Beck in einer Anmerkung als „eine für das Verständnis des Ganzen wichtige Stelle“ hervorgehoben.
Anmerkungen
1 Markus Fauser: Einführung in die Kulturwissenschaft. Darmstadt 2003, S. 7. Vgl. Herbert Arlt (Hrsg.): Kulturwissenschaft – transdisziplinär, transnational, online. Zu fünf Jahren INST-Arbeit und Perspektiven kulturwissenschaftlicher Forschungen. Röhrig Universitäts- verlag. St. Ingbert 1999.
2 Walther Linden: Alexander von Humboldt. Weltbild der Naturwissenschaft. Hamburg 1940. S. 70 f. Vgl. dazu Alexander von Humboldt: Zentral-Asien. Das Reisewerk zur Expedition von 1829. Untersuchungen zu den Gebirgsketten und zur vergleichenden Klimatologie. Nach der Übersetzung Wilhelm Mahlmanns aus dem Jahr 1844. Neu bearbeitet und herausgegeben von Oliver Lubrich. S. Fischer Verlag. Frankfurt am Main 2009.
3 Alexander von Humboldt. Studienausgabe in 7 Bänden. Herausgegeben und kommentiert von Hanno Beck. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt 1989. Band VII Kosmos. Teilband 2, S. 416.
4 Walther Linden: Geschichte der deutschen Literatur. 3. Aufl. Reclam Verlag. Leipzig 19 , S.
5 Fauser, Einführung S. 9. Die Arbeitsfelder der Kulturwissenschaften, die als eine Art Universalwissenschaft ins Uferlose gehen können, erstrecken sich inzwischen sogar auf die Religionswissenschaft. Vgl. z. B. Dirk Johannsen: Das Numinose als kulturwissenschaftliche Kategorie. Stuttgart 2008.
6 Vgl. Carl Lang / Ernst Adolf Dreyer (Hrsg.): Deutscher Geist. Kulturdokumente der Gegenwart. R. Voigtländers Verlag. Leipzig 1933, S. 15-21 in der Rubrik „Der Ruf“.
7 Albert Schweitzer: Kulturphilosophie. Band I: Verfall und Wiederaufbau der Kultur. Band II: Kultur und Ethik. Mit einem Nachwort von Claus Günzler. Neuausgabe in der Beck’schen Reihe, München 2007, S. 346.
8 Ebenda S. 346.
9 Oswald Spengler:
Vgl. Frits Boterman: Oswald Spengler und sein Untergang des Abendlandes. Köln 2000.
10 Stefan Zweig: Die Welt von gestern.
11 Schweitzer, Kulturphilosophie S. 250.
12 Ebenda S. 257 f.
13 Als frühe, ausgezeichnete Biographie (Amerikanische Ausgabe 1955) vgl. Helmut de Terra: Alexander von Humboldt und seine Zeit. F. A. Brockhaus. Wiesbaden 1959.
14 Oswald Külpe: Einleitung in die Philosophie. 12. verbesserte Aufl., herausgegeben von August Messer. Leipzig 1928. II. Kapitel. Die philosophischen Disziplinen. B. Die besonderen philosophischen Disziplinen. §7. Die Naturphilosophie. S. 67 f.
15 Alexander von Humboldt. Studienausgabe in 7 Bänden. Herausgegeben und kommentiert von Hanno Beck. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt 1989. Band I Schriften zur Geographie der Pflanzen, S. 35.
16 Studienausgabe, Band I Schriften zur Geographie der Pflanzen, S. 4. Vgl. Hanno Becks Be-
merkung über Gustav Biedermann (1815-1890): Die speculative Idee im Humboldt’ Kosmos. Ein Beitrag zur Vermittlung der Philosophie und der Naturforschung, Prag 1849. (VII/2, S. 413)
17 Vgl. Ideen zu einer Geographie der Pflanzen von Alexander von Humboldt. Herausgegeben von Mauritz Dittrich. Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften. Nr. 248. Leipzig 1960.
18 Goethes Werke. Hamburger Ausgabe. Bd. 13, S. 309.
19 Vgl. Romantische Naturphilosophie. Ausgewählt von Christoph Bernoulli und Hans Kern. Eugen Diedrichs Verlag. Jena 1926.
20 Vgl. Schellings Werke. Nach der Originalausgabe in neuer Anordnung herausgegeben von Manfred Schröter. Münchner Jubiläumsdruck. Erster Ergänzungsband. Zur Naturphilo- sophie 1792-1803. München 1956.
21 Vgl. „wie endlich die Philosophie der Natur, ihrem alten dichterischen Gewand entzogen (wird)“. Studienausgabe. Band VII/1, S. 14.
22 Vgl. Annette Graczyk: Das literarische Tableau zwischen Kunst und Wissenschaft. Wilhelm Fink Verlag. München 2004.