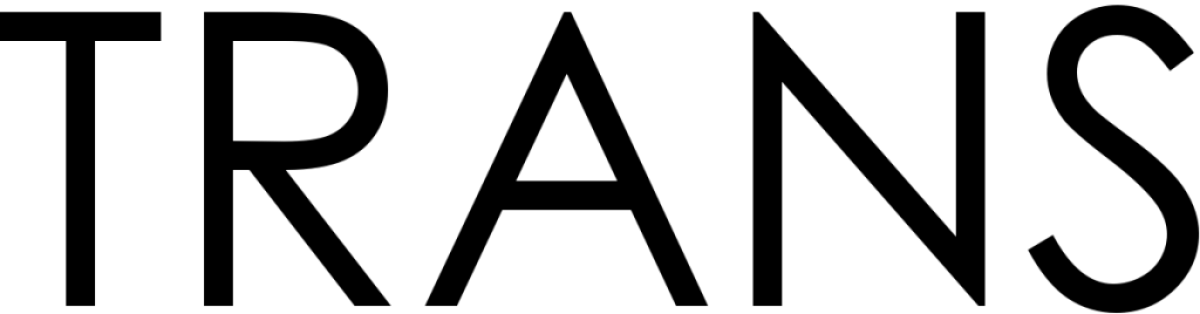Yahiaoui Meriem
Laboratoire de Traduction et Méthodologie (TRADTEC),
Université d’Oran 2
Abstract: The negation is a universal phenomenon that exists in all languages. It is a refusal or denial of something. It is statement that cancels out or denies another statement or action.
To express the negation in modern standard Arabic and in German they are a many of different particles (maa- laa- lam- lan…..in Arabic) and (nicht- kein- niemand- nichts….in German). In this search I tried to expose the different ways to phrase the negation and to make a comparison between these two languages, and to explain the convergences and the divergences between them.
Keywords: negation, negation particles, comparison between negation in modern standard Arabic and in German.
1. Einführung
Wir sind uns darüber im Klaren, dass die kontrastive Grammatik,die als Zweig der angewandten Linguistik zu betrachten ist,einen wesentlichen Aspekt im Fremdsprachenunterricht darstellt.So ist im Fremdsprachenunterricht festgestellt worden,dass die häufig bei den Studenten registrierten Fehler oft auf die folgenden Gründe zurückzuführen sind, nämlich:
-
Auf den Einfluss der Muttersprache auf die Fremdsprache
-
Auf die Divergenzen zwischen Fremdsprache und Muttersprache,besonders wenn diese genetisch nicht verwandt sind
-
Oft auch auf die Nichtbeherrschung der Regel der Fremdsprache
Die kontrastive Linguistik im Fremdsprachenunterrichtist als Hilfsmittel zu betrachten ,so könnte dadurch die Vermittlung schwieriger Kapitel erleichtert werden,ebenso dient sie dazu, beim Erlernen einer Sprache die Interferenzfehler zu beseitigen.
Im vorliegenden Beitrag setzen wir uns mit der Negation als universale Kategorie und als sprachliche Erscheinung auseinander. Ein Blick in die Literatur zeigt,dass das Phänomen “Negation” in der Linguistik große Beachtung findet.Die zahlreichen Untersuchungen zu dieser Problematik sind ein Beweis dafür.In jeder Grammatik findet diese Erscheinung großen Raum.
Unsere Studie setzt sich zum Ziel, Negationsträger im Deutschen und im Arabischen zu untersuchen, genauer gesagt, die unterschiedlichsten Ausdrucksweisen der Negation in den beiden Sprachen darzustellen und sie unter verschiedenen Aspekten zu vergleichen.
Was versteht man unter dem Begriff Negation?
Die Negation ist wie bereits erwähnt wurde, ein universales Phänomen, ein Mittel, das dazu dient, was eine Person glaubt, zurückzuweisen, zu verneinen usw.
Diesbezüglich kann man bei Helbig/ Buscha (2004:544) folgendes nachlesen:
„Als kommunikative Handlung ist die Negation eine Stellungnahme des Sprechers zu einem sprachlichen (oder nichtsprachlichen) Antecedens; es wird etwas in Abrede gestellt, sei es in der Art einer Zurückweisung, eines Bestreitens, eines Ausnehmens
oder eines Absprechens„.
Dieses sprachliche Ausdrucksmittel, das in allen natürlichen Sprachen existiert, lässt sich auf sehr unterschiedliche Weisen realisieren. Die beiden untersuchten Sprachen, nämlich Deutsch und Arabisch verfügen über eine bestimmte Zahl von Negationsträgern, mit deren Hilfe die Negation realisiert werden kann.
2. Ausdrucksmittel der Negation
Wie aus der einschlägigen Literatur ersichtlich wird,stehen zum Ausdruck der Negation nicht nur spezifische sprachliche Mittel zur Verfügung, sondern auch unspezifische, wie nonverbale Mittel (z.B. Kopfschütteln oder Schwanken des Zeigefingers).
Die gerade genannten Mittel, die dem Bereich der nonverbalen Kommunikation gehören, werden in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt. Bekanntlich ist, dass zu den spezifischen sprachlichen Mitteln der Negation im Deutschen explizite Negationsträger zu zählen sind, wie Negationswörter, die als frei vorkommende Lexeme gebraucht werden.
Dazu gehören: nein, nicht, nichts, niemand, nie, nimmer, niemals, nirgends, nirgendwo, nirgendwohin, nirgendwoher, kein, keinesfalls, keineswegs, weder…noch, ……
Diese Negationsträger werden unterschiedlichen Klassen zugeordnet:
Beineinhandelt es sich um ein Satzäquivalent.
Bei niemand um ein substantivisches Pronomen.
Bei nie, niemals, nirgendwo um Adverbien.
Bei weder….noch um eine Konjunktion.
Bei kein kann es sich um ein substantivisches Pronomen handeln (in keiner hört zu) oder um ein Artikelwort (er isst keine Suppe).
Die Negation kommt nicht immer mit Hilfe von Negationswörtern zum Ausdruck, sondern auch durch andere sprachliche Mittel, die Helbig/ Buscha als Konkurrenzformen für die Negationswörter betrachten. Gemeint sind dabei die Wortbildungsmittel wie verneinende Präfixe und Suffixe. So erhalten z.B.manche Adjektive eine Sondernegation durch das Präfix un-: Der Vortrag ist uninteressant.
Manche Substantive erhalten ebenso das Präfix un-: Unglück, Unverschämtheit. Negationsträger: ein Begriff von W. Weiβ 1961.
Das Präfix ver- drückt bei manchen Verben eine negative Bedeutung aus:
-Er hat sein ganzes Vermögen verloren = Er hat kein Vermögen mehr.
Ebenso das Präfix miss-, das auch Adjektive oder Substantive verneinen kann: missverstehen/ Missverständnis.
Eine Negation kann auch mit manchen Sufixen zum Ausdruck gebracht werden, wie z.B. –los, oder –frei: sinnlos, koffeinfrei.
Die Negation kann auch durch bestimmte morphosyntaktische Negationsträger implizit realisiert werden, z.B. mit Hilfe von Konjunktionen; z.B: Er kommt, ohne dass er ihn informiert / ohne ihn zu informieren. (er informiert ihn nicht)
Er spricht anstatt er zuhört (Er hört nicht zu).
Im Gegensatz zu Helbig / Buscha, die diese Art von Negation als Konkurrenzform für die Negationswörter betrachten, bezeichnet sie Kürschner als formale Negationsträger.
Auch mit dem Gebrauch des Konjunktivs II in irrealen Konditionalsätzen wird die Negation implizit ausgedrückt:
Wenn wir viel Geld gehabt hätten, hätten wir uns ein groβes Haus gebaut. (= Wir haben nicht viel Geld gehabt, wir haben uns kein groβes Haus gebaut).
Auβerdem gibt es einige Verben, die als lexikalische Negationsträger eine Negation implizit zum Ausdruck bringen.
a-Verben des Zurückweisens (wie widerlegen, ablehnen)
b-Verben des Verneinens (verneinen, negieren): Er verneint es, den Brief geschrieben zu haben. = Er hat den Brief nicht geschrieben.
c- Verben des Verbietens (z.B. verbieten, hindern)
d-Verben der Weigerung (z.B. sich weigern, verzichten auf).
Die Duden-Grammatik erwähnt einige Lexeme und Verbindungen, die die Negation wiederspiegeln können wie:
-Etwas kommt aus der Mode (Etwas ist nicht mehr Mode)
-Er war ohne Begleitung (Er hatte keine Begleitung).
Jung seinerseits nennt einige abwertende Substantive wie (Dreck, Henker, Teufel), die ohne besondere spezifische sprachliche Mittel die Negation ausdrücken.
-
Ich kümmere mich um einen Dreck darum. (Ich kümmere mich gar nicht darum).
-
Weiβ der Teufel, wo der Zettel steckt. (Ich weiβ nicht, wo er steckt).
Kürschner (1983, 267) ist der Ansicht, dass Lexeme wie kaum, wenig und selten sich wie negative verhalten können:
-
Er wird mich kaum besuchen (höchstwahrscheinlich nicht)
-
In beiden Mannschaften traten die bisher genannten negativen Aspekte kaum auf. (Hier wird kaum im Sinne von nicht verwendet).
3. Negationsträger im Arabischen
Wie alle Sprachen verfügt das Arabische auch über sein eigenes System von Negationsträgern.
Abgesehen von ليس,das konjugierbar ist (ليس ٬ لست ٬ ليست), und zur Negierung von Prädikativen mit „sein„ gebraucht wird (also nicht sein) werden die Negationswörter (كلا ٬ لا„nein„) ما ٬ لن ٬ لم ٬ لا im Arabischen als Partikeln betrachtet (حروف النفي )
Manche Verneinungspartikeln treten nur zusammen mit einem Verb auf.
„لا„ dient der Verneinung von Handlungen im Präsens :لا يقرٲ
Diese Verneinungspartikeln werden auch zur Negierungdes Imperativs gebraucht. In dieser Verwendung (+Apokopat = أي الجزم ) wird لا الناهية „لا„ genannt,das heißt لاdes Verbietens:
لا تتحدث عن الآخرين
لا تفعل ﺫلك
„لم„auch + Apokopat (الجزم) dient der Verneinung der Handlungen,die in der Vergangenheit statt gefunden haben: Er hat das Buch nicht gelesen. = لم يقرٲ الكتاب
„لن„(+Konjunktivأي النصب ) fungiert auch als Verneinungspartikel für Handlungen,die in der Zukunft stattfinden werden. لن يقرٲ الكتاب
Mit“ما“ + Perfekt werden Handlungen in der Vergangenheit negiert: Er hat das Buch nicht gelesen = ما قرٲ الكتاب
DieseVerneinung mit „ما“ wird vor allem in der Umgangssprache gebraucht. Zu betonen ist, dass „ما“ als Synonym für „لم„ Anwendung finden kann. لم يقرٲ الكتاب
3.1 Verneinungspartikeln beim Substantiv
لا + Substantiv : das nachfolgende Substantiv steht artikellos imAkkusativ mit der Bedeutung „es gibt absolut nichts”لا شك في ﺫلك
Kein Wunder لا عجب
Sinnlos لا فائدة من
Ich habe nichts لا شيء عندي
Er hat keine Schuld لا ذنب له
3.2 Verneinungspartikeln beim Adjektiv
Wie im Deutschen können einige Adjektive im modernen Arabischen auch verneint werden. Die Verneinungspartikel „لا“ kann gelegentlich diese Funktion übernehmen. (Kompositum)
unmoralisch لا أخلاقي
unmenschlich لا إنساني
nicht kapitalistisch لا رأسمالي
irrational لا معقول
Zur Negierung von Adjektiven wird auch „غير„ verwendet.
unbegrenzt غير محدود
unmenschlich غير إنساني
unmöglich غير ممكن
unkoordiniert غير منسق
indirekt غير مباشر
„„عدم„Nichtsein„ , „Nicht vorhanden sein „dient ebenfalls zur Verneinung von determinierten Substantiven.
Die Nichtübereinstimmungعدم الاتفاق
Die Nichteinmischung عدم التدخل
Die Instabilität عدم الاستقرار
Im Gegensatz zu“لا“ steht „عدم„nie vor Adjektiven.
„دون“ ٬ „بلا“ ٬ „بغير„, die arabischen Äquivalente für die Präposition „ohne „treten des gleichen als Negationsträger auf : Ohne Zweifelدون شك ٬ بغير شك
Mit Hilfe der (Sub) Konjunktion دون أن = „ohne dass„, verbunden mit einem Verb im Konjunktiv Präsens (المضارع المنصوب) kann eine Negation ebenfalls realisiert werden, ohne dass er etwas gesagt hätte. دون أن يقول شيئ = ohne etwas zusagen.
Tritt„دون„ mit der Präposition„ب„auf , so wirdesflektiert . بدون شك
Das Arabische verfügt ebenfalls über eine Reihe von Verben, die man als Negationsträger bezeichnen kann. So können Verben wie حذر oder شك eine negative Aussage implizit zum Ausdruck bringen.
ٳنه يحذرها من التقصير في العمل =.Er warnt sie, die Arbeit zu versäumen
ٲشك في ٲنه سيحضر )لن يحضر (Ich zweifle, dass er kommt (höchstwahrscheinlich nicht) (
Desgleichen ist es bei Wunsch- und Konditionalsätzen:
Wenn er doch gekommen wäre! لو كان قد حضر
) لم يحضر (
Mit dem Adverb أبدا , das im Arabischen kein Negationswort ist, kann man auch eine negative Bedeutung zum Ausdruck bringen.
4. Vergleich zwischen den deutschen und den arabischen Negationsträgern
Nach dieser kurzen Gegenüberstellung der deutschen und der arabischen Negationsträger sind wir zu der Feststellung gekommen, dass es gewisse Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede in diesem Bereich gibt. Zunächst einmal ist zu bemerken, dass die Negationsträger im Deutschen umfangreicher sind als im Arabischen. Mit Ausnahme von niemand und kein sind fast alle Negationsträger im Deutschen unflektierbar.
Im Arabischen sind fast alle Verneinungspartikeln unflektierbar, auβer der verneinten
Kopula „ليس„ , die sich s wie ein Verb verhält und sich dann in Genus und Numerus konjugieren lässt.
Je nach der Art der Negation, d.h. Satz-oder Sondernegation gibt es im Deutschen bestimmte Regeln für die Stellung des Negationswortes „nicht„.
Hingegen tauchen die arabischen Verneinungspartikeln immer in präverbaler Position in Verbalsätzen auf. In Nominalsätzen stehen sie vor dem negierten Glied.
Diese Spitzenstellung betrifft auch die negierende Kopula ليس„„.
Im Deutschen gibt es Affixe, die dazu dienen, Adjektive zu verneinenen (un-, -los, -frei). Im Arabischen übernehmen لا,غيـرundدون diese Funktion.
Mit Hilfe einiger Präpositionen und Konjunktionen wird in den beiden Sprachen eine Negation zum Ausdruck gebracht. In den beiden Sprachen können, bestimmte Verben wie sich weigern, verzichten auf,….رفض ٬ حذر auch als Negationsträger fungieren. An dieser Stelle sollte es nicht unerwähnt bleiben, dass die Negation im allgemeinen jedem Deutschlernenden auβerordentliche Schwierigkeiten bereiten, eine Beobachtung, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit wiederholt machen könnte.
Literaturverzeichnis
Duden Grammatik (2009): Dudenredaktion, 08 Neue übergearbeitete Auflage, Mannheim, Bibliographisches Institut AG- Mannheim.
Helbig/ Bucha (2017): Übungsgrammatik, Ernst Klett Sprache, GmbH, Stuttgart.
Kürschner, Welfried (2016): Zu Studien zur Negation im Deutschen, neue erarbeitete Auflage, Stauffenberg Verlag.
Heinemann, Wolfgang (1983): Negation und Negierung, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig.