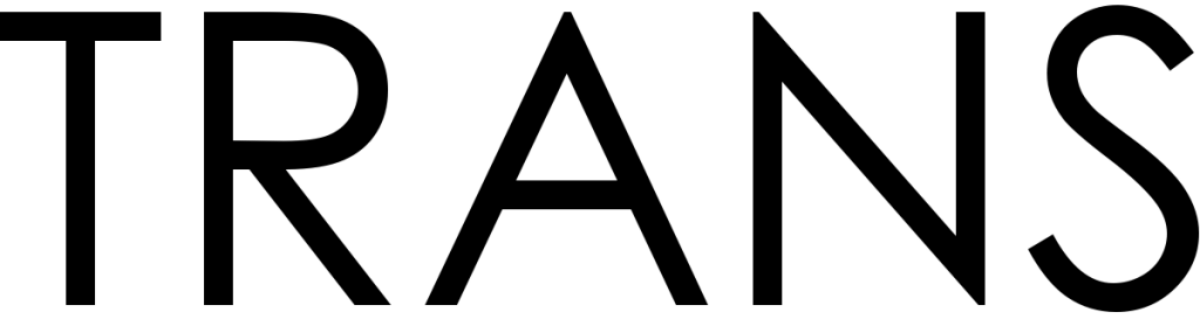Naoji Kimura (Tokio)
1. Deutsche Klassiker unter den Japanern
Als zentrales Thema des Essener Diskussionsabends „Goethe und die Deutschen – ein Blick nach außen“, das am 12. Januar 2004 im Kulturwissenschaftlichen Institut am Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen stattfand, ist mir die Frage nach dem Deutschlandbild gestellt worden, das die heutige Rezeption der deutschen Klassiker, vor allem von Goethe, vermittelt. Da hieß es u.a.: Inwieweit gibt es in den einzelnen Kulturen überhaupt noch eine Klassikerrezeption, die Weltbilder, Bilder von Nationen und Zivilisationen beeinflusst? Als der amerikanische Germanist Wolfgang Leppmann frühzeitig sein Buch Goethe und die Deutschen. Vom Nachruhm eines Dichters (W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1962) veröffentlichte, scheint noch die Bezeichnung „Klassik“, „klassisch“ oder „Klassiker“ allgemein unumstritten gewesen zu sein, wenngleich bereits im Jahre 1929 vom „Klassikertod“ die Rede war. (Vgl. Bertolt Brecht und Herbert Jhering: Gespräch über Klassiker. In: Karl R. Mandelkow, Goethe im Urteil seiner Kritiker. Teil IV 1918-1982. Verlag C.H.Beck. München 1984. S. 94-98.) Vgl. ansonsten Bernd Witte: Goethe und die Deutschen (Diskussion). In: Sprache und Literatur in Wissenschaft und Literatur. 83-1999. S. 73-89.
Literaturwissenschaftlich gibt es aber entsprechend der Kunstgeschichte einen nah-verwandten Begriff von Klassizismus, klassizistisch oder Klassizität. Deshalb möchte ich zunächst mein Verständnis der deutschen Klassiker etwas präzisieren, wiewohl es auch banal klingen mag. Goethe selbst stellte sich wohl erstmals in seinem Aufsatz „Literarischer Sansculottismus“ die Frage nach dem klassischen Autor bzw. Werk (Goethes Werke. HA. Bd. 12, S. 24). Unter „Klassikern“ verstehe ich heuristisch im Anschluss daran mustergültige Autoren vornehmlich auf den Bereichen der Philosophie und Literatur, obwohl die Sache nicht so einfach ist. Noch voriges Jahr haben Gerhard Schulz und Sabine Doering, die ich von Regensburg her gut kenne, in der Beck’schen Reihe ein Büchlein Klassik. Geschichte und Begriff publiziert. Einige Jahre zuvor hatte Gerhard Schulz auch in seinem anderen Buch ein Kapitel “Goethe und seine Deutschen. Über die Schwierigkeiten, ein Klassiker zu sein” geschrieben (Gerhard Schulz: Exotik der Gefühle. Goethe und seine Deutschen. Verlag C.H. Beck. München 1998). Bei der Unbestimmtheit des Begriffs spricht man in der Tat von Klassikern der Philosophie, Theologie, Medizin oder sogar Meditation. Aber bei dieser Essener Diskussion beschränke ich mich grundsätzlich auf die Klassiker der deutschen Literatur, die im 18. Jahrhundert im literaturgeschichtlichen Sinne in Weimar gelebt haben, also Wieland, Herder, Goethe und Schiller.
Es war Hermann Grimm, der darauf hinwies, dass man Goethe prinzipiell nach einem zwischen Objekt und Subjekt vermittelnden Bild erkennt. So sagt er in seinen berühmten Berliner Goethe-Vorlesungen (1874/75): „Was unseren Blicken an Goethe fremd zu werden anfing, war nicht er selbst, sondern nur das mit seinem Namen genannte Bild, welches die letzte Generation sich von ihm geformt hatte. Eine neue Zeit beginnt, die sich ihr eignes Bild Goethe’s von Frischem schaffen muß. Sie stürzt das alte, ihn selber aber berührt Niemand.“ (Hermann Grimm: Goethe. Vorlesungen gehalten an der Kgl. Universität zu Berlin. Achte Aufl. Stuttgart und Berlin 1903. Erster Band, S. 7). Zu den Zeiten der Reichsgründung nahm er einen anderen Standpunkt als früher ein und entwarf sein eigenes Goethebild für das deutsche Volk. Denn er meinte, die Veränderung des Standpunktes ergebe sich aus der veränderten Stellung, die man damals zu aller historischen Betrachtung überhaupt in Deutschland einnehme. Man erkennt also Goethe, wie er sich auf seiner geistigen Netzhaut je nach seinem Standpunkt widerspiegelt.
Aber nach Hermann Grimm geht es beim Goethebild nicht allein um Erkenntnisse, sondern vielmehr um eine bewusste Formung eines wirkungsvollen Goethebildes. So schreibt er zum Schluss seiner Einleitung: „Eine unserer wichtigsten Aufgaben bleibt, aus dieser Masse (= Nachrichten aus seinem Leben) heraus das Bild Goethe’s zu gewinnen, das uns am meisten fördert und dem wir am meisten vertrauen.“ (S. 19.) Wenn es sich mit dem Verständnis des Dichters so verhält, fragt sich folgerichtig nach einem Standpunkt der Japaner bei der Goetherezeption.
Es ging dabei hauptsächlich um ihr Bildungsideal (Vgl. beispielsweise Holger Burckhart, Theodor Litt: Das Bildungsideal der deutschen Klassik und die moderne Arbeitswelt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt 2003), und ein persönliches Bekenntnis dazu lautete damals in Deutschland: „Seit ich ein verantwortliches geistiges Leben zu führen versuchte, bin ich immer mehr in die Überzeugung von der Kraft, die in dem Vermächtnis der klassischen Dichtung beschlossen liegt, hineingewachsen.“ (Reinhard Buchwald: Das Vermächtnis der deutschen Klassiker. Insel-Verlag. 1946. S. 5.) Hinsichtlich dieser par excellence deutschen Klassiker spricht man aber nach der Wiedervereinigung Deutschlands auffälligerweise statt von deutscher Klassik im Gegensatz zur deutschen Romantik mehr von Weimarer Klassik. Die Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar wurden schließlich zur Stiftung Weimarer Klassik umorganisiert. Eigentlich müsste man es auch problematisieren, zumal man bald danach die deutsche Klassik sehr in Frage stellte. (Vgl. Reinhold Grimm/Jost Hermand (Hrsg.): Die Klassik-Legende. Frankfurt am Main 1971. Vorwort in: Karl R. Mandelkow, Goethe im Urteil seiner Kritiker. Teil IV 1918-1982. Verlag C.H.Beck. München 1984, S. 446-451)
In Japan war das begrifflich klärende Buch von Fritz Strich Deutsche Klassik und Romantik. oder Vollendung und Unendlichkeit unter den Germanisten bekannt genug. Aber in Deutschland scheint es heutzutage nicht mehr ernst genommen zu werden. In Japan war Gundolfs großes Werk natürlich den japanischen Gebildeten für eine Bildung des deutschen Klassikerbildes sehr bedeutsam. Aber es war vor allem Hermann August Korff, der dazu am meisten beitrug mit den japanischen Übersetzungen von Humanismus und Romantik (1926 und 1942), Faustischer Glaube (1943), Geist der Goethezeit (1. Band 1944) oder auch mit dem Buch Die Lebensidee Goethes, das noch im Jahre 1946 ins Japanische übersetzt wurde. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass Wieland trotz der Bemühungen einiger Germanisten in Japan, die die Abderiten oder Agathon relativ spät übersetzten, im literarischen Bewusstsein der japanischen Gebildeten wenig präsent ist. Herder ist zwar als Geschichtsphilosoph und Sprachdenker relativ bekannt – von seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit sind zwei japanische Übersetzungen vorhanden aus der Zeit vor und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, und seine Abhandlung über den Ursprung der Sprache wird seit 1972 in meiner Übersetzung gelesen. Vor einigen Jahren wurde auch sein Reisejournal vollständig übersetzt. Er bleibt aber dennoch mehr eine akademische Angelegenheit japanischer Germanisten. Seit etwa zehn Jahren gibt es in Japan eine sehr aktive Herder-Gesellschaft, die ihr eigenes Jahrbuch herausgibt. Zur traditionellen, sogenannten deutschen Klassik gehören also für das japanische Lesepublikum fast ausschließlich Goethe und Schiller. Es existiert denn auch keine Schiller-Gesellschaft in Japan. Bisher ist nur eine sechsbändige Werkausgabe von Schiller in der Kriegszeit erschienen, während es von Goethe mehr als zehn vollendete und unabgeschlossene Goetheausgaben in japanischer Sprache gibt.
Die Goethe-Gesellschaft in Japan besteht seit 1931, um im darauffolgenden Jubiläumsjahr den ersten Band des japanischen Goethe-Jahrbuchs herausgeben zu können. Es erscheint nach Unterbrechung mit dem 11. Band seit 1959 bis heute in neuer Folge. Die Koreanische Goethe-Gesellschaft ist im Jahre 1982 gegründet worden, und sowohl die Chinesische als auch die Indische Goethe-Gesellschaft sind im Jahre 1999 ins Leben gerufen worden. Ich kenne alle koreanischen, chinesischen und indischen Präsidenten persönlich. In Korea sind zwei teilweise erschienene Goetheausgaben noch lange nicht vollendet, aber in China hat mein Kollege Yang Wuneng im Goethejahr 1999 aus bereits vorhandenen Übersetzungen eine vierzehnbändige Goetheausgabe zustande gebracht. In Indien scheint man Goethes Werke ohne weiteres in englischen Übersetzungen zu lesen. Im vergangenen Goethejahr habe ich an meiner früheren Universität Sophia in Tokyo in Kooperation mit dem Goethe-Institut Tokyo ein internationales Goethe-Symposium „Goethe – Wirkung und Gegenwart“ veranstaltet. Bei der Gelegenheit habe ich auch eine umfangreiche Goethe-Bibliographie in japanischer, koreanischer und chinesischer Sprache zusammengestellt. Sie ist zusammen mit allen dort gehaltenen und später in Deutsch publizierten Beiträgen zum Symposium im Internet abrufbar. Es handelt sich hierbei um die nachstehend genannten Vortragstexte:
Wilhelm Voßkamp, Köln: Bildung als „deutsche Ideologie“?
Zhang Yushu, Peking: Goethe und die chinesische Klassik
Manfred Osten, Bonn: Goethes Faust – die Tragödie der modernen Übereilung
Kim Tschong-Dae, Seoul: Goethe in der koreanischen Kultur
Walter Hinderer, Princeton: „Hier, oder nirgends ist Amerika“. Anmerkungen zu Goethe und
die neue Welt
Rhie Won-Yang, Ansan: Goethes Faust auf der koreanischen Bühne. Überlegungen zur
Rezeption in Korea
Adolf Muschg, Zürich: Schweizer Spuren in Goethes Werk
Yan Wuneng, Chengdu: Goethe-Rezeption in China. Vom Werther-Fieber zum Werther-
Übersetzungseifer
Werner M. Bauer, Innsbruck: Goethe in Österreich
Terence J. Reed, Oxford: Englische Literatur als Weltliteratur
Naoji Kimura, Tokyo: Goethe und die japanische Mentalität
Lothar Ehrlich, Weimar: Der fremde Goethe. Die Deutschen und ihr Dichter
- Goethes Wirkungsgeschichte in Asien
Bei der rezeptionsgeschichtlichen Fragestellung gehe ich davon aus, daß die japanische Goetherezeption im Grunde genommen eine etwa um eine Generation verspätete Nachwirkung der Goetherezeption bzw. Goetheforschung in Deutschland darstellt. Denn um überhaupt von den Japanern rezipiert werden zu können, müssen Goethes Werke zuerst ins Japanische übersetzt werden. Da diese Übersetzungen mehr oder weniger sprachlich und sachlich kommentiert werden sollen, müssen sich die Germanisten als Übersetzer mit der Stoff-, Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der betreffenden Werke intensiv beschäftigen. Dadurch ist spontan eine japanische Goetheforschung entstanden, die meist von der deutschen Goetheforschung abhängig war. Es versteht sich von selbst, dass die Leser dann von ihren Forschungsergebnissen stark beeinflusst werden.
Wenn ein individueller Geist wie einzelne deutsche Klassiker allgemein-menschlich geworden ist, gehört er auf diese Weise über den Nationalgeist, zum Beispiel über den deutschen Geist hinaus in die ganze Welt, auch wenn dieser Literaturprozess mit dem komplexen Sprachproblem der Übersetzung behaftet ist. Was an ihm unübersetzbar ist, erweist sich zwar als spezifisch national, kann aber in seiner Originalsprache einigermaßen verstanden werden. Sein Weg zu einer fremden Nation läßt sich um so leichter anbahnen, als die herausragende Wertschätzung seiner Werke von Anfang an feststeht, wie es gerade bei Goethe der Fall ist. Sein literarisches Schaffen beruht offensichtlich auf dem Ewig-Menschlichen. Das heikle Problem, wie es z.B. in dem Buch Klassikerstadt und Nationalsozialismus. Kultur und Politik in Weimar 1933 bis 1945 (Herausgegeben von Justus H. Ulbricht im Rahmen der Weimarer Schriften. Weimar 2002) aufgegriffen wird, ist erst nach dem Krieg unter den Fachkreisen bekannt geworden, auch wenn die japanische Goetheforschung selbst damals schon im Schatten der völkischen Literaturwissenschaft gestanden hatte. Darüber habe ich auf dem IVG-Kongress 2000 in Wien eingehend berichtet.
Das war die grundlegende Situation für eine andauernde Goetherezeption in Japan. Als die japanischen Gebildeten am Ende des 19. Jahrhunderts anfingen, Goethe nicht nur zu lesen, sondern auch sich mit ihm literaturwissenschaftlich zu beschäftigen, standen ihnen bereits viele Goethe-Bücher zur Verfügung. Zuerst haben sie Goethe in englischer Übersetzung gelesen und wie z.B. Reineke Fuchs auch daraus ins Japanische übersetzt. Aber im Jahre 1904, also genau vor hundert Jahren, erschienen die ersten Übersetzungen des Werther sowie des Faust aus dem deutschen Originaltext, und seitdem kann das japanische Publikum fast alle Werke Goethes in verschiedenen Übersetzungen lesen. Nähere Einzelheiten darüber habe ich in meinem 1997 beim Peter Lang Verlag, Bern erschienenen Sammelband germanistischer Aufsätze Jenseits von Weimar. Goethes Weg zum Fernen Osten ausführlich dargelegt.
Es handelt sich dabei sowohl um Goethes literarische Werke als auch um seine naturwissenschaftlichen und literatur- bzw. kunstheoretischen Schriften. Es gibt wie gesagt bis jetzt mehrere Goethe-Ausgaben in japanischer Sprache, die alle diese Werke umfassen. Außerdem hat man im Laufe der Zeit eine Menge deutscher Fachliteratur über Goethe ins Japanische übersetzt. Selbstverständlich haben die Japaner selbst ebenfalls eine Unmenge literaturwissenschaftlicher Aufsätze oder literarischer Essays geschrieben. Da sie im Großen und Ganzen bibliographisch erfasst sind, kann man die Goetherezeption in Japan schriftlich belegen und analysieren, wie Karl Robert Mandelkow das für die Goetherezeption in Deutschland geleistet hat.
So läßt sich eine japanische Geistesgeschichte der neueren Zeit im Spiegel der Goetherezeption beschreiben. Dabei sind hinsichtlich Goethes Wirkungen auf Japan zeitlich fünf Routen festzustellen. Es sind gleichzeitig fünf verschiedene Aspekte der Goetheforschung in Europa, die sich auf das Goethebild der Japaner ausgewirkt haben:
1) Englische Route über Thomas Carlyle und Ralph Waldo Emerson – philosophisch
2) Berliner Route über Hermann Grimm und den Dichtergelehrten Mori Ogai – literarisch
3) Goethe-Philologie durch die Jubiläums-Ausgabe – philologisch
4) Russische Ideologiekritik – marxistisch
5) Französische Goetheverehrung im Goethejahr 1932 – essayistisch.
Die Goetheforschung in England halte ich für sehr wichtig. Sie wird leider von den japanischen Germanisten meist geringgeschätzt, zumindest nicht so hochgeschätzt wie die deutsche. Aber Hermann Grimm war nicht zuletzt von Thomas Carlyle inspiriert, als er sein für die japanische Goetherezeption folgenreiches Goethebild entwarf. Die erste lesbare Goethe-Biographie von George Henry Lewes: Life and Works of Goethe (1855) erreichte in deutscher Übersetzung immerhin bis 1903 die 18. Auflage. In der Meiji-Zeit (1868-1912) waren ebenfalls Ralph Waldo Emersons Buch Representative men (1850) mit einem Goethe-Kapitel sowie Bayard Taylors Faust-Übersetzung mit Kommentar (Boston 1871) unter den japanischen Gebildeten sehr verbreitet. Im strengen Sinne stellten sie einen amerikanischen Beitrag zur Goetherezeption in ganz Ostasien dar. Später sollte W.H. Brufords Werk Culture and Society in Classical Weimar (Cambridge 1962) nicht nur in deutscher, sondern auch in japanischer Übersetzung einen bedeutenden englischen Beitrag zur Goetheforschung seit Lewes fortsetzen. Zu dieser Tradition gehört freilich auch Nicholas Boyles auf drei Bände angelegte Goethe-Biographie der Gegenwart.
- Geschichtliche Wandlungen des japanischen Goethebildes
Die davon angeregte Goetherezeption in Japan erfuhr auf diese Weise eine sprachliche wie auch geistige Metamorphose. Die japanische Goetheforschung, die seit den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts an den germanistischen Abteilungen der Staatsuniversitäten etabliert hatte, erreichte im Verlauf der oben geschilderten Rezeptionsgeschichte seit der Meiji-Zeit ihren ersten Höhepunkt in der Säkularfeier des Jahres 1932. Die japanischen Germanisten haben damals in Berlin oder Leipzig die Goethe-Philologie studiert, die ihnen in der gediegenen Jubiläums-Ausgabe die besten Hilfsmittel zur Verfügung stellte. Die erste Weimarer Ausgabe in Japan wurde ihnen bei der Gründung der Goethe-Gesellschaft im Jahre 1931 von der deutschen Botschaft der Weimarer Republik geschenkt. Von den bekannten positivistischen Goethe-Biographien wurde diejenige von Karl Heinemann (1895) in japanischer Übersetzung in der renommierten Iwanami-Taschenbuchreihe publiziert. Die im Japanischen dreibändige Goethe-Biographie von Albert Bielschowsky (1896) konnte erst in den letzten Kriegsjahren erscheinen. Die von Walter Linden bearbeitete Neuausgabe (1928) wurde anachronistisch vor etwa zehn Jahren ins Japanische übersetzt.
Frühzeitig übersetzt wurden ansonsten die geistesgeschichtlich ausgerichteten Goethe-Bücher wie z.B. von Georg Simmel (1913), Friedrich Gundolf (1916) oder Hermann August Korff (Geist der Goethezeit, allein 1. Band). Dadurch wurde vor allem Gundolfs Auffassung von Goethes Titanismus in Japan sehr populär, und Korffs goethischer Humanismus bzw. faustischer Glaube riefen unter den japanischen Gebildeten fast eine humanistische Religion hervor. Für sie kam ein Vorstoß ins Metaphysische durch die geistesgeschichtliche Betrachtungsweise sehr gelegen, aber auch ein Goethe-Mythos war innerlich naheliegend, weil sie keine andere Religion hatten. So stellte sich Goethes Autobiographie Dichtung und Wahrheit für sie als irreführend heraus. Hieß sie doch ursprünglich „Wahrheit und Dichtung“, d.h. Tatsächlichkeit und dichterische Wahrheit, mit anderen Worten Faktizität und Fiktion oder Realität und Idealität. Damit war der Vorrang des Werkes vor dem Leben angedeutet, sodass sich Goethes geistige Welt dem japanischen Lesepublikum stets als eine ideale Welt zeigte. Daher wurde ein klassisches Humanitätsideal für immer der Wirklichkeit der jeweiligen Gegenwart gegenübergestellt. Je niedriger die Wirklichkeit ist, desto höher erscheint das Idealbild der Klassik. So ist es mit dem japanischen Goethebild weitgehend bis heute noch bestellt.
Dagegen wurde Goethekritik der hauptsächlich russischen Marxisten – Goethe als bürgerlicher Bildungsphilister – immer wieder in japanischer Übersetzung herbeigeholt. Heinrich Heine wurde dabei von den japanischen Marxisten zu seinem Schaden vielfach als Vorkämpfer der sozialistischen Revolution vereinnahmt. Als aber die radikale Linke-Bewegung in den zwanziger Jahren allmählich unterdrückt und brutal verfolgt wurde, wurden aus nicht wenigen Marxisten durch einen Gesinnungswechsel ästhetische Goetheaner mit nationalistischem Einschlag, die die sogenannte „Japanische Romantische Schule“ bildeten. Zu jener Zeit erschien jedoch eine japanische Übersetzung von Paul Valérys Discours en l’honneur de Goethe (1932). Hier wurde Goethes Weltbürgertum mit dessen Naturforschung und Universalismus hervorgehoben. Zwischen links und rechts stand Goethe in der Mitte wie später auch bei T.S. Eliot in seinem im Mai 1955 an der Universität Hamburg gehaltenen Vortrag Goethe as the Sage.
Zum Goethejahr 1932 erschien u.a. eine stattliche Festschrift in japanischer Sprache, zu der Thomas Mann und Fritz Strich je einen Beitrag beisteuerten. Deutschland wurde gerade in der ganzen Welt als eine Nation der Dichter und Denker gefeiert. Aber Thomas Mann hatte sich bereits im Lessingjahr 1929 gegen den aufkommenden antiaufklärerischen, nationalistischen Irrationalismus ausgesprochen. Eine Warnung vor dem deutschen Nationalismus war denn auch in seinem eben erwähnten Beitrag „An die japanische Jugend“ (In: Goethe-Studien. Japanisch-deutscher Geistesaustausch, Heft 4. Japanisch-Deutsches Kultur-Institut. Tokyo 1932, S.1-15) enthalten. Fritz Strich war ebenfalls gegen das “chthonische Gelichter” der raunenden Beschwörer der Inhumanität im Sinne des Nationalsozialismus eingestellt und deutete es besorgnisvoll in seinem Beitrag „Goethe und unsere Zeit“ (Ebenda, S. 16-36) an. Von japanischer Seite wurde ein Goethe-Aufsatz des bedeutendsten Philosophen Japans, Nishida Kitaro, veröffentlicht: Der metaphysische Hintergrund Goethes. In: Goethe. Vierteljahresschrift 3. Bd. (1938), S. 135-144. Die von ihm begründete Kyoto-Schule war von den Neukantianern Windelband sowie Rickert oder auch Kuno Fischer in Heidelberg sehr beeinflusst. In Kyoto gibt es übrigens einen Philosophenweg nach dem Heidelberger Vorbild.
Man könnte wohl sagen, dass die Goetherezeption in Japan mit der Kaizosha-Goetheausgabe 36 Bände (1935/40) ihren Gipfel erreichte. Einige Jahre zuvor hatte Einstein auf Einladung des Kaizosha-Verlags Japan besucht, und der japanische Physiker Ishihara Jun übersetzte nicht nur seine Werke, besonders die Relativitätstheorie, sondern auch Goethes Farbenlehre didaktischer Teil erstmals ins Japanische. Das japanische Lesepublikum erkannte daran die hohe Bedeutung der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes. Nach dem Zweiten Weltkrieg erschien 1961 in Kyoto, wo die Japanische Goethe-Gesellschaft gegründet worden war, die Jinbunshoin-Goetheausgabe. Die Werkausgabe enthielt im 12. Band die nachstehend genannten Aufsätze und Essays in japanischer Übersetzung: Thomas Mann: Phantasie über Goethe, Hans Carossa: Wirkungen Goethes in der Gegenwart, Hermann Hesse: Dank an Goethe, Johannes Robert Becher: Der Befreier, Paul Valéry: Discours en l’honneur de Goethe, Andre Gide: Goethe, T.S. Eliot: Goethe as the Sage, Jose Ortega y Gasset: Um einen Goethe von innen bittend, Benedetto Croce: Dell’exmonaco pugliese, Domenico Giovinazzi: che insegne l’italiano al Goethe fanciullo (Goethes Italienischlehrer), Julius Bab: Das Leben Goethes.
Das von diesen Autoren vermittelte Goethebild der japanischen Gebildeten kann man in etwa folgendermaßen zusammenfassen: der große Europäer (Thomas Mann), der Humanist Goethe (Hermann Hesse), der Naturwissenschaftler Goethe (Rudolf Steiner, Paul Valéry, Albert Schweitzer, u.a.m.), schließlich Goethe der Universale (Paul Valéry). Bewundernswürdig erscheinen ihnen somit Reichtum, Breite und Weite des Weimarer Klassikers, insofern er nicht nur Dichter, sondern auch Naturforscher, Kunsthistoriker, Literaturkritiker, Philosoph, nicht zuletzt Politiker gewesen ist. Damit sind auch die Vorteile einer Goetheforschung für einen japanischen Germanisten gegeben. Darf er sich doch erlauben, von der Germanistik aus Grenzüberschreitungen zu verschiedenen Disziplinen zu unternehmen, sodass er eventuell als allseitig gebildet angesehen werden könnte, wenn er nicht gerade einem seichten Dilettantismus anheimgefallen ist.
In den oben genannten Schriften war allerdings das humanistische Goethebild der im besten Sinne europäischen Goetheaner in den dreißiger Jahren nachgeholt. Um es sozusagen zu aktualisieren, bot dann die zum Goethejahr 1982 hin herausgegebene Ushio-Goetheausgabe (Paperbacks 2003) einen Sonderband mit Hans Mayer (Hrsg.): Goethe im zwanzigsten Jahrhundert. Spiegelungen und Deutungen (Insel Verlag. Frankfurt am Main 1987). Darin war das facettenreiche Goethebild der Gegenwart noch deutlicher hervorgehoben durch folgende namhaften Autoren.
Thomas Mann: Goethes Werther
Ernst Bloch: Der junge Goethe, Nicht-Entsagung, Ariel
Max Kommerell: Goethes große Gedichtkreise
Paul Rilla: Wilhelm Meisters Theatralische Sendung (nicht übersetzt)
Elizabeth M. Wilkinson: Torquato Tasso (Nicht übersetzt)
Hermann Hesse: Wilhelm Meisters Lehrjahre
Emil Staiger: Goethe: „Novelle“
Hugo von Hofmannsthal: Einleitung zu einem Band von Goethes Werken enthaltend die Opern und Singspiele
Rudolf Alexander Schröder: Goethes „Natürliche Tochter“
Walter Benjamin: Goethes Wahlverwandtschaften
Wolfgang Schadewaldt: Faust und Helena
Eduard Spranger: Goethe über sich selbst
Siegfried Unseld: Goethes „Tagebuch“ – ein „höchst merkwürdiges“ Gedicht
Adolf Muschg: „Der Mann von fünfzig Jahren“ („Wilhelm Meisters Wanderjahre“)
Heinrich Wölfflin: Goethes Italienische Reise
Erich Trunz: Goethes späte Lyrik
Theodor W. Adorno: Zum Klassizismus von Goethes Iphigenie (statt: Zur Schlußszene des Faust)
(Pierre Bertaux: Die erotischen Spiele)
Ernst Robert Curtius: Goethe als Kritiker
Leo Kreutzer: Inszenierung einer Abhängigkeit. Johann Peter Eckermanns Leben für Goethe
Georg Lukács: Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe
Gottfried Benn: Goethe und die Naturwissenschaften
Werner Heisenberg: Die Goethesche und die Newtonsche Farbenlehre im Lichte der modernen Physik
Der Sammelband von Hans Mayer (Spiegelungen Goethes in unserer Zeit. Limes-Verlag. Wiesbaden 1949) enthielt ursprünglich Goethe-Studien von Walter Benjamin (Goethes Wahlverwandtschaften), Hugo von Hofmannsthal (Unterhaltung über den „Tasso“ von Goethe; Goethes „West-östlicher Divan“), Georg Lukács (Das Zwischenspiel des klassischen Humanismus), Karl Kerény (Das Ägäische Fest. Die Meergötterszene in Goethes Faust II), Thomas Mann (Phantasie über Goethe), Emil Staiger (Goethes Novelle), Edmond Vermeil (Revolutionäre Hintergründe in Goethes Faust) und Heinrich Wölfflin (Goethes italienische Reise). Wenn Goethe letztendlich als der große Europäer und Humanist angesehen wird, muss er sich sicherlich auch für die Idee der EU als richtungsweisend erweisen. Vgl. den zum Goethejahr 1999 von Volkmar Hansen herausgegebenen Katalog „Europa, wie Goethe es sah“ in Verbindung mit Gonthier-Louis Fink und Alberto Destro.
Von entscheidender Bedeutung für die japanische Goetherezeption erscheint mir darüber hinaus die Tatsache, dass in den zwanziger Jahren die Japaner von den deutschen Philosophen die Differenzierung der Kultur von westlicher Zivilisation gelernt haben und heute noch dazu neigen, zwischen geistiger Kultur und materieller Zivilisation zu unterscheiden. Da es Goethe wunderbar gelungen ist, beides zu vermitteln, gilt er meiner Meinung nach als der Weise. Vor dem Krieg hatten die Japaner bekanntlich großen Respekt vor deutscher Medizin und Naturwissenschaft ebenso wie vor Philosophie und Literatur, aber nach dem Krieg haben sie sich in Naturwissenschaft und Technik ganz nach Amerika ausgerichtet und suchen im alten Europa, besonders im deutschen Sprachraum, vorwiegend nach Kultur. Zivilisation im engeren Sinne bezieht sich für sie immer noch auf moderne Technik und bezeichnet erst im weitesten Sinne des Wortes Kulturkreise in größerem Umfang wie beispielsweise orientalische, indische oder chinesische Zivilisation.
Von Deutschland haben die Japaner selbstverständlich ein bestimmtes Nationenbild, das schon aus der Vorkriegszeit stammt und aus geschichtlichen Gründen meist preußisch ausgeprägt ist. Ein japanischer Offizier konnte ja eine preußische Armee kommandieren, weil er so ausgebildet worden war. Es ist aber genau so klischeehaft wie im Hinblick auf Japan, also Fujiyama, Geisha, Harakiri oder Kamikaze-Flieger. Heutzutage ist es harmlos erweitert worden auf Ikebana, Teezeremonie, Sushi oder Haiku bzw. Renga. Auf der anderen Seite bestand Deutschland vor der Wende für japanische Touristen nur aus drei Häusern: Beethovenhaus in Bonn, Goethehaus in Frankfurt und Hofbräuhaus in München. Jetzt besteht es für sie aus vielen Straßen: Romantische Straße, Märchenstraße, Weinstraße, Goethestraße, Klassiker-Straße usw. Buchenwald oder Dachau möchten sie nicht gern besuchen, weil diese Orte mit ihrem lange gehegten schöngeistigen Deutschlandbild nicht übereinstimmen. Eine Auseinandersetzung mit dem Problem nimmt schon viel geistig-intellektuelle Anstrengungen in Anspruch. Richard Alewyns Diktum “Zwischen uns und Weimar liegt Buchenwald” (Goethe als Alibi. 1949) dürfte nur den Fachkreisen bekannt sein. Er sagte ferner: „Was aber nicht geht, ist, sich Goethe zu rühmen und Hitler zu leugnen. Es gibt nur Goethe und Hitler, die Humanität und die Bestialität.“ Aber die meisten Japaner wären mehr daran interessiert, in ihrem Leben einmal auf den Kickelhahn bei Ilmenau zu steigen, weil das Gedicht “Wandrers Nachtlied” unter dem japanischen Lesepublikum in über 40 verschiedenen Übersetzungen verbreitet ist. Ebenso zieht doch der heilige Berg Fuji viele Europäer, besonders deutsche Touristen, zum Bergsteigen an.
Wenn das Geburtshaus Goethes in Frankfurt ein Wallfahrtsort für die Japaner geworden ist, so ist doch zu fragen, wie viele Japaner noch das Düsseldorfer Goethe-Museum mit ihren optischen Experimentierapparaten besuchen. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands hat man hauptsächlich den Japanern zuliebe sofort eine Goethestraße zwischen Frankfurt und Weimar oder die Klassiker Straße in Thüringen eingerichtet. Es ist aber sehr fraglich, ob sie auch das Goethe-Nationalmuseum in Weimar besuchen. Durch jahrzehntelange Kulturbeziehungen zwischen Deutschland und Japan ist das Deutschlandbild außerdem unter den japanischen Gebildeten so mannigfaltig, dass es lange nicht allein von Goethe bzw. Weimar her bestimmt ist. Im allgemeinen läßt sich wohl sagen, dass sie in Deutschland gern Kulturlandschaften besuchen, also Erinnerungs- oder Gedenkstätten der aus der deutschen Kulturgeschichte bekannten Dichter, Philosophen oder Musiker in den alten Städten aufsuchen. Trotz allem gilt Deutschland ihnen immer noch als die Nation der Dichter und Denker. Dass es in den dreißiger Jahren vorübergehend eine Nation der „Richter und Henker“ (Karl Kraus) werden konnte, ist für sie, wenn nicht unvorstellbar, so doch schleierhaft und rätselhaft. Japan war damals mit Hitler-Deutschland verbündet und hat trotz der großen Bewunderung für Goethes Humanität ebenfalls viel Unheil in Ostasien angerichtet.
Ein solches Deutschlandbild ist, nebenbei bemerkt, auch bei den Handelsbeziehungen ernst zu nehmen, liegt ihm doch eine Hochschätzung deutscher Kultur aus japanischer Seite zugrunde, wenngleich man im Deutschen über die geistige Kultur hinaus wohl von Weinkultur, aber nicht von Bierkultur spricht. Hier ist vielmehr die Vorliebe der Japaner für deutsche Gemütlichkeit zu finden. Der alte Goethe soll jeden Abend eine Flasche Wein getrunken haben, aber ich habe noch nie gehört, dass er gern Bier getrunken hätte. Dagegen hat der große Japanforscher Philipp Franz von Siebold aus Würzburg nicht nur das erste Klavier nach Japan mitgebracht, sondern auch bayerisches Fassbier immer wieder nach Nagasaki mit dem holländischen Schiff kommen lassen. Das macht schon auf die Japaner guten Eindruck. Ansonsten wird Goethewein aus dem Brentanohaus im Rheingau seit Jahren als beliebter Geschenkartikel importiert. Ich fürchte nur, dass die japanischen Studenten nach dem Umtrunk faustisch oder mephistophelisch werden und lieber Auerbachs Keller in Leipzig besuchen als das Goethe-Nationalmuseum in Weimar.
Apropos: Siebold als solcher hat mit Goethe nichts zu tun, erscheint mir aber insofern beachtenswert, als er sich noch zu Lebzeiten des Dichters, also im gleichen Jahr wie Eckermann zu Goethe, nach Japan kam und sein Förderer Nees von Esenbeck – er war Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina – der botanische Freund Goethes war und den Begründer der Metamorphosen Lehre zum Mitglied der Leopoldina ernannte. Zudem gehörten seine beiden Onkel Barthel und Elias zum Schülerkreis des Jenaer Medizinprofessors Justus Christian Loder und sie trafen in Hörsälen ab und zu mit Goethe zusammen. Dadurch muss der Name des Weimarer Dichters dem noch jugendlichen Siebold sehr vertraut gewesen sein. Leider kann ich noch nicht ermitteln, ob er seinen japanischen Schülern gegenüber den Namen Goethes erwähnt hat.
- Goethe und das japanische Bildungsbürgertum
Seit spätestens 1932 galt und gilt Goethe immerhin weltweit als einer der Repräsentanten der Menschheit. Aber er wird zu Anfang des 21. Jahrhunderts in Deutschland nicht mehr als der größte Deutsche angesehen. Dass die Deutschen Schwierigkeiten im Umgang mit Goethe haben, hat eine lange Vorgeschichte. In der deutschen Goetherezeption traten mehrmals Brüche ein, so in den Jahren 1848, 1933 oder 1968. Wenn die japanische Goetherezeption ihr langsam nachfolgt, kommt das Jahr 1968 ironischerweise in einem dialektischen Verhältnis in Frage. Als Goethe nämlich in jenen Jahren der Studentenrevolte aus der deutschen Germanistik gleichsam vertrieben zu werden drohte und in der Öffentlichkeit von Goetheferne oder Klassikerfeindlichkeit gesprochen wurde, verwies man auf die Japaner, die sich immer noch mit Goethe beschäftigten. So schrieb Kurt Reumann einen zeitkritischen Leitartikel „Unser Goethe“ in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Nr. 13 vom 16. Jan. 1979. Darin hieß es u.a.: „Schülern, die ihren Lehrer bitten, auch mal einen Klassiker durchzunehmen, kann es freilich immer noch, wie an einer Schule in Frankfurt, passieren, daß der brüsk ablehnt: auf die Nostalgie des verdammten Bildungsbürgertums lasse er sich nicht ein.“
Darauf nahm ein Artikel im Feuilleton der F.A.Z. am folgenden Tag Bezug und sprach von einer „verkehrten Welt“ und bemerkte angesichts gebildeter Japaner, die auf der Europa abgekehrten Seite des Globus leben und Goethe „nicht nur kennen, sondern auch lesen“: „So wundert es überhaupt nicht, daß jetzt die Meldung eintrifft, zwei Drittel der Besucher des Goethehauses zu Frankfurt am Main seien Japaner… So ist es nur folgerichtig, daß die Aufschriften im Frankfurter Goethehaus neben deutsch und englisch japanisch abgefaßt sind. Kein Französisch, kein Italienisch. Europa adieu! Doch vielleicht hätte er, der den Geist der Weltliteratur predigte, gar nichts dagegen gehabt.“ In Wirklichkeit waren es zum großen Teil japanische Touristen, die, mehr von Neugier als vom Bildungsbedürfnis getrieben, reiseplanmäßig von einer Sehenswürdigkeit zur anderen gegängelt wurden. Aber trotz allem könnten sie zum japanischen Bildungsbürgertum im weitesten Sinne des Wortes gezählt werden.
Geschichtlich hat es in Deutschland vor dem Bildungsbürgertum ein Besitzbürgertum gegeben, das ganz schematisch gesagt ohne Bildung sich ein Vermögen erworben hatte. Diese Vatergeneration ermöglichte ihren begabten Söhnen, sich am Gymnasium und in den Universitäten eine schöngeistige Bildung zu erwerben. So entstand das Bildungsbürgertum in Deutschland. Daraus ergab sich auch ein Vater-Sohn-Konflikt, wie es im Wien der Jahrhundertwende besonders der Fall war. Heute verfügt das Bürgertum sowohl über Besitz als auch über Bildung. Das öffentliche Bewusstsein liegt neuerdings nicht mehr beim Bildungsbürgertum, sondern bei der sogenannten Bewusstseins Industrie oder bei den Medien.
Das japanische Bildungsbürgertum im 20. Jahrhundert ist gewiss in Analogie zum deutschen Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert zu betrachten. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das japanische Schulwesen eindeutig nach deutschem Muster ausgerichtet. So wurde auf der Kotogakko genannten Oberschule Deutsch anstelle Lateins als Hauptfremdsprache gelehrt und gelernt. Als Lehrstoff dazu hat man fast ausschließlich die Texte der deutschen Klassiker auf dem Gebiet der Philosophie und Literatur verwendet, sodass die Studenten auf der Universität sich ohne weiteres anhand der deutschen Sprachkenntnisse mit allen Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften beschäftigen konnten. Es versteht sich von selbst, dass sie nicht nur die deutsche Klassik, sondern auch die deutsche Romantik mit Vorliebe gelesen haben. Aber der Schwerpunkt lag jahrzehntelang im deutschen 18. Jahrhundert, und die japanische Germanistik ist denn auch im Zuge der Goetheforschung begründet und entwickelt worden.
Auf diese Weise ging eine nachhaltige Wirkung von der Goetheforschung auf die japanischen Gebildetenkreise hervor, die mit Anglisten oder Romanisten ein Bildungsbürgertum bildeten und als Germanophilen häufig einem Goethe-Kult huldigten. Erst nach dem Krieg haben sie allmählich andere Schriftsteller der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert und nach der Jahrhundertwende kennen. Sie wurden dann Goethe gegenüber ernüchtert oder, wenn nicht ganz von ihm abgewandt, zumindest kritisch eingestellt. Seit der Goethe-Rede von Karl Jaspers “Unsere Zukunft und Goethe” (Zürich 1948), die bald ins Japanische übersetzt wurde, ist der traditionelle Goethe-Kult wohl auch in Japan endgültig zu Ende gegangen, und es war auch gut so. Die japanische Goetherezeption beruhte im Grunde auf einem humanistischen Goethebild, das wiederum verschiedene Aspekte zeigt. Das in Japan verbreitete Goethebild kann nach der Gliederung von Karl Vietor (Goethe. Dichtung – Wissenschaft – Weltbild. Bern 1949) gut analysiert werden: Der Dichter – Natur – Jugend und Sturm und Drang. Der Naturforscher – Geist – Hochklassik. Der Denker – Weisheit – Alter. In japanischer Übersetzung erschien aber nach dem Krieg nicht dieses aufschlussreiche Goethebuch, sondern etwas anachronistisch Friedrich Gundolfs Monumentalwerk in drei Bänden: Der junge Goethe, Der klassische Goethe und der alte Goethe. Vor dem Krieg war nur der 1. Band erschienen.
Bei der japanischen Goetherezeption ist allerdings in hohem Maße zu berücksichtigen, dass die Japaner Goethes Werke meist nicht im deutschen Originaltext, sondern in verschiedenen japanischen Übersetzungen lesen. Der sprachlich verwandelte Goethe ist gewissermaßen japanisiert und bietet ihnen ein anderes Bild des Dichters als bei den Deutschen. Wenn sie darüber hinaus Goethes Sekundärliteratur wieder in japanischer Sprache heranziehen, wird die Auswirkung der sprachlichen Metamorphose noch größer. Umgekehrt dürften die deutschen Goetheforscher von der 1938 durch Robert Schinzinger vorzüglichen ins Deutsche übersetzten Abhandlung des japanischen Philosophen Nishida Kitaro über den dichterischen Denker Goethe einen völlig anderen, positiven Eindruck gehabt haben als vom japanischen Original. Wenn man ferner Goethes geistesgeschichtliche Stellung zwischen Christentum nach der Aufklärung sowie Nihilismus seit Schopenhauer und Nietzsche, die Probleme von Theismus und Atheismus in der deutschen Geistesgeschichte als Hintergrund seines literarischen Schaffens überhaupt bedenkt, kann man über die Sprachbarriere nicht leicht hinwegkommen.
Im Zeitalter der neuen elektronischen Medien kommt dazu noch die Frage, ob nicht das Medium Film längst die Literatur abgelöst hat, wenn es um die Tradierung von Welt- und Nationenbildern geht. Die Frage nach der Zukunft des Buches ist freilich nicht neu. Der Freiburger Literaturwissenschaftler Gerhard Kaiser beginnt sein Buch Wozu noch Literatur? Über Dichtung und Leben (Beck’sche Reihe. München 1996) wie folgt: “Immer mehr Bücher finden immer weniger Leser. Die Weite der Weltliteratur und die Tiefe der Literaturgeschichte sind erschlossen wie nie, aber für wen?” (S.9.) Es sind hier vor allem Bücher der Literatur gemeint, auch wenn sie nicht unmittelbar dem Medium Film gegenübergestellt werden. Kino- oder Fernsehfilme gehören nach den anschließenden Ausführungen vielmehr zur Literatur im weiteren Sinne, insofern sie wie literarische Werke den Lebensgehalt des Menschen durch eine künstlerische Transformation den Mitmenschen vermitteln.
Bei der aufgeworfenen Frage geht es speziell um die Tradierung von Welt- und Nationenbildern. Aber Weimarer Klassik richtet ihr Augenmerk auf das Menschliche überhaupt und vermittelt in erster Linie eine Anschauung vom Menschen und in zweiter Linie eine Weltanschauung. Das deutsche Weltbild im 18. Jahrhundert, das vom Pietismus bis zum Idealismus wesentlich auf die gnostisch-, neuplatonisch-, kabbalistische Tradition zurückgeht, kann nur durch Literatur und Philosophie vermittelt werden. In diesem Fall wird also Literatur prinzipiell nicht vom Medium Film abgelöst. Wenn man die Geisteshaltung der Weimarer Klassik als typisch deutsch auffasst und daraus ein Bild der deutschen Nation bildet, kann man wohl noch von einem Nationenbild sprechen. Da dies viel realistischer ist als ein Weltbild, kann es effektvoll durch das Medium Film zur Darstellung gebracht werden. Zwischen Literatur und Film spielt das Theater in Deutschland traditionsgemäß eine vermittelnde Rolle.
Ein gutes Beispiel dafür ist Goethes Tragödie Faust. Über die Textlektüre hinaus habe ich bisher viele Theateraufführungen des Faust gesehen. Peymanns Stuttgarter epochale Inszenierung habe ich leider nicht erlebt. Aber Dieter Dorns Faust-Inszenierung habe ich sowohl auf der Bühne als auch im Fernsehen erlebt. Gründgens Hamburger Inszenierung habe ich freilich nur in der Fassung des Kinofilms und im Video gesehen. Murnaus Faust habe ich im alten Stummfilm und in der Neufassung des ZDF mit Begleitmusik gesehen. Ich persönlich werde hinsichtlich des Faust zwischen Text und Bild nicht antithetisch einander gegenüberstellen, sondern beidem sein Recht widerfahren lassen. Aber ich bin nicht sicher, welchem das deutsche Publikum von heute den Vorzug gibt, der Textlektüre oder der Theateraufführung. Vermutlich erzielt ein Peter Stein mit seiner textgetreuen und doch modernen Inszenierung den größten Erfolg. Aber Goethes Faust ist ausnahmsweise ein Glücksfall, was nicht ohne weiteres auf die Inszenierung von Iphigenie oder Tasso zutrifft. Literarische Verfilmungen von Werther oder Die Wahlverwandtschaften dürften beim deutschen Publikum viel weniger ankommen.
Immerhin erscheint mir die kulturelle Bedeutung der Filmproduktion in Deutschland vielgrößer als in Japan. Seit langem beklagen sich zwar manche über minderwertige Unterhaltungsfilme im Fernsehen, aber es gibt doch viele aufschlussreiche Dokumentarfilme sowohl kulturgeschichtlicher als auch zeitgeschichtlicher Themen, die alle verschiedene Nationenbilder in der ganzen Welt vermitteln. Wie Gerhard Kaiser im Anschluss an das obige Zitat sagt, scheint das „Literarische Quartett“ im Fernsehen ein Massenpublikum und einen hohen Unterhaltungswert zu haben. Im Bildungsprogramm des Bayerischen Rundfunks oder des 3sat wird ebenfalls literaturwissenschaftliche oder allgemein philosophische Gespräche mit bekannten Schriftstellern oder Kritikern oft gesendet, was zur weiteren Lektüre der besprochenen Werke anregen könnte. Gewohnheitsleser, die sich in ihr Zimmer zurückziehen und in der Stille sich der Lektüre hingeben, sind immer schon eine Minderheit gewesen. Ich werde also hier keine Alternative von Literatur und Film erblicken wollen.
Zum Schluss soll noch eine Grundsatzfrage erörtert werden: das Verhältnis unserer Gegenwart zur Vergangenheit, um einen Ausblick auf die Zukunft zu gewinnen, oder anders gesagt, Wertschätzung Goethes als des Kulturerbes. Soll man aus dessen Zinsen wie Rentner weiterleben oder es als ein Kapital anlegen, um es zu vermehren, oder sogar aus Goethe Kapital zu schlagen? Wer die sogenannten Klassiker, vor allem Goethe, für das Kriterium zur Beurteilung der Gegenwart heranzieht, steht also vor der Frage nach dem weiterwirkenden Kulturerbe wie Ortega y Gasset:
“Man sollte die Klassiker vor ein Tribunal von Schiffbrüchigen stellen und sie gewisse Urfragen des echten Lebens beantworten lassen. Wie würde Goethe vor diesem Gerichtshof bestehen? Es steht zu vermuten, dass er der Fragwürdigste aller Klassiker wäre, weil er ein Klassiker zweiter Ordnung ist, ein Klassiker, der seinerseits von den Klassikern gelebt hat, der Prototyp des geistigen Erben – von welchem Umstand er selbst sich so klare Rechenschaft gab -, kurz, ein Patrizier unter den Klassikern.” (Zitiert bei Heinz Kindermann: Das Goethebild des 20. Jahrhunderts. Zweite, verbesserte und ergänzte Ausgabe. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt 1966, S. 427.)
Hier wird Goethe von der Vergangenheit vor die Aufgaben der Gegenwart herausgefordert. Dagegen sieht Emil Staiger die Gegenwart vor die geistigen Ansprüche der Vergangenheit gestellt:
“Gleichwohl darf schon jetzt dieses Werk (der 1. Band seines ‘Goethe’) als wichtiges Dokument der neuen Goethe-Erkenntnis des Andersseins betrachtet werden, die nicht ausgeht, Elemente der eigenen Zeit in Goethe hineinzutragen, sondern die bei ihrem höchst verantwortungsbewußten Ausbreiten des ‘großen Erbes’ immer wieder die ehrfürchtige Frage vor Augen hat: ‘Wie bestehen wir heute vor ihm?’“ (Kindermann, a.a.O.,S.659.)
Diese scheinbar bescheidene Haltung Staigers, die die eigene Gegenwart aus der Goethezeit beurteilten will, ist allerdings von Hans Mayer einmal heftig kritisiert worden. Zum Goethe-Jahr 1932 erschien Walther Linden: Goethe und die deutsche Gegenwart, Deutsches Verlagshaus Bong & Co. Berlin 1932. Er argumentierte zum Schluss etwas anders: „Zwiespältig ist unsere Zeit; zwiespältig ist immer der deutsche Geist gewesen. Goethe ist deutsch, indem er den aus der deutschen Innerlichkeit fließenden Zwiespalt des Inneren und Äußeren, des Ichs und der Welt, im Tiefsten und mit kämpferischer Mühe nacherlebt; er ist überdeutsch, d.h. nicht international oder kosmopolitisch, sondern reinste Blüte deutschen Wesens, indem er den Zwiespalt im Ringen überwindet.“ (S. 70.)
Im Goethejahr 1999, am 250. Geburtstag Goethes, wurde dagegen bewusst Goethes Weltbürgertum in den Vordergrund gestellt: Humanitätsideal – Menschlichkeit – Überwindung des Chaos durch den Kosmos, eben Kern der bürgerlichen Humanität. Friedrich Ebert wollte seinerzeit Goethe oder den Geist von Weimar zum Prinzip der Weimarer Republik machen. Die Frage nach dem Scheitern der Weimarer Republik wird schließlich gestellt.
(Rohmanuskript am 27.1.2004)