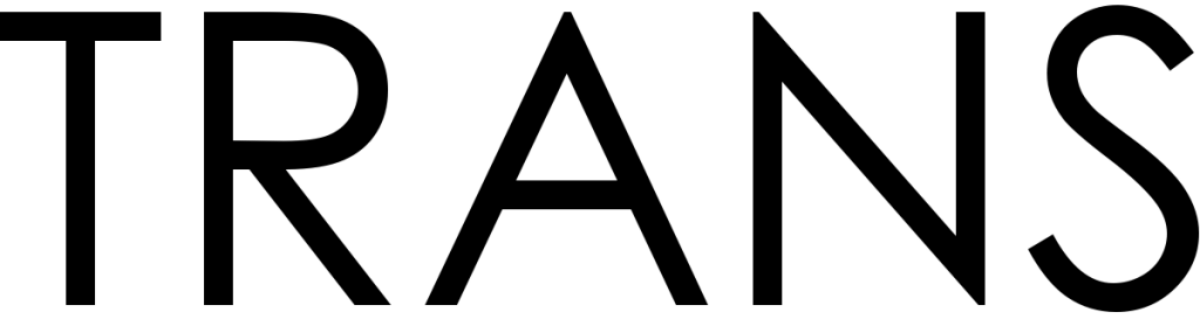Naoji Kimura (Tokio)
- Bildung im japanischen Verständnis
Im Rahmen des japanisch-deutschen Kolloquiums zur „Bedeutung der Geisteswissenschaften“, das am 30. März 1996 in Kyoto von der Alexander von Humboldt-Stiftung veranstaltet wurde, soll im Folgenden ein japanischer Aspekt des nach wie vor so aktuellen Problems von Bildung betrachtet werden. Die Frage nach Goethes Bedeutung für die japanische Bildungstradition impliziert grundsätzlich dreierlei: den japanischen Begriff der Bildung, die Vermittlungsweise dieser Bildung in Japan und Goethes Wirkung darauf im geschichtlichen Verlauf. Im Deutschen ist der Unterschied zwischen Erziehung und Bildung manchmal nicht ganz eindeutig, wenn man von Schulbildung oder Bildungsanstalt spricht. Dagegen unterscheidet man im japanischen Wortgebrauch deutlich zwischen Erziehung und Bildung. Erziehung (kyoiku) meint die schulische Ausbildung einschließlich des Hochschulstudiengangs, während Bildung (kyoyo) etwas Schöngeistiges, Künstlerisches, ja Kulturelles überhaupt bedeutet, also etwas, was man über die schulische Erziehung oder berufliche Ausbildung hinaus sich geistig an- und zueignet.1
Ein Naturwissenschaftler gilt als gebildet, wenn er musizieren oder malen kann. Ein Sozialwissenschaftler ist gebildet, wenn er literarische Essays schreiben kann. Aber wie steht es mit den Geisteswissenschaftlern, die sich anscheinend mit der Bildung als solcher beschäftigen? Sind sie per se gebildet, oder müssen sie etwas anderes erstreben als ihre Fachwissenschaft, um gebildet zu sein? Wer sich allerdings mit Goethe beschäftigt, hat insofern seine Vorteile, als Goethe nicht nur Dichter, sondern auch Naturforscher, Kunsthistoriker, Literaturkritiker, Philosoph, nicht zuletzt Politiker gewesen ist. Darf er sich doch erlauben, von der Germanistik aus Grenzüberschreitungen zu verschiedenen Disziplinen zu unternehmen, sodass er eventuell als allseitig gebildet angesehen werden könnte, wenn er nicht gerade einem seichten Dilettantismus anheimgefallen ist. Aber ein Goetheforscher, der sein Leben lang nur Goethe studiert und darüber hinaus nichts weiß, kann wiederum als Fachidiot übergebildet oder sogar verbildet sein.2
Was die Vermittlung der Bildung in Japan anbelangt, so erfolgt sie speziell hinsichtlich der Weltliteratur als des wichtigsten Bildungsmittels entweder durch die Übersetzer oder Lehrer. Bei jenen besteht ihr Lesepublikum aus unbestimmten Gebildetenkreisen, die sich in manchen Fällen schwer erfassen lassen. Bei diesen ist ihr Verhältnis zu den Schülern von entscheidender Wichtigkeit und im Großen und Ganzen erfassbar. Abgesehen von der bedeutsamen Rolle der Übersetzer, kommt also vor allem dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis in der Goetheforschung für die japanische Bildungstradition in Betracht.
Den geschichtlichen Verlauf der Bildungstradition, die sich seit dem Anfang der Meiji-Zeit unter der immer stärkeren Wirkung Goethes heranbildete, könnte man dabei dezennienweise gliedern, und zwar in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts die ersten Kenntnisse über die deutsche Literatur erblicken, dann in den achtziger Jahren die Studienaufenthalte der ersten Goethekenner in Amerika oder Europa, in den neunziger Jahren die begeisterte Aufnahme des Werther, im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts die allmähliche Lektüre des Faust und schließlich die Etablierung der japanischen Germanistik in den zwanziger Jahren im Anschluss an die Übersetzung von Wilhelm Meisters Lehrjahren.3 Merkwürdigerweise kam die Blütezeit der Goetheforschung in Japan erst in den dreißiger Jahren herauf.4 Diese dezennienweisen Einzelphasen kann man aber auch vor und nach dem epochemachenden Übersetzer Mori Ogai gliedern und folgendermaßen charakterisieren. Nach der eigentlichen Einführung der deutschen Literatur durch ihn hat sich die literarische Jugend in Japan zuerst für den Werther und dann für den Faust begeistert, bis die Germanisten als Fachphilologen des deutschen Bildungsromans an den Universitäten hervortraten.5
Zur Veranschaulichung dieses Prozesses sollen zunächst die drei Bilder im Anhang dienen. Im Jahre 1832 veröffentlichte der schottische Goetheverehrer Thomas Carlyle in „Frazers Magazine“ einen kleinen Aufsatz „Goethes Porträt“ und setzte wie folgt ein: „Leser! Hier siehst du das Bildnis Johann Wolfgang Goethes. So lebt und leibt jetzt in seinem 83. Jahre, weit entfernt, in dem heiteren freundlichen kleinen Kreise zu Weimar der ‚klarste, universellste Mann seiner Zeit‘.“6 Es handelte sich bei diesem Bildnis um die Zeichnung von Daniel Maclise, die auf eine Skizze Thackerrays nach dem Leben unter Benutzung des Stieler-Kopfes zurückgeht. Des Bayerischen Hofmalers Joseph Karl Stieler Aquarell mit farbiger Kreide, besonders sein Ölgemälde von 1828 im Besitz der Neuen Pinakothek zu München ist weltbekannt. Die Zeichnung von Maclise, deren Wiedergabe in der Zeitschrift gänzlich misslungen sein und einer unfreiwilligen Karikatur geglichen haben soll, dürfte Ihnen weniger bekannt sein. Aber noch weniger bekannt ist Ihnen sicherlich eine Goethe-Zeichnung in Kimono und Geta, die Tadashi Kogawa, Gründer des Goethe-Gedächtnismuseums in Tokyo, zum Goethe-Jahr 1982 entworfen hat. Nebenbei bemerkt, hat diese Zeichnung Manfred Osten in seinem Artikel „War Goethe ein Japaner?“ in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 21. Oktober 1987 veröffentlicht.
Was an diesen drei Bildnissen symbolisch zutage tritt, ist ein verschlungener Wandlungsprozess der Goethe-Rezeption von Deutschland über England und Amerika nach Japan, auf den hier nicht eingegangen werden kann, zumal er gleichzeitig die Wissenschaftsgeschichte der Germanistik selbst darstellt. Soll dieser rezeptionsgeschichtliche Vorgang trotzdem in groben Zügen angedeutet werden, so läßt sich sagen, dass zuerst der deutsche Idealismus einschließlich der Dichtung von Goethe und Schiller auf Thomas Carlyle mit dessen Heldenverehrung stark gewirkt hat und sodann aus ihm einerseits eine Rückwirkung auf den deutschen Kunsthistoriker Hermann Grimm und andererseits eine Weiterwirkung auf den amerikanischen Denker Ralph Waldo Emerson hervorgegangen ist.7
- Bildungsidee im Zuge der Goethe-Rezeption
Bekanntlich ist Hermann Grimms Goethebild, wie es in seinen Berliner Goethe-Vorlesungen von 1874/75 großartig ausgeführt ist, richtungsweisend für die weiteren Goethe-Auffassungen in Deutschland geworden. Das bedeutet, dass auch die Goethe-Rezeption in Japan indirekt mehr oder weniger unter seinem Einfluss gestanden hat, soweit sie seit Mori Ogai unmittelbar auf dem Weg der deutschen Germanistik erfolgt ist. Vor Mori Ogai, der in den Jahren 1884-88 in Deutschland als Hauptfach Medizin studierte, hatten die japanischen Literaturkritiker ihre Kenntnisse über Goethe vor allem aus den damals bekannten zwei Werken entnommen: August Friedrich Vilmar, Geschichte der Deutschen National-Litteratur (Marburg / Leipzig 1845) sowie Robert Koenig, Deutsche Literaturgeschichte 2 Bde. (Bielefeld/Leipzig 1879). Vilmars Literaturgeschichte war allerdings in erster Linie „der durchgeführte Gedanke von der Größe und Herrlichkeit der mittelalterlichen epischen Volksdichtung, mit ihrer Ehre und Treue bis in den Tod […] es ist ferner die aufrichtige schöne Gerechtigkeit, mit der die Dichter der neueren Zeit nach ihrem nationalen Gehalte gewürdigt wurden.“8 Und Robert Koenig hatte vor, „ein anschauliches, wenn auch nicht erschöpfendes Bild des Entwickelungsganges unserer deutschen Dichtung im Rahmen unserer ganzen Kultur darzubieten“.9
Mori Ogai war freilich noch kein Germanist im eigentlichen Sinne. Mehr literaturkritisch als philologisch eingestellt, hatte er viele zeitgenössische Werke aus der deutschen Literatur ins Japanische übersetzt, bevor er 1913 dem japanischen Lesepublikum die erste Gesamtübersetzung von Goethes Faust zusammen mit den gesondert erschienenen Auszügen von Albert Bielschowskys Goethe-Biographie und Kuno Fischers Faust-Studien vorlegte. Obwohl die ersten japanischen Übersetzungen sowohl von dem Werther-Roman als auch von dem ersten Teil des Faust bereits 1904 erschienen waren, erwiesen sie sich sprachlich als steif und kaum genießbar. So waren denn auch die jungen Dichter und Schriftsteller der Meiji-Zeit weitgehend auf die englischen Übersetzungen angewiesen, wie z.B. The Sorrows of Werter (1892) in Cassell’s National Library, Faust. A Tragedy (1871) in der Übersetzung von Bayard Taylor oder Wilhelm Meister’s Apprenticeship (1824) in der Übersetzung von Thomas Carlyle. Carlyles englische Übersetzung von Wilhelm Meisters Wanderjahren (1827) scheint in Japan keine nennenswerte Beachtung gefunden zu haben, weil sie auf der ersten Fassung des noch nicht vollendeten Werkes beruhte. Als Vorgeschichte der japanischen Goethe-Rezeption gilt es jedoch diese literarhistorischen Zusammenhänge auf dem Weg über England und Amerika eingehender zu untersuchen. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die literarisch interessierte japanische Jugend frühzeitig nicht nur vom Werther als dem befreienden romantischen Liebesroman, sondern auch vom Wilhelm Meister als dem deutschen Bildungsroman sehr angetan war.
Die Germanistik als akademische Disziplin in Japan nahm ihren Anfang, als im Jahre 1893 der Lehrstuhl dafür an der Kaiserlichen Universität zu Tokyo eingerichtet wurde. Da aber die Lehrkräfte dort jahrelang vorwiegend durch deutsche Professoren wie Karl Florenz, Joseph Dahlmann SJ u.a.m. vertreten waren, würde man die institutionell etablierte japanische Germanistik erst mit Teisuke Fujishiro ansetzen, der im Jahre 1907 als der erste japanische Lehrstuhlinhaber der Germanistik an die zehn Jahre zuvor gegründete Kaiserliche Universität zu Kyoto berufen wurde. Hier eröffnete er mit seinen Kollegen und Schülern eine Übersetzungsreihe mit den Klassikern der deutschen Literatur und trug sich mit dem Gedanken, den ganzen Faust selbst ins Japanische zu übertragen, bis der frühe Tod ihn daran hinderte. In der Reihe fand übrigens die erste japanische Übersetzung von Wilhelm Meisters Lehrjahren Aufnahme, die 1920 erschienen war, deren Druckvorlage aber durch das große Erdbeben im Kanto-Gebiet vernichtet wurde. Goethes Bildungsroman, auf japanisch zunächst „kyoyoteki shosetsu“ oder „shuyo shosetsu“ genannt, wurde auf diese Weise relativ spät dem japanischen Lesepublikum zugänglich gemacht, während Mori Ogais Faust-Übersetzung durch die Aufnahme in die Iwanami-Taschenbuchreihe im Jahre 1928 unter den japanischen Gebildeten immer populärer geworden ist.
Die führende Rolle Kyotos in der damaligen Germanistik zeigt sich unverkennbar darin, daß die Goethe-Gesellschaft in Japan im Jahre 1931, also ein Jahr vor der Säkularfeier Goethes, nicht in Tokyo, sondern in Kyoto gegründet wurde, wenngleich Shokichi Aoki, Professor an der Kaiserlichen Universität zu Tokyo, zum ersten Präsidenten gewählt worden war. Vizepräsident wurde natürlich Kiyoshi Naruse, Professor an der Kaiserlichen Universität zu Kyoto, der das japanische Übersetzungswort für „Sturm und Drang“ ein für allemal geprägt hat, und der junge Dozent Toshio Yukiyama in Kyoto, der später als erster das Nibelungenlied aus dem Mittelhochdeutschen ins Japanische übersetzen sollte, zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt. Kiyoshi Naruse löste nach einigen Jahren den erkrankten Präsidenten Shokichi Aoki ab und wechselte nach dem Krieg zur Keio-Universität in Tokyo über. Es kommt daher, dass die Goethe-Gesellschaft in Japan im Jahre 1958 nicht in Kyoto, sondern in Tokyo durch Professor Morio Sagara wiederaufgebaut worden ist.
Schon der 1. Band des Japanischen Goethe-Jahrbuchs zur Hundertjahrfeier 1932 stellt in Umfang und Vielfalt der Thematik einen Gipfel der bisherigen Goetheforschung in Japan dar. Versucht er doch mit dem ehrwürdigen Ölgemälde Stielers als Titelbild, „Goethes geistiges Bild im großen und ganzen“ zu demonstrieren, wie es im Nachwort des Redaktionskomitees heißt, und der Schriftleiter bewundert angesichts der Vielzahl der beigesteuerten Aufsätze den inspirierenden Genius Goethe, der „das Weltall übersteigt und es doch umfaßt“. In der Tat kommt darin das Weltbürgertum Goethes hervor, das die japanischen Gebildeten seit ihrer geistigen Begegnung mit diesem deutschen Dichter anzog. Es schreiben nämlich renommierte Autoren verschiedenster Provenienz – außer den Germanisten von Philosophen bis zu Naturwissenschaftlern – über die Themen, die sämtlich das facettenreiche Wesen des Universalisten zu beleuchten suchen.
Zur Sprache gelangen da der Reihe nach Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre, Goethe als Naturwissenschaftler, sein Verhältnis zur platonischen Liebe, Botanik, Erziehung sowie Musik, Erläuterungen über seine Lyrik und sein Konzept der Weltliteratur. Ihnen folgt der durch die deutsche Übersetzung Robert Schinzingers berühmt gewordene Aufsatz von Kitaro Nishida „Der (metaphysische) Hintergrund Goethes“.10 Es befinden sich sodann Aufsätze über den West-östlichen Divan, die Freundschaft zwischen Goethe und Schiller, die zwei Seelen im Faust, Goethes Verhältnis zu Asien, Religionen, Märchen sowie Kunstgeschichte. Zum Abschluss werden noch Probleme der Goethe-Biographie, Goethes Iphigenie, sowie Goethes Beschäftigung mit Kant aufgegriffen. Außerdem sind auch deutsche Professoren bzw. Lektoren wie Erwin Jahn, Erwin Meyenburg, Anna Miura, Johannes Müller SJ jeweils mit Beiträgen über Heines Goetheporträt, Goethes Novelle Der Mann von funfzig Jahren, die Hauptdramen Goethes und die Goethische Prosaepik vertreten, sodass jeder Goethefreund sich für sein Spezialinteresse persönlich angesprochen fühlen konnte.
Wenn man das alles als Aspekte der Selbstbildung bei Goethe auffasst, so stößt man ohne weiteres auf eine Bildungsidee, die sich zugleich als Ideal für die akademische Jugend in Japan auswirken musste. Wie daraus deutlich hervorgeht, dass ein Aufsatz über Wilhelm Meisters Lehrjahre vorangestellt wurde, war Goethe im Laufe der Taisho-Zeit vom weltschmerzlichen Dichter des Werther zum Repräsentanten des bürgerlichen Zeitalters avanciert und hat die japanische Bildungstradition wesentlich mitgestaltet. Denn der Bildungsweg von Wilhelm, den man im Allgemeinen mit Faust als Goethes Doppelgänger betrachtet, ist dadurch gekennzeichnet, dass er in der Jugend Zeit genug hatte, sich in Liebe und Liebhaberei zu verirren, um dann schließlich vom bürgerlichen Kaufmannssohn zu einem Geistesadel im Wohlstand erhoben zu werden. Das entsprach ohne Zweifel der Lebens- und Denkweise vieler Oberschüler der alten Kotogakko, die bekanntlich nach dem deutschen Gymnasium ausgerichtet war, und vieler Studenten an den Universitäten der Vorkriegszeit, die als geistige Elite eine gute Aussicht und Chancen genug hatten, überall in der Gesellschaft eine Karriere zu machen. Dass man der deutschen Sprache mächtig ist, war überhaupt die Voraussetzung aller Bildung, galt ja manchmal sogar als Bildung schlechthin. Leider ist es heute nicht mehr der Fall.
- Anglo-amerikanisches Ideal von Humanities
Aber dass die Bildung als solche in Japan noch immer hochgeachtet wird, geht meiner Meinung nach ebenfalls auf die anglo-amerikanische Bildungstradition zurück, in der Meiji-Zeit insbesondere auf den Einfluss eines Carlyle, Emerson oder Matthew Arnold, die alle Goethe zugetan waren, und in der Nachkriegszeit auf das allgemeinbildende Curriculum, das nach dem ursprünglich mittelalterlich-europäischen, heute aber faktisch amerikanischen Modell von liberal arts bzw. Humanities landesweit in die japanischen Universitäten eingeführt worden ist. Da diese Stufe der Bildung traditionsgemäß in Deutschland bereits im humanistischen Gymnasium absolviert wird, hat die deutsche Universität mit ihren hohen Ansprüchen auf Forschung und Lehre nach dem Krieg nicht so sehr als Modell für das japanische Bildungswesen dienen können.
Hier liegt im übrigen ein kulturpolitisches Problem für die Bundesrepublik Deutschland, wenn deutsche Hochschulen für Ausländer, also auch für die japanischen Studenten in der Undergraduate school, attraktiver gemacht werden wollen, wie Bundesaußenminister Klaus Kinkel neulich in einer Weimarer Rede hervorgehoben hat.11 Die größte Schwierigkeit für die Anpassung an das deutsche Hochschulwesen besteht m.E. darin, dass man in Deutschland normalerweise mit neunzehn Jahren Abitur macht und grundsätzlich nur die staatlichen Universitäten zu besuchen hat, deren Studium nicht nach dem amerikanischen Einheiten-System, sondern mit einem erfolgreichen Staatsexamen oder durch den Erwerb eines Magister- bzw. Doktorgrades abgeschlossen werden kann. Das Staatsexamen kommt jedoch für ausländische Studenten gar nicht in Frage. Außerdem ist das Hochschulstudium in Deutschland gebührenfrei, sodass ein Studentenaustausch mit den japanischen Universitäten mit hohen Studiengebühren finanztechnisch sehr schwierig ist.
Es ist nun in Kunst und Wissenschaft der Lehrer, der das Wissen tradiert. So verhält es sich auch in der Bildungstradition. Die meisten Hochschullehrer in Japan sind bis vor kurzem entweder selbst in der Bildungstradition der alten Kotogakko geistig aufgewachsen oder noch von traditionsgebundenen Lehrern ausgebildet worden. In dieser wissenschaftlichen Atmosphäre war Goethe mit seiner ästhetisch-ethischen Einstellung und seiner politisch konservativen Haltung mit dem althergebrachten Konfuzianismus gut vereinbar. Worte aus Konfutses Lun Yü waren den japanischen Oberschülern und Studenten noch ebenso geläufig wie seinerzeit Bibelzitate oder Eckermanns Gespräche mit Goethe den deutschen Gebildeten. Wer von Ihnen kennt nicht den Spruch von Konfutse „Lernen und fortwährend üben: Ist das denn nicht befriedigend? Freunde haben, die aus fernen Gegenden kommen: Ist das nicht auch fröhlich?“ oder einen anderen wie „Lernen und nicht denken ist nichtig. Denken und nicht lernen ist ermüdend.“?12 Es ist, wie wenn man in Goethes Maximen und Reflexionen läse oder an Kant erinnert würde, der gesagt hat: „Erfahrung ohne Begriffe ist blind, Begriffe ohne Erfahrung sind leer.“
Konfutse hatte zwar in Laotse, dem Begründer des Taoismus, seinen Gegner, und Goethe hatte in Ludwig Börne, Heinrich Heine oder Wolfgang Menzel seine Kritiker, und es war gut so. Fochte doch Goethe selbst mit Schiller in den Xenien eine literarische Fehde aus. Wer sich aber nach Herman Grimm mit Goethe beschäftigt, ist ständig mit der Gefahr konfrontiert, einem prekären Goethekult zu verfallen und somit zur Kritiklosigkeit gegen Goethe verurteilt zu werden. Einer solchen Gefahr vorzubeugen wäre eigentlich die pädagogische Aufgabe eines einsichtigen Lehrers gegenüber seinen Schülern. Schlimm ist nur, wenn der Lehrer selbst dem Goethekult verfällt und angeblich daran als einer geheiligten Bildungstradition festhalten will. In den dreißiger Jahren wirkte sich besonders die nationalistisch übersteigerte Faust-Ideologie auch in Japan verhängnisvoll aus, da man den Universalisten Goethe mehr oder weniger bewusst auf den deutschen Faust-Mythos hin interpretierte.
Symptomatisch erscheint daher im Nachhinein, dass im 1. Band des Japanischen Goethe-Jahrbuchs ein Blatt aus Goethes biographischem Schema zu Dichtung und Wahrheit in getreuer Nachbildung seiner Handschrift wiedergegeben war. Durch Umstellung der Zeilen auf Grund eines Hakens lautet der Text wie folgt: „Ausbreitung der französischen / Sprache u. Cultur / Ursachen früher / in der Dipl. An der Stelle der lateinischen / allgemeine Communicale / Aufhebung der deutschen / Dialekte / Zusammendrängen der deutschen / Expansion der letzteren.“ Die letzten zwei Zeilen, die sich ursprünglich auf die ersten zwei Zeilen bezogen, lassen sich so lesen: Zusammendrängen der deutschen Sprache u. Cultur / Expansion der letzteren, d.h. deutschen Sprache u. Cultur. Der Text deutet auf eine literaturgeschichtliche Konstellation in der Sturm- und Drang-Periode, und man kann nichts dagegen sagen, dass Herder gegen Gottscheds rationalistische Literaturtheorie auftrat und Shakespeare gegen die französische Literatur ausspielte.13 Durch Herders Anregungen begeistert, hat auch der junge Goethe das Straßburger Münster im gotischen Baustil anachronistisch als deutsche Baukunst gepriesen, wiewohl es an sich nur Ausdruck seiner neuen Kunstanschauung war.
Aber bald nach der Gründung der Goethe-Gesellschaft in Japan sollte Goethes Weltbürgertum zu einem nationalistisch gefärbten Goethekult verengt werden, indem nun Faust für das Menschenbild Goethes in der Showa-Zeit bestimmend geworden und Wilhelm Meister, insbesondere Wanderjahre mit der Pädagogischen Provinz, für Goethes Gesellschafts- und Religionslehre in Anspruch genommen worden ist. Derjenige Hochschullehrer, der dazu in entscheidender Weise Vorschub geleistet hat, war Kinji Kimura, der Nachfolger von Shokichi Aoki auf dem Lehrstuhl der Germanistik an der Kaiserlichen Universität zu Tokyo. Da der Goetheforscher einen tüchtigen Schülerkreis gehabt und als der bedeutendste Multiplikator wieder eine Anzahl neue Goetheforscher ausgebildet hat, war sein geistiger Einfluss von großer Tragweite, dessen Auswirkungen heute noch zu spüren sind.
- Die deutsche humanistische Tradition
Es wäre absurd zu sagen, durch die völkische Literaturwissenschaft eines Walther Linden sei auch die japanische Germanistik gleichgeschaltet worden. Wie in Deutschland gab es unter den japanischen Goetheforschern, die im Laufe der dreißiger Jahre eine führende Rolle in der Germanistik spielten, opportunistische Mitläufer, Lehrstuhlinhaber, die nachträglich in die nationalsozialistische Kulturpolitik verwickelt wurden, und Hochschullehrer, die in eine innere Emigration gingen. Am Scheidepunkt stand in dieser Hinsicht das 1932 vom Japanisch-Deutschen Kultur-Institut Tokyo herausgegebene Heft „Japanisch-deutscher Geistesaustausch“ Nr. 4 mit dem Titel Goethe-Studien. Das Heft enthielt vier deutsche Beiträge: Thomas Mann, An die japanische Jugend, Fritz Strich, Goethe und unsere Zeit, Erwin Jahn, Goethe und Asien, Walter Donat, Goethes Vermächtnis in der Gegenwart.
Wie im Vorwort bemerkt, war es das erste Mal, dass ein deutscher Schriftsteller von dem Rufe eines Thomas Mann sich unmittelbar an die Leserwelt Japans wandte, und die Gesprächsstelle mit Eckermann, an die er sofort anknüpfen wollte, war Goethes bekannte Aussage über die Weltliteratur als Gemeingut der Menschheit: „An diese Worte des majestätischen, aus kernigstem Deutschtum in überschauende Größe emporgewachsenen Greises muss ich denken, da mir der ehrenvolle und rührende Auftrag zuteil wird, der ostasiatischen Festpublikation zu hundertstem Tage, diesem seinem Leben und Werk gewidmeten Sammelwerk hervorragender japanischer Gelehrter ein deutsches Vorwort zu schreiben, es mit einem Gruß aus dem Geburtslande des Gefeierten zu versehen. Weltliteratur!“14 Schon damals warnte Thomas Mann vor den „Provinzlern des Geistes“, die die naheliegende Gefahr der Verwechselung des Weltfähig-Weltgültigen mit dem nur Weltläufigen, einem minderen internationalen Gebrauchsgut, mit Vorliebe zur nationalen Diskreditierung allgemein anerkannter Leistungen ausnützen: „Geflissentlich nennen sie den echten und den wohlfeilen Weltruhm in einem Atem und meinen so das Mehr-als-Nationale zugleich mit dem Unter- und Zwischennationalen zu verunglimpfen.“15
Nach Thomas Mann war Goethes Kosmopolitismus „klassische Vorform dessen, was durch einen späteren Weltdeutschen, Nietzsche, den Namen des ‚guten Europäertums‘ erhalten hat.“ Wie vorhin erwähnt, legt Goethes vorwegnehmendes gutes Europäertum in seinem Verhältnis zu Carlyle und Emerson ein beredtes Zeugnis ab und erweitert sich zu einem weltumfassenden Kosmopolitismus, indem es durch ihre Vermittlung zunächst in Japan rezipiert und dann vorerst über Japan nach Korea und China getragen worden ist. Thomas Carlyles Hauptwerke, somit auch seine Briefe an Goethe und Goethe-Essays sind schon lange ins Japanische übersetzt und haben noch vor Mori Ogai den japanischen Gebildeten ein nicht auf Faust, sondern auf Wilhelm Meister beruhendes Goethebild vermittelt. Da die beiden protestantischen Denker der Meiji-Zeit, Kanzo Uchimura und Inazo Nitobe, geistig bei ihm in die Schule gingen, wurde es durch ihre erzieherische Tätigkeit in ganz Japan verbreitet und übte über den engeren Germanistenkreis hinaus einen nachhaltigen Einfluss aus. Dagegen erwies sich Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften aus verständlichen Gründen als wenig einflussreich.
Neben Carlyle war es der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson, der eine ähnliche Rolle bei der Goethe-Rezeption in Japan gespielt hat. In seinem populärsten Buch Vertreter der Menschheit widmet er sein letztes Kapitel Goethe dem Schriftsteller, das wiederum ein etwas anderes Goethebild vermittelt hat als das später durch die deutschen Goetheforscher beschworene mythische Goethebild. Ohne etwa den Genie-Gedanken geistesgeschichtlich auszumalen, schreibt Emerson z.B. schlicht essayistisch: „Goethe kam in eine überzivilisierte Zeit und in ein überzivilisiertes Land, wo ursprüngliches Talent unter der Bürde von Büchern und mechanischen Hilfsmitteln und unter der verwirrenden Mannigfaltigkeit von Bestrebungen zu Boden gedrückt wurde. Da war er es, der die Menschen lehrte mit diesem bergehohen Mischmasch fertig zu werden und ihn sich sogar dienstbar zu machen.“16 Angesichts der inzwischen uferlos gewordenen Goethe-Fachliteratur ist ein solcher Schreibstil wohl zu beherzigen, um den Dichter den heutigen Menschen in Ost und West wieder näher zu bringen.
Ansonsten möchte ich noch auf eine merkwürdige Tatsache aufmerksam machen. Es scheint mir, dass Goethe in den dreißiger Jahren als Bollwerk gegen das Eindringen des Marxismus unter den japanischen Studenten missbraucht worden ist. Wie Sie alle wissen, kam das „Abkommen über die kulturelle Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reich und Japan“ im November 1938 zustande. Voraus ging der Abschluss des Antikominternpakts im Jahre 1936, der eindeutig politische Konsequenzen aus den schon in den zwanziger Jahren erfolgten Auseinandersetzungen mit den japanischen Marxisten bedeutete.17 Obwohl der Marxismus wie in der ehemaligen DDR nicht unbedingt mit Goethes Gedankengut unvereinbar ist, kam in jenen Jahren eine mehr oder scharfe Goethe-Kritik fast immer aus dem sozialistischen Lager, während Goethe in den konservativ-humanistischen Kreisen immer mehr zum Dichterfürsten emporstilisiert und als Dichter des Faust gefeiert wurde. Als die kommunistische Bewegung 1928 / 29 in zwei Verhaftungswellen zerschlagen wurde, hat es daher für sozialistische Intellektuelle anscheinend nur die Alternative gegeben zwischen Karl Marx oder Goethe. Ein Beispiel dafür ist Katsuichiro Kamei. Nach seinem politischen Gesinnungswechsel hat der bekannte Schriftsteller sich einer intensiven Beschäftigung mit Goethe zugewandt und seinen inneren Konflikt in dem Buch Menschenbildung, faktisch einem Sammelband seiner Goethe-Aufsätze, anschaulich geschildert.
Auf der anderen Seite erinnert sich der große Goetheforscher Kinji Kimura im Vorwort seiner im Dezember 1938 erschienenen umfangreichen Aufsatz-Sammlung Goethe mit Genugtuung daran, wie er damals zu einer neuen Goethe-Auffassung kam: „Der Grund, warum mein Augenmerk in den Jahren der Säkularfeier vor allem auf die beiden Werke Faust und – vorwiegend – Wilhelm Meisters Wanderjahre gerichtet wurde, geht auf die Zeitumstände zurück. Gegen Ende der Taisho-Zeit und Anfang der Showa-Zeit war die materialistische Tendenz stark bemerkbar, und es schien, als ob in erster Linie der Marxismus das leitende Prinzip für die japanische Jugend darstellte. Wer diesem Gedanken nicht huldigen wollte, wurde als unzeitgemäß verachtet, und man dachte in weiten Kreisen, es gäbe keine anderen Gedanken, die einem eine geistige Nahrung gewähren würden, oder denen man sich hingeben könnte. In einer solchen Zeit war ich von meinem Standpunkt aus überzeugt, daß gerade Goethes Gedanken, die die religiöse Ehrfurcht zur Grundlage der Gesellschaft machen, die mächtigsten Gegenmittel gegen den Egoismus mit dessen Betonung materialistischer Ansprüche sein könnten.“
Die Goetheforschung war also bei Kinji Kimura nicht nur eine wissenschaftliche Angelegenheit, sondern auch als Protest gegen den Zeitgeist gedacht. Wörtlich schrieb er hinzu, er hätte es als eine „Pflichterfüllung“ eines mit der Jugenderziehung Beauftragten betrachtet. Wenn jemand als Hochschullehrer mit gutem Gewissen seine pädagogische Pflicht erfüllen will, muß man es subjektiv respektieren. Aber objektiv kann er irren und damit seine gut gemeinte Absicht verfehlen, auch wenn er ein noch so großer Gelehrter ist wie Kinji Kimura. Hier fällt mir allerdings ein Bibelwort ein: „Mit dem Maße, mit dem ihr meßt, wird euch auch gemessen werden.“ (Mt. 7,2) Wenn man selber Goetheforscher ist und die akademische Jugend von heute zu erziehen hat, trägt man offensichtlich die Verantwortung dafür, an der japanischen Bildungstradition nach Kräften und kreativ mitzuwirken, damit sie sich in die rasch wandelnde Zukunft hin fruchtbar entwickelt. In dem Gedicht „Eins und Alles“ hatte doch Goethe gesagt:
„Denn alles muß in Nichts zerfallen,
Wenn es im Sein beharren will.“18
Und in dem Gedicht „Vermächtnis“ heißt es weiter: „Was fruchtbar ist, allein ist wahr.“19 Aus dem Kontext losgelöst, wurde der Vers gewiss in den dreißiger Jahren viel missbraucht. Aber die Voraussetzung dafür war, dass der Verstand einen wach erhält und die Vernunft überall zugegen ist, bevor man den Sinnen traut. Dann erweist sich allein was wahr ist, als wirklich fruchtbar. Was dabei unter den japanischen Gebildeten als wahr gilt, bezieht sich nicht so sehr auf die Religion wie im christlichen Abendland, sondern vielmehr auf Kunst und Wissenschaft. Vom alten Goethe stammt ein Gedicht, das genau ihre Mentalität ausspricht:
„Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,
Hat auch Religion;
Wer jene beiden nicht besitzt,
Der habe Religion.“20
Goethes Bedeutung für die japanische Bildungstradition wird in diesem Sinne noch lange lebendig bleiben, solange das Ideal der ganzheitlichen Menschenbildung in Wissenschaft und Kunst an den japanischen Hochschulen aufrechterhalten wird.
Anmerkungen
* Eine unveränderte Fassung meines Beitrags zu: Sprache, Literatur und Kommunikation im kulturellen Wandel. Festschrift für Eijiro Iwasaki anläßlich seines 75. Geburtstags, hrsg. von Tozo Hayakawa, Takashi Sengoku, Naoji Kimura und Kozo Hirao. Dogakusha Verlag. Tokyo 1997.
1 Das japanische Wort „kyoyo“ deckt sich nur teilweise mit dem umfangreichen Bedeutungsgehalt der Bildung bei Goethe. Somit läßt sich auch der japanische Begriff von „kyoyoshugi“ nicht mit „Bildungstradition“ angemessen wiedergeben.
2 Damit hängt die ganze Problematik des Bildungsphilisters bzw. des Bildungsbürgertums zusammen, die aber hier nicht weiter erörtert werden kann. Vgl. Aleida Assmann: Arbeit am nationalen Gedächtnis. Eine kurze Geschichte der deutschen Bildungsidee. Frankfurt/Main 1993.
3 Vgl. Yoshio Koshina (Hrsg.): Deutsche Sprache und Literatur in Japan. Ein geschichtlicher Rückblick. Ausstellungskatalog zum IVG-Kongreß in Tokyo. Tokyo 1990.
4 Näheres vgl. Naoji Kimura: Rezeption ‚heroischer‘ deutscher Literatur in Japan 1933-45. In: Formierung und Fall der Achse Berlin-Tokyo. Monographien aus dem Deutschen Institut für Japanstudien der Philipp-Franz-von-Siebold-Stiftung. Bd. 8, hrsg. von Gerhard Krebs und Bernd Martin. München 1994, S. 129-151.
5 Näheres vgl. Naoji Kimura: Die japanische Germanistik im Überblick. In: Jahrbuch für internationale Germanistik. Jg. XX/Heft 1. Bern 1989, S. 138-154.
6 Goethes Briefwechsel mit Thomas Carlyle. Hrsg. von Georg Hecht, Dachau 1913, S. 133. Vgl. ferner Thomas Carlyle: Goethe. Carlyle’s Goetheporträt nachgezeichnet von Samuel Saenger. Berlin 1907.
7 Vgl. Naoji Kimura: Carlyle als Vermittler Goethes in Japan. In: Symposium „Goethe und die Weltkultur“, Veröffentlichungen des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin, Bd. 15. Berlin 1993, S. 72-82.
8 A.F.C. Vilmar: Geschichte der Deutschen National-Litteratur, 23. Vermehrte Auflage. Marburg und Leipzig 1890. Vorwort zur einundzwanzigsten Auflage von Karl Goedeke, S. VII.
9 Rob. Koenig: Deutsche Literaturgeschichte. 10., mit der 9. Auflage gleichlautende Auflage. Bielefeld und Leipzig 1880. Vorwort zur ersten Auflage.
10 Vgl. Kitaro Nishida: Der metaphysische Hintergrund Goethes. In: Viermonatsschrift der Goethe-Gesellschaft, 3. Bd., Weimar 1938, S. 135-144.
11 Vgl. den Artikel „Das Markenzeichen Kultur“ in der Thüringer Allgemeinen Zeitung vom 23.3.1996. Vgl. ferner Naoji Kimura: Goethe auf den Schild heben. Deutsche Kulturpolitik aus japanischer Perspektive. In: Joachim Sartorius (Hrsg.): In dieser Armut – welche Fülle! Wallstein Verlag. Göttingen 1996, S. 130-135.
12 Beide Zitate in der Übersetzung von Richard Wilhelm: Kungfutse / Gespräche (Lun Yü). Düsseldorf-Köln 1955, S. 37 und S. 45.
13 Aus der ursprünglich literarischen Bewegung wurde freilich eine immer nationalistischere Bewegung. Vgl. Wilhelm Scherer: Die deutsche Literaturrevolution. In: Vorträge und Aufsätze zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland und Oesterreich. Berlin 1874.
14 Heute unter dem Titel „Eine Goethe-Studie“. Vgl. Thomas Mann: Goethe’s Laufbahn als Schriftsteller. Zwölf Essays und Reden. Fischer Taschenbuch. Frankfurt/Main 1982, S. 181.
15 Ebd., S. 184.
16 Ralph Waldo Emerson: Vertreter der Menschheit. 2. Aufl. Jena 1905, S. 243.
17 Vgl. Taeko Matsushita: Rezeption der Literatur des Dritten Reichs im Rahmen der kulturspezifischen und kulturpolitischen Bedingungen Japans 1933-1945. Saarbrücken/Fort Landerdale 1989.
18 Goethes Werke. Hamburger Ausgabe, Bd. 1, S. 369.
19 Ebd., S. 370.
20 Ebd., S. 367.