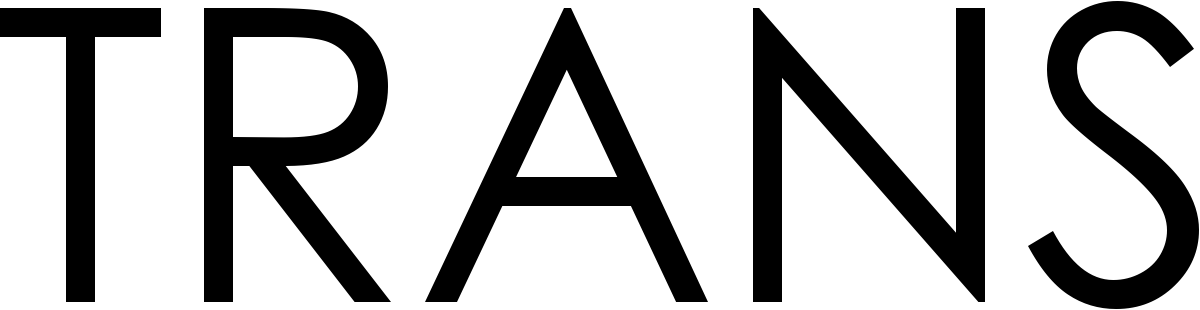Veronika Pólay
(Westungarische Universität, Szombathely, Ungarn) [Bio]
Email: p.veronika@btk.nyme.hu
Das Konzept der Wissensgesellschaft hebt Pluralität und Inklusivität hervor. Es verlangt nach einer auf den Menschen konzentrierten Entwicklung und nach einer Herangehensweise, die neue Möglichkeiten eröffnet. Es basiert darauf, Wissen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu teilen und auszutauschen. Die Grundlage dieses Konzeptes ist weltweite Solidarität und gegenseitiges Verständnis.
Koïchiro Matsuura, Generaldirektor der UNESCO, TRANS 17
-
1. Das WWW
Das Internet und dessen allen zugänglicher Teil, das World Wide Web (im weiteren WWW) hat sich seit dem Erscheinen stark verändert und versucht sich immer zu erneuern. Obwohl bereits Bilder, Werbespots, Musik, Ton usw. zu finden sind, wird das WWW immer noch von Verbalität, Visualität und Textualität beherrscht. Die Mehrkanal-Kommunikation ersetzt die visuellen Reize der Face-to-Face-Kommunikation durch visuelle Kanäle anderer Art (vgl. Quasthoff 1997: 45.).
Die meisten Seiten enthalten die Informationen in textueller Form, in einer Sprache kodiert und schriftlich. Der restliche Teil des Informationsgehaltes wird durch Bilder, Textstruktur, Farben, Zeichen dargeboten. Ein Teil der Texte gehört noch zu den „alten” Textsorten, die aus den traditionellen, vor allem schriftlichen Massenmedien (sog. Printmedien) wie Zeitungen und Büchern bekannt sind.
Immer mehr Seiten bieten aber die neuen Textsorten an, bei denen die alten verändert und miteinander vermischt erscheinen. Man kann kaum solche Seiten finden, die die Texttypen (Reiss, 1971) homogen enthalten. „Hypertextsorten sind im Gegensatz zu Printtextsorten bislang kaum untersucht worden.”(Jakobs 2003: 232)
1.2. Das Korpus
Der Beitrag hat sich zum Ziel gesetzt, in der mitteleuropäischen Region festzustellen, wie weit Hypertext ein grenzüberschreitendes Kulturprodukt ist und wie weit in den einzelnen Ländern kulturspezifische Merkmale zu finden sind.
Das untersuchte Korpus sind die offiziellen Webseiten der Hauptstädte der Nachbarländer Ungarns (Österreich, Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien und Slowenien).
Die Anfangshypothese lautet: Der Hypertext als Kulturprodukt ist eine von Grenzen, Sprachen, Ländern, Nationen unabhängige Textverbindungsweise, die im Internet für die Texte charakteristisch ist.
Untersucht wurden also die folgenden Webseiten:
2.1. Die Untersuchung
Die Untersuchung hatte zwei – voneinander nicht zu trennende – Teile: im ersten Schritt wurden die Eingangsseiten dieser Adressen nach den folgenden Kriterien analysiert:
-
Strukturiertheit
-
Platzierung der Links
-
Aufbau der Links
-
wählbare Sprachen
-
Themenangebot.
Im zweiten Schritt wurde ein Text von dieser Seite gewählt und nach den folgenden Kriterien geprüft:
-
Linearität
-
Sequenziertheit
-
Struktur
-
Länge.
Hier wurde in erster Linie die Frage gestellt, ob die Eigenschaften vom Hypertext auftauchen und wie weit sie charakteristisch sind.
2.2. Die Eingangsseiten
2.2.1. Die Seite von Pressburg ist in vier Sprachen (Slowakisch sowie Deutsch, Englisch und Spanisch) zu lesen. Hinsichtlich des Inhalts sind große Unterschiede festzustellen: in der slowakischen Version findet sich ein völlig anderer Inhalt, als bei den drei anderen Sprachen. Da stehen die verschiedenen kommunikativen Situationen im Hintergrund. Während die slowakische Variante die Stadtbewohner oder die Landleute anspricht, die eher an Informationen über die Stadtverwaltung interessiert sind, sprechen die anderen Varianten die Besucher/Touristen der Stadt an, die an Unterkunft, Sehenswürdigkeiten, etc. Interesse haben.
Die Links sind sowohl horizontal als auch vertikal angebracht, jedoch mit einem Unterschied: die horizontalen Links sind eher Icons: ein Bild und textuelle Links, die als Titel angesehen werden können. Sie signalisieren die Themengruppen, die das größte Interesse erwecken können (Unterkunft, Essen und Trinken, Sehenswürdigkeiten).
Die vertikalen Links sind nur Titel, die nach Themen gruppiert links und rechts am Seitenrand zu finden sind. In der Mitte der Seite sind Nachrichten, die wie die Online-Zeitschriften eher nur die Anfänge der Nachrichten sind. Sie sind als kleine Mosaike angebracht: links ein Bild, dann der Titel der Nachricht rot und unterstrichen, und ein Untertitel schwarz angegeben. Diese Nachrichten sind Pdf-Files zum Herunterladen.
2.2.2. Die Eingangsseite der Stadt Kiev ist nur auf Ukrainisch zu lesen, keine andere Sprache ist angeboten. Dies macht die Analyse schwieriger und konkretisiert die kommunikative Situation, die im Hintergrund steht. Die Seite (die bei der Google-Suche sehr weit hinten bei den Treffern, hinter den Touristeninformationen erscheint) spricht offensichtlich die Stadtbewohner/Landsleute an, die sich für Aktuelles aus der Stadt interessieren.
Die Links sind sowohl horizontal als auch vertikal auf der Seite angebracht, und zwar in textueller Form, also in Form von Titeln. In der Mitte ist zuerst ein längerer Text, die Begrüßung des Bürgermeisters und dann, immer noch in der Spalte in der Mitte folgen Artikelanfänge, wie bei Online-Zeitschriften, ein Bild, ein Titel fettgedruckt und dann der Anfang des Artikels.
2.2.3. Die Seite von Bukarest ist eine Mischung aus rumänischen und englischen Texten. Die weiterführenden Links erscheinen horizontal in zwei Zeilen, die erste Zeile enthält Links in Titelform, die zweite schon Bilder mit Titeln. Die vertikal links und rechts angebrachten Links sind eher längere Einführungen, Sätze und keine Titel. Die Seite ist kleiner, als alle anderen untersuchten Seiten, enthält weniger Links und Texte auf der Eingangsseite.
In der Mitte befindet sich eine englische Begrüßung. Die Links führen zu ganz unterschiedliche Seiten weiter, die in keinem offensichtlichen Zusammenhang zu Bukarest stehen, wie CNN, Los Angeles Times, etc.
2.2.4. Belgrad bietet seine Seite in vier möglichen Sprachen an, wobei die serbische Variante einen anderen Inhalt hat, als die fremdsprachigen Versionen. Anderes Zielpublikum bedeutet also andere Inhalte. In der Mitte oben ist ein Bild, so wie auf allen anderen Seiten. Dann kommen horizontal Links, die eigentlich Menülisten bergen. Die Seite ist vertikal in vier Spalten gegliedert. Links und rechts sind auch Links, links sind längere Titel von Aktualitäten (nur vier), rechts sind sog. nützliche Links, die die Leser sowohl mit deutschen als auch mit serbischen Organisationen verbinden. Über ihnen sind drei Links, die mit Icons das Verstehen erleichtern (Fotogalerie, Wetter). In der Mitte sind zwei Spalten mit Texten, die allgemeine Informationen über die Stadt bieten (Klima, Lage, usw.).
2.2.5. Die Seite von Zagreb kann außer auf Kroatisch auch auf Englisch gelesen werden. So wie bei anderen Seiten, werden auch in diesem Falle in den verschiedenen Sprachen verschiedene Inhalte präsentiert. Die englische Variante enthält Informationen für beide Ziele: Stadtinformationen (Investitionen, Stadtverwaltung, etc.) können vertikal links gefunden werden, wo die weiterführenden Links eigentlich Titel sind. Touristen können aus den Links rechts unten wählen, wo die Themengruppen mit Titel und Bildern versehen sind. Horizontal sind nur drei links oben auf der Seite angegeben.
In der Mitte ist ein langer Text, die Begrüßung des Bürgermeisters. Dieser Text enthält Grußworte und Unterschrift des Bürgermeisters. Es sind keine Links enthalten, der Text ist linear und thematisch zusammengehörend.
Die Links auf der Seite rechts führen zu solchen Seiten, wo z.B. ein Film beginnt, oder auch zu solchen, die verschiedene Arten von Nachrichtentypen verbinden.
2.2.6. Ljubljanas Seite kann auch in zwei Sprachen, Slowenisch und Englisch gelesen werden. Die Seite kann in drei Teile gegliedert werden: oben ist ein Streifen, der das Begrüßungsbild enthält, sowie die Worte des Willkommens. Es sind noch vier Icons, welche offizielle Stadtinformationen enthalten (Verwaltung, Bürgermeisteramt), zu finden. Der Seitenaufbau unterscheidet sich allen anderen untersuchten Seiten. Die linke Hälfte enthält Artikelanfänge, wie bei Online-Zeitschriften. Ein Bild und grün gedruckt die Titel, dann noch der Artikelanfang bedeutet ein Mosaik. Die rechte Hälfte enthält Icons, die weiterführende Links zu verschiedenen Organisationen sind. Diese Links sind eher Symbole und Namen der Organisation. Die Eingangsseite enthält keine Begrüßungs- oder sonstigen Texte.
2.2.7. Die Eingangsseite von Wien kann in fünf Sprachen gelesen werden. Die Seite hat zwei voneinander gut zu trennende Teile: horizontal oben sind zwei Linksstreifen, die allgemeine, nützliche Informationen (eher für die Stadtbewohner) bieten. Die Links sind Titel, die zu Seiten mit thematischen Informationen führen. Der andere Teil der Seite enthält mosaikartige kleine Teile mit Bild und Text, wie bei Online-Zeitschriften.
-
-
Hypertext
-
Hypertexte sind keine neue Textsorte oder ein neuer Texttyp, vielmehr aber eine neue Verbindung der Textteile. Bisher waren sie nur auf Hybrid-Cds bekannt, was jetzt fast allgemein für das WWW charakteristisch ist. Es kann sich nicht nur auf schriftliche Texte beziehen, sondern auf alle Teile der Nachricht, die irgendwie miteinander verbunden sind. „Hypertexte sind institutionell, funktional oder thematisch begrenzte Teilnetze von Modulen, die für einen bestimmten kommunikativen Zweck hergestellt werden und einer thematischen Gesamtvorstellung folgen.“ (Jakobs 2003: 236) Problematisch ist diese Definition deshalb, weil darunter nicht nur Texte, sondern auch andere Elemente, wie Bilder, Filme, usw. zu verstehen sind, die durch Links miteinander verbunden werden.
„Der Link […] als wichtigste Innovation, die das Internet hervorgebracht hat, bedeutet Diskontinuität und Multiplizität, Auflösung und Zerfaserung textueller Strukturen.“ (Kramer: 207)
Nach Jakobs bedeutet Hypertext: „funktional-thematisch bestimmte Ganzheiten” (Jakobs (2003: 239) und „ein Konzept, das sich auf die nicht- oder multi-lineare Organisation und Darstellung von Inhalten richtet“ (Jakobs 2006: 236). Die größte Veränderung zu den traditionellen Texten ist das ganze oder teilweise Verschwinden der sog. „Lesepfade” (vgl. Lehnen 2006). Das bedeutet für die Autoren, dass sie an keiner Stelle der Texte wissen, welche bisherigen Textteile von den Rezipienten rezipiert wurden, also über welche Textkenntnisse sie verfügen. Sie verfassen also ihre Texte redundant, um immer alle wichtigen Informationen darzubieten, und die Rezipienten brauchen zusätzliche Kohärenzhilfen, um die lokale und die globale Kohärenz zu schaffen (Storrer 2003).
Da die Texte nicht linear sind, an verschiedenen Stellen der Seite zu finden sind, voneinander durch Bilder/Filme/Zeichen getrennt, brauchen die Leser zwar nicht neue Kompetenzen, aber einige verstärkt: Orientierung, Selektion und Bewegung (Lehnen 2006). Sie müssen den ganzen Bildschirm rezipieren, um entscheiden zu können, welchen Teil sie brauchen. Dies verstärkt auch das sog. Schlüsselwort-Suchen, was bisher bei einigen alten Textsorten auch bekannt war und eingesetzt wurde (z.B. bei Gebrauchsanweisungen, Beipackzettel). So rezipieren die Leser die Informationen nicht kontinuierlich, sondern mit sprunghafter Aufmerksamkeit, was auch bei den traditionellen Massenmedien, bei Filmen und Werbepausen bei privaten Fernsehsendern beispielsweise, vorkommt.
„Als konstitutive Merkmale von Hypertext lassen sich also die Aufteilung in einzelne Informationseinheiten, deren Verknüpfung, die nichtlineare Anordnung („non-sequential“) und die Freiheit des Lesers bei der Entscheidung über die Reihenfolge beim Lesen zusammenfassen.” (Rieß 2006)
Wichtig ist dabei, ob die angebotenen Einheiten eine kommunikative Einheit bilden oder im Sinne von Storrer (2003) als nichtsequenzierte Texte gelten, und „nichtsequenzierte Texte verzichten gänzlich auf Lesepfade“ (Storrer 2003: 242).
2.3.1. Auf der Eingangsseite von Pressburg sind die Texte in der Mitte Pdf-Files, das bedeutet es sind traditionelle, lineare Texte ohne Links. Unter den angebrachten Links können aber Hypertexte gefunden werden. Das Link Sehenswürdigkeiten enthält fünf Abschnitte in einer thematischen Einheit. Die Schlüsselwörter sind hervorgehoben, sie können auch als thematische Angabe des jeweiligen Abschnitts betrachtet werden. Die gesamte Textmenge erscheint linear und monosequenziert, praktisch ohne Unterbrechung, jedoch mit acht Links im Text. Es gibt keinen Bezug zu den kommunikativen Partnern, weder der Sender, noch der Empfänger sind genannt. Der Text ist objektiv und neutral formuliert, und gehört dem informativen Texttyp an.
2.3.2. Auf der Seite von Kiev kann man nur mit Schwierigkeiten einen Hypertext finden, die meisten Nachrichtenangebote dieser Seite sind nämlich traditionelle, lineare, monosequenzierte Texte ohne Hyperlinks. Die andere Möglichkeit, die beim Öffnen eines Links erscheint, ist eine Liste von weiterführenden Links ohne Text. Die Artikel und Aktualitäten werden oft aktualisiert. Auch wenn Texte mit Links zu finden sind, sind sie linear, in Abschnitte geteilt, mit Fotos illustriert und bilden eine thematische Einheit. Sie enthalten höchstens 1-2 Links, stehen also den traditionellen, linearen Printtexten näher.
2.3.3. In der Mitte der Eingangsseite von Bukarest ist ein längerer Text, der die Besucher begrüßt. Dieser Text enthält bloß zwei weiterführende Links, eine Begrüßung, aber keine Selbstreferenz des Senders oder Unterschrift.
Der Text ist in drei Abschnitte geteilt, die alle eine thematische Einheit bilden. Der Text steht den traditionellen Texten näher, obwohl er auch einige Eigenschaften der Hypertexte hat. Er ist linear und monosequenziert.
2.3.4. Belgrads Seite enthält weiterführende Links, die auch Texte enthalten (die Texte auf der Eingangsseite sind traditionelle, lineare Texte ohne Links).
Unter einem Link findet man einen langen Text, länger als ein Bildschirm, 8 Abschnitte lang. Der Text bildet eine thematische Einheit, ist durch Fotos illustriert und Werbungen unterbrochen. Die textuellen Informationen sind lang, linear und monosequenziert, und enthalten nur zwei weiterführende Links. Die Schlüsselwörter in den Abschnitten sind durch Fettdruck hervorgehoben, sind aber gleichzeitig keine Links.
2.3.5. Zagrebs Eingangsseite enthält unter den Links unten auch Hypertexte. Der Link Zagreb im Brief enthält eine Menge Informationen, die thematisch gruppiert und dadurch multisequenziert sind. Fast alle Abschnitte enthalten eher stichwortartige Informationen und keine Sätze. Beinahe jeder Abschnitt enthält weiterführende Links. Der Inhalt der Seite wird wahrscheinlich nicht im Ganzen rezipiert, sondern das Thema wird selektiert und die anderen Informationsteile werden außer Acht gelassen.
2.3.6. Unter den weiterführenden Links auf der Seite von Ljubljana sind verschiede Inhalte zu finden. Die Nachrichten enthalten eher kurze textuelle Informationen neben einem Bild und weiterführende Links, oder stichwortartige, kurze Informationen als Aufzählung, die oft nicht einmal Sätze sind.
2.3.7. Wiens Seite enthält Informationen, die zu solchen Seiten führen, die wieder Informationbündel enthalten in Form von Bildern, Texten, usw. Diese Texte sind meist in thematische Abschnitte gegliedert, die weiterführende Links enthalten. Die Texte sind multilinear oder nicht-linear und multisequenziert, manchmal auch monosequenziert.
-
Kulturspezifische Elemente
Da die untersuchten Seiten in einem internationalen, theoretisch allen Menschen zugänglichen Medium erscheinen, wo Besucher auch zufällig hingelangen können, sind wahrscheinlich internationale, grenzüberschreitende Muster in der Gestaltung und Sendung der Nachricht feststellbar. Da aber ein Teil der Webseiten offensichtlich nicht ein breites Publikum, sondern eher die Stadtbewohner anspricht, können auch kulturspezifische Elemente vermutet werden.
Diese können externe und interne Elemente sein. (Drewnowska-Vargáné 2006)
„Die Produzent-Rezipient-Konstellation und ihre Definition durch den Sprecher beeinflusst wesentlich die sprachliche Äusserung, die Art der Selbstdarstellung und der Rezipientenberücksichtigung.“ (Piitulainen 2001 :159) „Sprachliche Markierung des Produzenten kann direkt, indirekt oder ausweichend sein, oder sie kann auch völlig ausbleiben.“ (Piitulainen 2001: 160) Da nicht alle Texte untersucht wurden, die von der jeweiligen Eingangsseite erreicht werden können, können bei keiner Webseite allgemeine Feststellungen gemacht werden. Bei den untersuchten Texten wurden weder die Produzenten, noch die Rezipienten angesprochen. Es konnte nur festgestellt werden, wie weit die Eigenschaften des Hypertexts für die jeweilige Seite zutreffen. So können diese als kulturspezifische Elemente betrachtet werden.
Wie aus der Untersuchung zu entnehmen ist, ist in jedem Land unterschiedlich, wie viele Abschnitte, Links, Photos die Texte enthalten, ob und wie weit sie linear oder sequenziert sind. Da aber das Internet ein Kanal im ständigen Wandel ist, ist in der nahen oder fernen Zukunft eine Wandlung auch in dieser Hinsicht zu erwarten. Wahrscheinlich werden die Eigenschaften von Hypertexten immer mehr und in immer mehr Ländern weitgehend angewendet und die Texte werden nach den Bedingungen des neuen Kanals gestaltet.
International verbreitete Elemente sind Voraussetzung für die Herausbildung von international verbreiteten kulturspezifischen Textsorten und -stilen (vgl. Andoutsopoulos 2001 :35). So können auch national spezifische Elemente vom Hypertext entstehen, die die Texte eines Landes von Texten der anderen Länder unterscheiden.
-
Fazit
Die Anfangshypothese konnte nur teilweise verifiziert werden. Wenn Hypertext nur als spezielle Verbindungsweise der Textmodule definiert wird, kann er als grenzüberschreitendes Kulturprodukt betrachtet werden, und der mitteleuropäische Raum kann in dieser Hinsicht als Wissensgesellschaft gelten.
Werden jedoch auch inhaltliche Gesichtspunkte mit einbezogen, können kulturspezifische Eigenschaften festgestellt werden. Ferner muss erwähnt werden, dass die Textgestaltung eng mit der kommunikativen Situation zusammenhängt. Bei den untersuchten Webseiten war die Linearität und Textualität vorhanden, wenn die Seite die Landsleute/Stadtbewohner angesprochen hat. Aber wenn Ausländer/Besucher aus großer Entfernung als wahrscheinliche Rezipienten galten, war die Nicht-Linearität, Modularität vorherrschend.
Auch in diesem Falle existieren Gemeinsamkeiten zwischen Webseiten von Ländern. Obwohl es um andere Länder, Sprachen und Kultur geht, können ähnliche Tendenzen und Textaufbau gesehen werden. Es bleibt jedem Land und jeder Gesellschaft vorbehalten, in grenzüberschreitende Kulturerscheinungen kulturspezifische Züge hineinzubringen, aber es liegt im Interesse von allen, solche Muster zu benutzen, die für jeden verständlich, zugänglich und leicht dekodierbar sind, wenn die Texte ein breites – und internationales – Publikum ansprechen sollen.
Literatur:
Androutsopoulos, Jannis K. (2001). Textsorten und Fankulturen. In: Ulla Fix – Stephan Habscheid – Josef Klein (Hrsg.). Zur Kulturspezifik von Textsorten. Tübingen: Stauffenburg, S.33-50.
Drewnowska-Vargáné, Ewa (2001). Kohärenzmanagement und Emittent-Rezipient-Konstellationen in deutsch-, polnisch-, und ungarischsprachigen Lesebriefen In: Ulla Fix – Stephan Habscheid – Josef Klein (Hrsg.): Zur Kulturspezifik von Textsorten. Tübingen: Stauffenburg, S. 89-108.
Jakobs, Eva- Maria (2003). Hypertextsorten. In: ZGL 31 .S.232-252
Kramer, Olaf (2005). Rhetorik im virtuellen Raum. Das Internet in medialrhetorischer Perspektive. In: Knape, Joachim (Hrsg.). Medienrhetorik. Tübingen: Narr Francke Attempto, S. 195 – 210.
Lehnen, Katrin (2006). Hypertext – kommunikative Anforderungen am Beispiel von Websites. In: Peter Schlobinski (Hrsg.). Von *hdl* bis *cul8r*. Sprache und Kommunikation in den Neuen Medien. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, S.197-210.
Eröffnungsrede von Koïchiro Matsuura, Generaldirektor der UNESCO In: TRANS, Nu. 17. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, ISSN 1560-182X Reviewed Journal URL: http://www.inst.at/trans/17Nr/matsuura.htm
Piitulainen, Marja-Leena (2001). Zur Selbsbezeichnung in deutschen und finnischen Textsorten. In: Ulla Fix / Stephan Habscheid / Josef Klein (Hrsg.). Zur Kulturspezifik von Textsorten. Tübingen: Stauffenburg, S. 159-174.
Quasthoff, Uta M. (1997). Kommunikative Normen im Entstehen: Beobachtungen zu Kontextualisierungsprozessen in elektronischer Kommunikation. In: Weingarten, Rüdiger (Hrsg) (1997). Sprachwandel durch Computer. Opladen: Westdt. Verlag, S.23-50.
Reiss, Katharina (1971). Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München: Max Hueber
Rieß, Sophia (2006). Hypertext: Geschichte und Entwicklung, Definitionen und Merkmale. URL: http://www.eisenlauer.com/website/SS06/Riess_Sophia_Hypertextgeschichte.pdf [zuletzt besucht am 20.11.2010]
Storrer, Angelika (2003). Kohärenz in Hypertexten. In: ZGL 31, S.274-292.