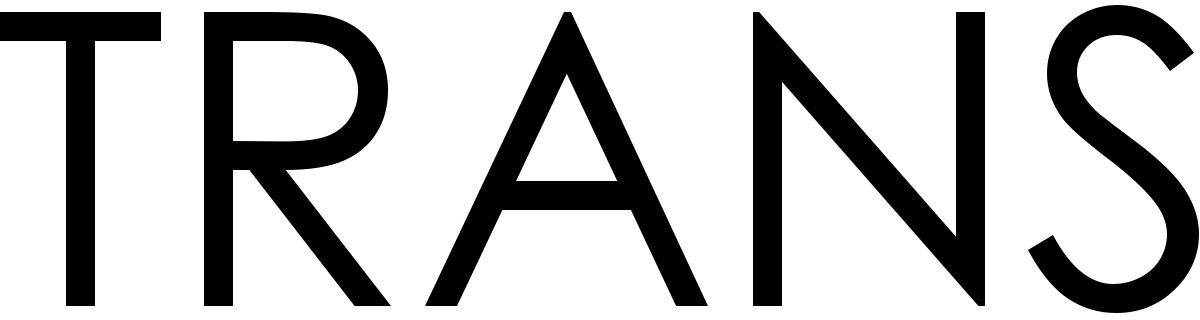HAMDI Khadidja & SEDDI Nacera
Laboratoire Traduction et Méthodologie/TRADTEC, Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed – Algérie
Abstract: With the present article, we will try to present the most important fundamentals for imparting specific communicative purposes skills and knowledge in German teaching in order to prepare the Algerian students of German Studies for the working world. In example of first year students at the University of Ouargla and University of Setif, we have edited a specific communication on „Tourism“; through some forms of practice to develop the receptive (understanding), as well as the productive (oral communication) skills of the students.
Keywords: specific-language, specific communication, specific communicative purposes skills, German teaching
Resümee: Mit dem vorliegenden Beitrag versuchen wir die wichtigsten Grundlagen zur Vermittlung von fachkommunikativen Kompetenzen und Kenntnissen im Deutschunterricht darzustellen, um die algerischen Germanistikstudenten für die Arbeitswelt vorzubereiten. Am Beispiel von Studierenden des ersten Studienjahres an der Universität Ouargla und Universität Setif, haben wir einen fachkommunikativen Text zum Thema „Tourismus“ bearbeitet. Dies durch einige Übungsformen zur Entwicklung der rezeptiven (Verstehensleistung), als auch der produktiven (fachkommunikative Äußerung) Fähigkeiten der Studierenden.
Schlüsselwörter: Fachsprache, Fachkommunikation, fachkommunikative Kenntnisse, Deutschunterricht.
1. Einleitung
Die Globalisierung hat die Welt in einem kleinen Dorf verwandelt. Diese Tatsache erfordert den Erwerb neuer Sprachen, damit man sich mit den Anderen verständigt und auch um einen zukünftigen Arbeitsplatz zu kriegen.
Angesichts der fortschreitenden Globalisierung der Weltwirtschaft rückt die Sprachkompetenz der Erwerbstätigen immer stärker in den Mittelpunkt. Aus diesen Gründen ist der Unterricht heutzutage nach den kommunikativen Kriterien ausgerichtet. In den Privatschulen verwendet man Fachausdrücke; der Lernende trainiert den geförderten Wortschatz beispielweise Wirtschaft oder Medizinbereich.
Ein Deutschunterricht, der den Anspruch hat, Fremdsprachler auf eine Berufstätigkeit im deutschsprachigen Umfeld vorzubereiten, muss sich aus didaktischer Sicht die Frage stellen, was er sprachlich vermitteln will, d. h. welche sprachlichen Inhalte, Dimensionen und Kategorien Gegenstand des Unterrichts werden sollen. Natürlich finden sich hier von der Zielsetzung und Zielgruppe her sehr unterschiedlich ausgerichtete Ansätze des Deutschunterrichts: eine berufsvorbereitende, berufsorientierende/berufsorientierte, berufsbezogene oder berufsspezifische Ausrichtung. (Efing Ch. 2014:145)
Um Studierende im Rahmen des Germanistikstudiums für die Arbeitswelt vorzubereiten, ist es notwendig einige Unterrichtsmethoden einzusetzen, die die fachsprachlichen Kenntnissen und die fachkommunikativen Kompetenzen fördern bzw. entwickeln können. Diese fachkommunikativen Kenntnisse sind als Voraussetzung für Erfolg im Alltag und Beruf.
Obwohl der Unterricht, in den Schulen und Universitäten, auf der Kommunikation abzielt, stellen unsere Studenten beim Sprechen und Herstellung der Texte viele Probleme vor. Also wie soll man den Studierenden die fachkommunikativen Kenntnisse und Kompetenzen im Unterricht vermitteln, damit sie sich auch außerhalb des Unterrichts mit einem Situationsproblem konfrontieren können? Und wie werden die fachsprachlichen Texte von den Studierenden analysiert und interpretiert?
2. Fachkommunikation im Deutschunterricht
2.1. Allgemeines zur deutschen Fachsprache
Fachsprachen sind Sprachformen, die für Nicht-Fachleute eine Barriere aufbauen (z.B.: Gebrauchsanweisungen). Sie dringen weit ins Alltagsleben ein, ohne dass wir dies bemerken. Der Fachwortschatz macht die Fachsprachen aus. Kommunikation, die bei uns einen anderen Stellenwert hat. (Bsp.: Mediziner, hat Ausdrücke für Organe etc.; Technik [Computerfachausdrücke], etc.). Fachsprachen enthalten einen reichlichen Gebrauch von Passivkonstruktionen (Anonymisierung), auch „man“ (Handlung wichtiger als Personen) wird oft verwendet.
Nach Hadumod Bußmann1 lautet die Begriffserklärung von Fachsprache folgendermaßen: „Fachsprachen: Sprachliche Varietäten mit der Funktion einer präzisen und differenzierten Kommunikation über meist berufsspezifische Sachbereiche und Tätigkeitsfelder.“2
Beispiele für Fachsprachen: Mathematik, Sprachwissenschaft, Medizin, Handel, …
Die Grenzen zwischen Fachsprachen und Gemeinsprachen sind durchlässig; wir merken nicht immer den Unterschied. Jedes Fach bringt eigene Sprachvarietäten hervor; zwar gibt es gemeinsame Merkmale, jedoch sind alle mit einem eigenständigen System. Es gibt auf allen Ebenen Charakteristika. Forschung in: Morphologie (Formenlehre), Syntax (Satzlehre), Textgestaltung, Kommunikation(-sflüsse).
Fachsprachendefinition durch Lothar Hoffmann3: „Fachsprache, das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung der dort tätigen Fachleute zu gewährleisten. […] Fachsprachen stehen hierarchisch unter der Gemeinsprachen […].“4
Man kann Fachsprachen nicht nur auf die Terminologie begrenzen. Fachsprachen ermöglichen eine effiziente Verständigung. In jeder Fachsprache gibt es unterschiedliche spezifische Wortschatzelemente, Varietäten, eine unterschiedliche Morphologie.
2.2. Abgrenzung von Fachkommunikation
Jahrhundertlange befasste sich die Fachkommunikation nur mit dem Fachwort als Bezeichnung für einen fachlich interessierenden Gegenstand. In den letzten Jahren hat die linguistische Fachsprachenforschung Objektgebiete erschlossen, die in der langen historischen Herausbildung von Fachsprachen überhaupt nicht untersucht worden waren.
Erst nach der Etablierung einer ausgebauten Textlinguistik in der Sprachwissenschaft waren die Voraussetzungen dafür geschaffen, textuelle Elemente auf allen kommunikativen Ebenen zu analysieren und ihre Produktionsbedingungen zu untersuchen. Seitdem können Textsorten und Fachtextsorten umfassend und angemessen beschrieben und bei Bedarf für den Sprachunterricht didaktisch aufbereitet werden.
In der modernen Linguistik werden Fachtexte von gebrauchssprachlichen Texten der Alltagssprache und von literarischen Texten abgegrenzt. Außerdem werden die auf fachliche (d.h. technische, wissenschaftliche, beruflich spezialisierte) Kommunikation zielenden Texte der Fachsprache von den sozial, gruppensprachlich orientierten Sondersprachen (z.B. Jugendsprache) unterschieden. Dabei können Übergänge und Überschneidungen existieren. So kann allgemeinsprachlicher Wortschatz in Fachsprache übernommen werden und umgekehrt. (Dohrn/ Kraft 2015: 3)
Als Fachsprache wird in der oben erwähnten Definition von L. Hoffmann (1984:53) verstanden: „die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich begrenzten Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung zwischen den in dem Bereich tätigen Menschen zu gewährleisten“. Dabei ist hinzufügen, dass die fachkommunikativen Mittel nicht nur sprachlicher, sondern auch non-verbaler Natur sein können (Bilder, Ziffern, Tabellen, Skizzen, Gesten usw.). Es ist auch wichtig anzumerken, dass Fachkommunikation schriftlich oder mündlich, monologisch oder dialogisch ablaufen kann.
Auch für gegenwärtige Wirtschaftssprache besteht Konsens darüber, dass es sich um einen fachlich heterogenen Gegenstandsbereich, um einen Sammelbegriff für fachsprachlich sehr unterschiedliche Kommunikationsverfahren handelt. Auch darauf muss sich im DaF- Unterricht methodisch und bei der Auswahl von Fachsprachen einstellen. (Dohrn/ Kraft 2015: 5)
3. Fördermöglichkeiten zur Vermittlung und Aneignung der kommunikativen Fachsprache im universitären Kontext
Die angemessene Verwendung der Fachsprache zählt zu den zentralen Kompetenzen im universitären Kontext.
Im Rahmen ihres Studiums werden die Studierenden häufig mit der Aufgabe konfrontiert, sowohl schriftliche wissenschaftliche als auch mündliche kommunikative Arbeiten, wie etwa Semina- oder Abschlussarbeiten, zu verfassen. Diese werden bewertet und bilden somit ein entscheidendes Kriterium für die Beurteilung des Studienerfolgs der Studierenden.
Insofern sollte an Universitäten ein großer Wert auf die Vermittlung und Aneignung kommunikativer Fachsprache im Deutschunterricht gelegt werden.
Im Folgenden werden die wichtigsten fachkommunikativen Anforderungen im Beruf, sowie einige Übungsformen zur Vermittlung fachsprachlicher Kenntnisse im Deutschunterricht dargestellt.
3.1. Fachkommunikative Anforderungen im Beruf
Diese Forderung nach der Vermittlung fachsprachlicher Kenntnisse und fachkommunikativer Kompetenzen wird durch die sprachlich-kommunikativen Anforderungen, die nicht allein an Studierende, sondern auch an Auszubildende diverser Berufe gestellt werden, unterstrichen. Diese Anforderungen sind in der Regel derart komplex, dass sie im Rahmen der Ausbildung allein kaum bewältigt werden können, sondern einer allgemeinen fachsprachlichen und -kommunikativen Grundlegung durch den Unterricht in der Schule bedürfen (insbesondere auch deshalb, weil sie in Ausbildung und Studium meist mehr oder weniger vorausgesetzt werden). Die genannte Ausbildungsverordnung zum Kraftfahrzeugmechatroniker/ zur Kraftfahrzeugmechatronikerin (2007: 2) belegt diese vielfältigen und komplexen sprachlich-kommunikativen Anforderungen, indem mit „betrieblicher und technischer Kommunikation“ und „Kommunikation mit internen und externen Kunden“ ein intra- und ein interfachlicher Kommunikationsbereich unterschieden und im Weiteren näher charakterisiert wird.
Betriebliche und technische Kommunikation (Kommunikationsbereiche Kraftfahrzeugmechatroniker/in (Bundesministerium der Justiz 2007: 9-10):
a) Bedeutung der Information, Kommunikation und Dokumentation für den wirtschaftlichen Betriebsablauf beurteilen und zur Vermeidung von Störungen beitragen
b) betriebliches Informationssystem zum Bearbeiten von Arbeitsaufträgen anwenden und zur Beschaffung von technischen Unterlagen und Informationen nutzen
c) Gespräche mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und in der Gruppe situationsgerecht führen, Sachverhalte darstellen sowie deutsche und englische Fachausdrücke anwenden
d) Kommunikation mit vorausgehenden und nachfolgenden Funktionsbereichen
sicherstellen.
Im Folgenden werden einige Übungsformen zur Forderung der Rezeption sowie der Produktion von fachkommunikativen Texten bei den algerischen Studierenden (am Beispiel von Studenten des ersten Studienjahres an den Universitäten Ouargla und Setif).
3.2. Übungsformen zu fachkommunikative deutschsprachigen Texten für erstjährige Studierende
Wichtig für die Zielsetzung im DaF- Studium und den kommunikativ orientierten DaF-Unterricht ist es, genauer zu bestimmen, aus welcher Perspektive und mit welchen Zielen kommunikativen Interaktion als Lerngegenstand ausgehandelt und vermittelt werden soll.
In diesem Beitrag soll es um die Vermittlung fachkommunikativer Kenntnisse im Deutschunterricht am Beispiel eines Textes zum Thema „Tourismus“ (Die Deutschen und der Tourismus) gehen.
3.2.1. Übungen zur Entwicklung der Verstehensleistung fachkommunikativer Texte
Für Tourismusangestellten ist es in erster Linie wichtig, sich mit Fachleuten über tourismusspezifische Themen und in beruflich relevanten Kommunikationssituationen angemessen auszudrücken, verhalten und verbal bzw. nonverbal bewegen zu können. Notwendig ist dabei die Berücksichtigung unterschiedlicher Rahmenbedingungen, Lernziele und didaktisch- pädagogischer Prinzipien sowie die eingehende Betrachtung der Zielgruppe und ihrer Bedürfnisse.
Die Studenten sollten den Text „Die Deutschen und der Tourismus“ lesen und die Rezeption dieses fachkommunikativen Textes wird durch das beim Adressaten bereits vorhandene Wissen, durch seine Vorerfahrungen und seine Erwartungen bezüglich der Textinhalte (nämlich seine Informationen und Erfahrungen zum Thema Tourismus) gesteuert.
Dies wurde durch die Aktivierung des Vorwissens von Studierenden über das Thema Tourismus realisiert, um sich die anschließende Textbearbeitung zu erleichtern; d.h. die Diskussion von Vorwissen und Vorerfahrungen der Studierenden lässt den nachfolgenden Text über Tourismus leichter verstehen und die im Text vorhandenen sprachlichen Strukturen und Lexika schneller erschließen.
Die Informationsentnahme aus der Illustration ist auch eine bedeutende Übungsform für die Entwicklung der Verstehensleistung. Hier werden die Studierenden aufgefordert, an die auf einem Bild dargestellte Diskussion zu überlegen, dann sich auszudrücken.
3.2.2. Übungen zum kommunikativen fachsprachlichen Grundwortschatz
In fremdsprachlichen Lehrmaterialien und –werken nimmt die Wortschatzarbeit stets einen breiten Raum ein. Je umfangreicher der Wortschatz ist, desto größer scheint auch die Kommunikationsfähigkeit zu sein. Ein Mangel an situationsangemessenen Wörtern beeinträchtigt die sprachliche Verständigung oftmals wesentlich mehr als lückenhafte oder sogar falsche Grammatikkenntnisse, wobei es allerdings auf den Grad und Umfang des Verstoßes oder fehlenden grammatischen Zusammenhanges ankommt.
Die deutsche Sprache weist einen Wortbestand von ca. 300.000 bis 500.000 Wörter auf. Rechnet man den Fachwortschatz noch dazu, erweitert sich der Umfang. Ein Deutscher Muttersprachler verfügt über einen rezeptiven Wortschatz von 100.000 Wörtern, sein produktiver Wortschatz besteht dahingegen nur aus ca. 12.000 Wörtern. Der Duchschnittssprecher verwendet Fachsprachenwörter eher selten. Die individuelle Verfügbarkeit von Wörtern der Allgemeinsprache schwankt stark und wird auf 2000 bis 20.000 Wörter geschätzt (Bohn 1999: 8).
Heutzutage beschäftigt sich die Forschung zum Thema Wortschatzentwicklung mit der Frage, welche und wie viele Wörter wann im Unterricht zu lernen sind und gelernt werden können, woraus Wortlisten unterschiedlicher Systematisierungen hervorgingen und-gehen. Die Auswahlkriterien berücksichtigen stilistische, pragmatische und lernpsychologische Gegebenheiten und bestimmen oftmals den sogenannten „Lernwortschatz“ (Dohrn 2015: 132).
Für eine effiziente Aneignung der Lesestrategien benötigen die Studierenden einen fachsprachlichen Grundwortschatz, auf dessen Erwerb spezielle Übungen abzielen. Diese Übungen haben zum Ziel, den Studierenden lexikalische Besonderheiten der fachsprachlichen Kommunikation explizieren und zum Umgang mit fachkommunikativen Texten hinzuführen.
In unserem Fall, für den Text „Die Deutsche und der Tourismus“ ist es wichtig, den Studierenden im Unterricht sowohl allgemeinsprachliche Wörter, Satz- und Textzusammenhänge als auch Fachvokabular (rezeptiv und produktiv) für den Tourismusbereich zu vermitteln.
Die Studierenden sind aufgefordert, deutsche Entsprechungen zu Begriffen oder zu fachkommunikativen Ausdrücken zu finden. Dabei nehmen sie sich entweder ein Wörterbuch oder vorgegebene Texte zu Hilfe. Diese Übung lässt sich in Form von Notizen machen, ergänzen von Tabelle, Zuordnung von Begriffen und ihren deutschen Übersetzung gestalten.
Bevor die Studierenden sich dem Textinhalt zuwenden, werden sie mit inhaltlich wichtigen Begriffen konfrontiert, deren Grundformen sie im Text finden und notieren sollen (z.B. sie sollen alle Nomen im Plural herausfinden und ihre Singularformen ausgeben). Sie sollen auch den richtigen Begriff in den Kontext einbauen.
Im Bereich der Wortbildung, handelt es sich, um Formen wie Ableitung und Wortzusammensetzung, die in der fachsprachlichen Kommunikation zum Thema „Tourismus“ aufweisen und die im Unterricht systematisch behandelt werden sollen. Die Studierenden werden in der Ableitungen aus Nomen Verb, Verb Nomen und Nomen Adjektiv eingeführt.
Für die Wortzusammensetzung sollen die Studierenden: Komposita in ihre Teile zerlegen, die vorangestellten bzw. nachangestellten Konstituente ergänzen.
Nach der Übungslösung und der Bewertung sind wir zu den folgenden Ergebnissen gelungen:
-
Die Mehrheit der Studenten (ungefähr 90%) haben sich für die Diskussion des behandelten Themas (Tourismus) interessiert; d.h. der Diskusstionsanlass motivierte die Studenten für die Fachkommunikation im Unterricht und das hat den Prozess des Textlesens erleichtert.
-
60% der Studenten könnten der erworbene (rezeptive) fachkommunikative Grundwortschatz reproduzieren – durch sprachliche Äußerung oder durch Aufsatz).
-
Im Bereich der Wortbildung, handelt es sich um Übungen zu Ableitungen und Wortzusammensetzungen (Komposita), die in der fachsprachlichen Kommunikation zum Thema „Tourismus“ aufweisen und die im Unterricht systematisch behandelt werden sollen. 49% der Studenten haben die Übung richtig gelöst.
4. Schlussbemerkungen und Vorschläge
Durch diesen Beitrag versuchen wir Entschlüsselstrategien von fachkommunikativen Texten im Deutschunterricht zu vermittelt, die für die Entnahme und Auswertung von Informationen benötigt werden. Außerdem wird der fachkommunikative Grundwortschatz systematisch erworben, der den Studierenden Grundlage für die rezeptive bzw. produktive Handlungsfähigkeit liefert.
Das behandelte Thema und die Diskussionsanlässe dienen dem fachkommunikativen Interesse. Es wurde so ausgewählt, dass die Studierenden sich darin wiederfinden, die entnommenen Informationen verwerten und in ihrem fachkommunikativen Umfeld verwenden können.
Die erworbenen Strategien sollen die Studierenden befähigen, im Anschluss an den Kurs ihre rezeptive Handlungsfähigkeit im Studium bzw. im Beruf eigenständig weiter auszubauen.
Folgende Vorschläge sind also von großer Bedeutung:
-
– Im fachkommunikativen Deutschunterricht sollten Diskussionsanlässe vom Lehrer geschaffen werden, um das fachkommunikative Interesse der Studierenden zu erhöhen und die fachkommunikativen Kenntnisse zu erweitern.
-
-Für eine effiziente Aneignung der Lesestrategien benötigen die Studierenden einen fachsprachlichen Grundwortschatz, auf dessen Erwerb spezielle Übungen eingesetzt werden sollen. Diese Übungen haben zum Ziel, den Studierenden lexikalische Besonderheiten der fachsprachlichen Kommunikation explizieren und zum Umgang mit fachkommunikativen Texten hinzuführen.
Daraus lässt sich schließen, dass der erarbeitete fachkommunikative Deutschunterricht handlungsorientiertes, autonomes und authentisches Lernen fördert.
Literatur
– DOHRN, A./ KRAFT, A. (2015); Fachsprache Deutsch. International und interdisziplinär. Hamburg.
– EFING, Ch., (2014); Vermittlung von Fachsprache. Info DaF. Berlin.
– HADUMOD, B. (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft 2. aufl. Stuttgart Kröne. In: Lothar Hoffmann: Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung. Akademie- Verlag Berlin. 1984. In: Dohrn, A./ Kraft, A.; Fachsprache Deutsch. International und interdisziplinär. Hamburg. 2015.
– HOBERG, R. (1998): Angewandte Sprachwissenschaft. Langenscheidt. Frankfurt am Main. In: Kniffka, Gaabriel/ Roelcke, Thorsten: Fachsprachenvermittlung im Unterricht. Die Onleihe. 21/12/2015. www..onleihe.de/static/content/utb/…/v978-3-8385-4094-8.pdf
– JEUK, S. (2015): Sprachförderung und Förderdiagnostik in der Sekundarstufe I. Stuttgart: Fillibach bei Klett. 2013. In: Dohrn, Antje/ Kraft, Andreas; Fachsprache Deutsch. International und interdisziplinär. Hamburg.
– KNIFFKA, G./ ROELCKE, Th. (2015): Fachsprachenvermittlung im Unterricht. Die Onleihe. 21/12/2015. In: www..onleihe.de/static/content/utb/…/v978-3-8385-4094-8.pdf. 12/02/2017.19:13.
– ROELCKE, Th. (2009): Fachsprachliche Inhalte und fachkommunikative Kompetenzen als Gegenstand des Deutschunterrichts für deutschsprachige Kinder und Jugendliche. 01/02/2009. In: www.fachsprache.net/…/Roelecke_fachsprachliche_Inhalte_1-2-2009 (12.02.2017/ 19:30).
– ROELCKE, Th. (2015): Kommunikative Effizienz. Berln. 2002. In: Kniffka, Gaabriel/ Roelcke, Thorsten: Fachsprachenvermittlung im Unterricht. Die Onleihe. 21/12/2015. www..onleihe.de/static/content/utb/…/v978-3-8385-4094-8.pdf.
1 Hadumod Bußmann: Lexikon der Sprachwissenschaft 2. aufl. Stuttgart Kröner 1990. S.25.
2Die Varietät ist eine bestimmte Sprachform, die durch ein außersprachliches Kriterium bestimmt wird. (Bsp.: räumliche Gebundenheit →regional [Dialekte]; soziologische Gebundenheit →gesellschaftlich bedingt: höhere Bildung = höhere Sprachbildung; funktionale Gebundenheit → Fachsprachen; situative Gebundenheit → unterschiedliche Sprachformen und Sprachverhalten einer Person zu verschiedenen Zeitpunkten →man spricht mit dem Arzt anders als im Supermarkt).
3 Lothar Hoffmann: Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung. Akademie- Verlag Berlin. 1984. S. 53.
4 Das hiergenannte Wort „begrenzbar“ ist nicht völlig eingrenzbar! Man darf nämlich nicht übergenau werden.