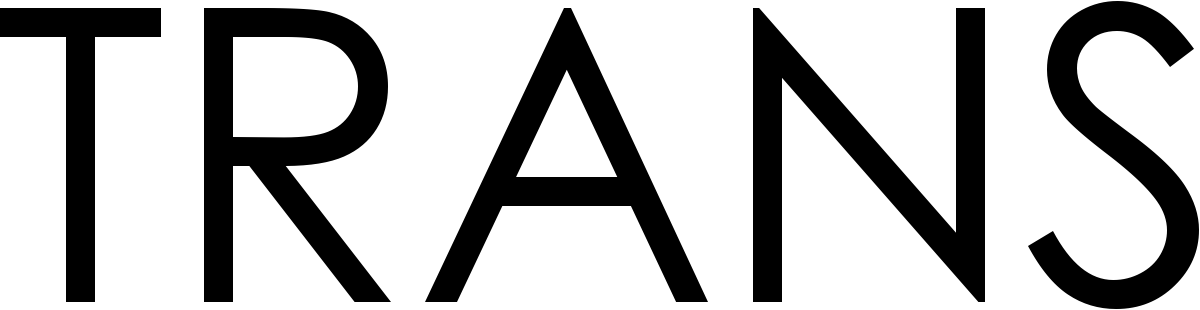Nr. 18 Juni 2011 TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften
Section | Sektion: Grenzüberschreitende Wissensregionen
Sektionsbericht
Veronika Pólay [BIO] | Tibor Polgár [BIO] (Westungarische Universität, Szombathely, Ungarn)
Email: p.veronika@btk.nyme.hu | poti@mnsk.nyme.hu
Konferenzdokumentation | Conference publication
Die reale Konferenz fand in Ungarn, an der Westungarischen Universität in Szombathely statt. Die meisten Teilnehmer waren Mitarbeiter der Westungarischen Universität, aber es kamen auch Vortragende aus anderen Universitäten Ungarns. Viele haben schon 2007 im Rahmen der KCTOS-Konferenz in Wien vorgetragen.
Die Konferenz wurde vom Prorektor der Universität, Prof. Dr. Károly Gadányi eröffnet, der die Wichtigkeit solcher Treffen und des Austauschs von Forschungsergebnissen betonte. Die beiden Sektionsleiter, Dr. Veronika Pólay und Dr. Tibor Polgár sprachen über die Weltkonferenz, die Bedeutung der Wissensregionen. Außerdem erwähnten sie die Auswirkungen der Globalisierung, das Verschwinden der Grenzen, sowie die Möglichkeit des schnellen Informationsaustausches.
Als erste Vortragende sprach Veronika Pólay über den Hypertext und seine Verbreitung in der mitteleuropäischen Region. Sie untersuchte die Eingangsseiten der offiziellen Webseiten der Hauptstädte der Nachbarländer Ungarns und das Vorkommen und die Eigenschaften der Texte.
Daran anschließend referierte Bernadette Balázs. Ihr Thema war mit dem ersten Beitrag eng verbunden. Das „Globish“, die Fremdsprachen-Variante des Englischen, zeugt auch von der Globalisierung und vom Verschwinden der Grenzen. Im Vortrag wurden ein kognitiver Ansatz präsentiert und typische Erscheinungen des „Globish“ dargestellt.
Das Englische als lingua franca stand im Mittelpunkt des Beitrags von Lívia Foki. Sie stellte den tatsächlichen Gebrauch des Englischen in internationalen Organisationen vor, was einige Abweichungen von dem offiziell Deklariertem zeigt.
Csilla Szabó hatte zwar auch die englische Sprache als Thema ihres Vortrags gewählt, sie präsentierte es aber in einem anderen Zusammenhang als die eben erwähnten Kolleginnen. Sie hob hervor, wie unterschiedlich ein- und derselbe Begriff von Mitgliedern des gleichen Kulturraumes verstanden werden kann. In dem Beitrag wurden sogenannte Realien vorgestellt, die in den einzelnen Ländern auf jeweils andere Weise erklärt und definiert werden müssen (wie z.B. Ministerium im Englischen).
Doreen Fritsche (Koatorin Marietta Pilsits) stellte verschiedene Kommunikationsmodelle vor und untersuchte sie am Beispiel des Internets. Sie sprach von der Veränderung der Kommunikation und den diversen Möglichkeiten des Kommunizierens.
Eszter Salamon sprach über Minderheiten in Italien, die ihre eigene Sprache und Kultur auch durch die Musik behalten möchten. Sie benutzen dazu über die traditionellen Musikgattungen hinaus auch die moderne Musik in der eigenen Sprache. Letzteres wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer populärer in den beiden Sprachgemeinschaften Sardisch und Friuli. Auch das Internet hilft dabei, die interaktive Sammlung der traditionellen Musikgattungen der beiden Minderheiten in Italien von überall in der Welt kennenzulernen.
Anna Nagy hatte Kunsttherapie und -pädagogie als Thema. Sie stellte in erster Linie die pädagogischen Methoden des Malers Paul Klee im Bauhaus vor. Dies hängt eng mit den „modernen“ philosophischen Bestrebungen zusammen, andererseits regt es die Kunstpädagogen von heute an. Die Schüler und Lehrer im Bauhaus stammten aus ganz Europa und sie können als Beispiel für die internationalen und interdisziplinären Bestrebungen von heute dienen.
Opern und Musikkultur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren das Thema des Beitrags von Katalin Tamás. Zu dieser Zeit waren die reisenden Theatergesellschaften von großer Bedeutung, denn durch sie kamen die komischen Opern und Intermezzi der beliebten italienischen Komponisten nach Wien und in andere Städte bzw. Gebiete Europas. Diese Werke konnten noch durch ihre Libretti bekannt werden, die mehrmals von verschiedenen Komponisten in Musik gesetzt wurden. Die Tabelle der Aufführungsorte der einzelnen Opern studierend kann man feststellen, dass es manchmal nur ein Jahr gedauert hat, bis das gleiche Libretto in einer anderen Stadt Europas (mit der Musik eines anderen Komponisten) aufgeführt wurde, von Rom über Venedig, bis Dresden oder Tschechien – unabhängig von den Sprach- oder Landesgrenzen.
Antonio Sciacovelli sprach über die österreichisch-ungarische Monarchie am Beispiel des Romans „Harmonia caelestis“ von Péter Eszterházy. Der Vortragende plädierte dafür, über diesen gemeinsamen „Schatz“ dieser (heute schon) zwei Länder nicht in nostalgischer, bitter-süßer Stimmung zu sprechen, sondern eher kritisch, ironisch und spielerisch. Weiters betonte er, dass diese Periode der gemeinsamen Geschichte für immer bleibe, und sie den beiden Ländern nicht zu nehmen sei.
Csilla Roznár-Kun stellte in ihrem Vortrag das Werk „Il Milione“ von Marco Polo vor. Der große Weltreisende hatte es im dreizehnten Jahrhundert einem Mitgefangenen im Gefängnis von Genua diktiert, und dadurch wurden seine Erfahrungen im Reich des Großen Khan auch schriftlich verewigt. Inzwischen sind aber die Originalmanuskripte leider nicht mehr zu finden, aber viele Kopien und Übersetzungen halfen dabei, dass in den vergangenen Jahrhunderten nicht nur andere neugierige Reisende (wie z.B. Kolumbus), sondern auch Schriftsteller und Dichter sich von Marco Polos Buch inspirieren lassen konnten – unter ihnen Samuel Taylor Coleridge, Franz Kafka, Dino Buzzati, Italo Calvino und Umberto Eco.
Die zweite Hälfte der Sektion – der sportwissenschaftliche Teil – wurde durch den Vortrag von Tibor Polgár eingeleitet, der über die Zusammenhänge zwischen Deutungen und bekannten Bedeutungselementen des Begriffs Gesundheit und der physischen Aktivität von StudentInnen in Bologna und Szombathely sprach. Das Publikum fragte, ob eine Erweiterung der Untersuchung geplant sei. Der Autor zählte in seiner Antwort die Länder auf, wo sie bereits durchgeführt wurde; dadurch sei die Fortsetzung gewährleistet.
Katalin Bíró-Ilics und Adrienn Balogh-Bakk präsentierten ihre Untersuchungen in Bezug auf integrative Erziehung im Kindergarten. Sie hoben hervor, wie wichtig es in unseren Tagen ist, dass auch behinderte Kinder in die Gesellschaft integriert werden. Alle Kinder müssen Erfahrungen über Abweichungen sammeln, sei es in dieser oder einer anderen Art, und sie müssen lernen, damit umzugehen.
Im Anschluss daran trug Emőke Bucsy-Martos Ergebnisse von Untersuchungen in Kinderkrippen in Neufeld (Österreich) und Sopron (Ungarn) vor, in denen sie die sportpädagogischen Methoden, Strukturen und Inhalte der Erziehung in den Kinderkrippen der beiden Länder miteinander verglich. Da im Publikum viele Eltern zuhörten, ergab sich eine lebhafte Diskussion.
Judit Bokor wählte zum Thema ihres Vortrags die Motivation der Gäste des Büker Heilbades. Sie stellte dar, dass sich die Wirkungen der Urbanisierung auch im Heiltourismus zeigen; die meisten Gäste kommen nicht wegen der Wellness-Dienstleistungen, um sich verwöhnen zu lassen, sondern eher zur Heilung, weil der Gesundheitszustand durch das beschleunigte Tempo des Lebens, die bewegungsarme Lebensführung auch schon in frühem Alter negativ beeinflusst wird.
Lea Éva Tóth stellte ihre Untersuchungen (Koautoren Péter Fritz und Katalin Szigeti) über den Gebrauch von Nahrungsergänzungsmitteln bei Body Buildern und Kraftsportlern vor. Sie betonte, dass sich in letzter Zeit die zu verfolgenden Ziele verändert haben, wie auch unser Leben, und dass die Wirkungen auch auf dem Gebiet des Sports zu spüren sind. Mangelkrankheiten, Mangelsymptome stehen oft im Hintergrund. Body Building hat sich als anerkannte Sportart etabliert, die Zufuhr von Nahrungsergänzungsmitteln ist allgemein akzeptiert, obwohl sich die meisten über die Wirkungen und Nebenwirkungen, über die empfohlene Menge und Dosierung nicht im klaren sind.
László T. Kovács (Koautor József Bognár) schloss sich in seinem Beitrag zum vorigen Thema an, indem er die Wirkungen der Urbanisierung in verschiedenen Regionen Ungarns bezüglich Körpererziehung untersuchte. Er analysierte die Bewegungsmöglichkeiten der Umgebung, die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Bewegung und Erholung von Schülern, Eltern und Lehrkräften durch Befragung. Die Zuhörer erwähnten ihren Anspruch auf diese Möglichkeiten und gleichzeitig die mangelnde Zeit dazu.
Judit Hesztera-Ekler präsentierte einen theoretischen Vergleich der Ausbildungssysteme auf dem Gebiet der Sportwissenschaft in Österreich und Ungarn. Die Länder, die das einheitliche Bologna-System eingeführt haben, gelten in dieser Hinsicht als Wissensregion – trotzdem sind Unterschiede festzustellen. Der Inhalt, die verschiedenen Stufen, die Verzweigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten wurden erörtert.
Ebenfalls um einen internationalen Vergleich – allerdings in einer früheren Altersstufe – ging es in dem Vortrag von Orsolya Németh-Tóth: die Messung der Schulreife in mehr als vierzig Ländern, auf allen fünf Kontinenten. Die Methoden, das Einschulungsalter wurden auch erwähnt, was eine lebhafte Diskussion im Publikum auslöste.
István Ágoston Simon sprach über die adaptive Körpererziehung. Die negativen Prozesse werten die präventiven Rehabilitations-Tätigkeiten auf, deren Begriff in den mitteleuropäischen Ländern unterschiedlich definiert wird. Die gegenständlichen und persönlichen Bedingungen der adaptiven Körpererziehung, die deren Wirksamkeit in großem Maße beeinflussen, weisen auch große Unterschiede in den Ländern der Region auf,.
Andrea Németh und Zoltán Szatmári präsentierten einen irisch-ungarischen Vergleich, in dem sie Schüler über ihre Meinung bezüglich Wichtigkeit der verschiedenen Schulfächer befragten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Meinungen stark abweichen, was auch durch die unterschiedliche Auffassung vom Stellenwert des Sports im Leben zu erklären ist. Die größere Zahl der Sportstunden in Ungarn bedeutet bei weitem nicht, dass die Schüler Sport als Selbstverständlichkeit betrachten und als integrierten Teil des Lebens ansehen. Vielmehr gehört es zum Alltag der irischen Schüler, dass sie zwar weniger Sportstunden haben, dazu aber in Sportvereinen physisch aktiv sind, was auch bei einem Schulwechsel eine wichtige Komponente des Lebens bleibt.
Als Abschluss des Tages bedankten sich die Sektionsleiter für die rege Teilnahme und das große Interesse. Sie erwähnten, dass die Forschungsergebnisse von so unterschiedlichen Gebieten wie Sport-, Sprach-, Literatur- und Kunstwissenschaft auch gemeinsame Züge enthalten und dies diese Felder, sowie die ForscherInnen einander näher bringen kann, wovon alle nur profitieren können. Im Namen der Vortragenden bedankte sich László T. Kovács bei den Organisatoren für die Möglichkeit und betonte, wie freundlich, interessant und anregend die Sektion war.
Inhalt | Table of Contents Nr. 18
For quotation purposes:
Veronika Pólay | Tibor Polgár: Sektionsbericht: Grenzüberschreitende Wissensregionen –
In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 18/2011.
WWW: http://www.inst.at/trans/18Nr/III-5/sektionsberichtht_3-5.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2011-06-16