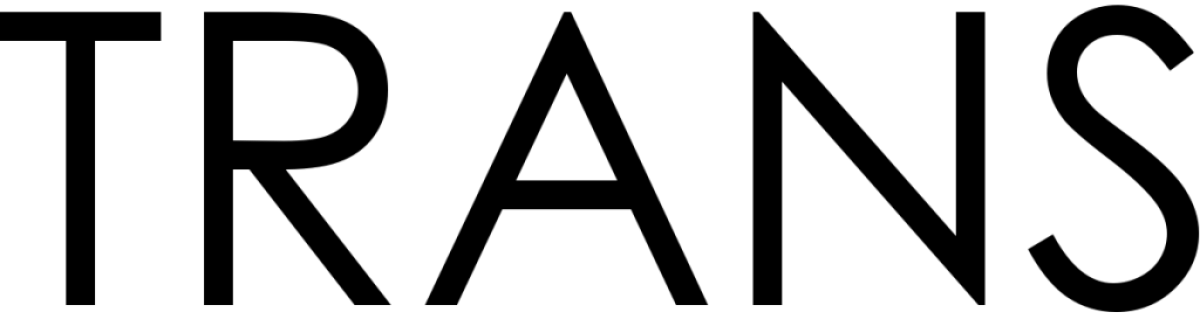Simona Leonardi
(Università degli Studi di Genova)
simona.leonardi@unige.it
Abstract
Der im Zuge der Entstehung und Konsolidierung der Nationalstaaten im 19. Jh. etablierte „monolinguale Habitus“ (Gogolin 1994) prägt bekanntlich Europa weiter. Heute können wir sehen, dass dieser Habitus nicht bedeutet, dass es in unserer Gesellschaft keine Mehrsprachigkeit bzw. keinen Sprachkontakt gibt; fremd- und mehrsprachige Situationen sind aber mit einer solchen Ideologie schlecht kompatibel und lassen sich deswegen schwer eingliedern. Wie war nun die Lage in der ersten Hälfte des 20. Jhs.? Vor diesem Hintergrund geht dieser Aufsatz der Frage nach, wie deutschsprachige Israelis, die vor 1930 geboren wurden, Situationen von Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt darstellen – dabei werde ich mich besonders auf ihre Ausführungen zur jiddischen Sprache fokussieren. Die Untersuchung erfolgt auf der Grundlage von Ausschnitten aus dem sog. Israelkorpus, das zwischen 1989 und 2019 von der Sprachwissenschaftlerin Anne Betten und Mitarbeiterinnen in Israel gesammelt wurde. Das Korpus besteht aus narrativen Interviews mit deutschsprachigen Israelis, die in den 1930er Jahren aus rassistischen und politischen Gründen zur Emigration aus Deutschland, Österreich und nach und nach annektierten Gebieten gezwungen wurden. Ziel der Untersuchung ist es, ein Bild von den Spracheinstellungen dieser Sprechenden zu gewinnen sowie von dem Zusammenhang zwischen Migrationsprozessen und herrschenden Sprachideologien.
L’“habitus monolingue” (Gogolin 1994, instauratosi nel corso della formazione e affermazione degli Stati nazionali nel XIX secolo continua a caratterizzare l’Europa. Oggi possiamo constatare che questo habitus non implica l’assenza di plurilinguismo o di contatto linguistico nella nostra società; tuttavia, vista la loro scarsa compatibilità con questa ideologia, le situazioni plurilingui sono difficili da integrare nella narrativa dominante. In filigrana a queste considerazioni, l’articolo esamina il modo in cui persone israeliane di lingua tedesca nate prima del 1930 presentano situazioni di plurilinguismo e di contatto linguistico, con un particolare focus sulla lingua yiddish. Lo studio si basa su brani del cosiddetto Israelkorpus, raccolto tra il 1989 e il 2019 dalla linguista Anne Betten e da sue collaboratrici in Israele. Il corpus è costituito da interviste narrative a israeliani di lingua tedesca costretti a emigrare per motivi razziali e politici negli anni Trenta dalla Germania, dall’Austria e dai territori gradualmente annessi. Obiettivo dell’analisi è quello di delineare un quadro degli atteggiamenti linguistici di questi parlanti, nonché dell’interconnessione tra processi migratori e ideologie linguistiche dominanti.
The “monolingual habitus” (Gogolin 1994) established in the course of the emergence and consolidation of nation-states in the 19th century continues to characterise Europe. Today we can see that this habitus does not mean that there is no plurilingualism or language contact in our society; yet, given their lack of compatibility with this ideology, plurilingual situations are difficult to embed in the dominant narrative. Against this background, the present article examines how German-speaking Israelis born before 1930 represent situations of plurilingualism and language contact – focussing in particular on the Yiddish language. The study is based on excerpts from the so-called Israelkorpus, which was collected between 1989 and 2019 by the German linguist Anne Betten and her collaborators in Israel. The corpus consists of narrative interviews with German-speaking Israelis who were forced to emigrate from Germany, Austria and gradually annexed territories in the 1930s for racist and political reasons. The analysis tackles the language attitudes of these speakers and the interplay between migration processes and prevailing language ideologies.
1. Einleitung
Der im Zuge der Entstehung der Nationalstaaten im 19. Jh. etablierte „monolinguale Habitus“ (Gogolin 1994) prägt bekanntlich das heutige Europa weiterhin. Heute erkennt man, dass dieser Habitus nicht bedeutet, dass es in unserer Gesellschaft keine Mehrsprachigkeit bzw. keinen Sprachkontakt gibt; fremd- und mehrsprachige Situationen sind aber mit dieser immer noch bestehenden Ideologie schlecht kompatibel und lassen sich deswegen schwer eingliedern (Busch 2017). Wie war nun die Lage in der ersten Hälfte des 20. Jhs.?
Vor diesem Hintergrund geht mein Beitrag der Frage nach, wie deutschsprachige Israelis, die vor 1930 geboren wurden, Situationen von Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt darstellen – dabei werden besonders ihre Ausführungen zur jiddischen Sprache fokussiert.
Die Untersuchung wird auf der Grundlage von Ausschnitten aus dem sogenannten Israelkorpus durchgeführt, das zwischen 1989 und 2019 von der Sprachwissenschaftlerin Anne Betten und Mitarbeiterinnen in Israel zusammengestellt wurde (s. etwa Betten 1995; Betten & Du-nour 2000; Betten & Leonardi 2023). Das Korpus besteht aus narrativen Interviews mit deutschsprachigen Israelis, die in den 1930er Jahren aus rassistischen und politischen Gründen zur Emigration gezwungen wurden. Ziel der Untersuchung ist es, ein Bild von den Spracheinstellungen dieser Sprechenden sowie von dem Zusammenhang zwischen Migrationsprozessen und herrschenden Sprachideologien zu gewinnen.
Der Aufsatz ist wie folgt aufgebaut: Zunächst werden (Abschnitt 2) das Untersuchungskorpus dargestellt und zentrale Schlüsselbegriffe wie Sprachbiographie, Sprachrepertoire, Spracherleben, Positionierung und Sprachideologie eingeführt. In Abschnitt 3 wird erst die Verschränkung von dominanten Sprachideologien und Hierarchisierungsprozessen im deutschsprachigen Raum sowie deren Rolle für die Etablierung des monolingualen Habitus geschildert, um dann auf dieser Grundlage die Position des Jiddischen zu skizzieren. Abschnitt 4 ist der qualitativen Analyse einiger Ausschnitte aus dem Untersuchungskorpus gewidmet, aus denen unterschiedliche Spracheinstellungen hervorgehen: Zuerst wird auf Textbeispiele eingegangen (Abschnitt 4.1) , bei denen der monolinguale Habitus der Sprecher besonders verfestigt erscheint, was einer nahezu vollständigen Verdrängung des Jiddischen aus deren erinnerten Sprachrepertoire entspricht. In Abschnitt 4.2 werden hingegen Aussagen von Sprechenden vorgestellt, die bereits in ihrer Kindheit Mehrsprachigkeit erlebt und gelebt haben, was mit einer positiven Einstellung dem Jiddischen gegenüber einhergeht. Abschnitt 4.3. setzt sich mit Textbeispielen auseinander, die das Wechselspiel von Migrationserfahrungen und Spracheinstellungen zum Ausdruck bringen. Der Beitrag schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse und zu einer Skizze der Forschungsperspektive ab (Abschnitt 5).
Die Studie verfolgt einen qualitativen Ansatz1 und verwendet das Instrumentarium der Erzählanalyse.
2. Das Korpus – Sprache, Spracherleben und Positionierung
Das sogenannte Israelkorpus (s. Betten mehrmals, z.B. Betten 2013; Betten, Flinz & Leonardi 2023; vgl. auch das ausführliche Interview mit Anne Betten, Betten 2023) stellt sich aus drei Korpora zusammen: Das Kernkorpus IS Emigrantendeutsch in Israel wurde von Anne Betten und Mitarbeiterinnen zwischen 1989 und 2019 gesammelt und besteht aus 188 Interviews; das Korpus ISW Emigrantendeutsch in Israel. Wiener in Jerusalem (1998-2011) umfasst insgesamt 28 Interviews, die meistens 1998 von den Teilnehmer*innen einer Exkursion der Salzburger Germanistik aufgenommen wurden – die Interviewten waren im Wesentlichen ehemalige Wiener*innen; schließlich ein Korpus mit der zweiten Generation, ISZ Zweite Generation deutschsprachiger Migranten in Israel (1999–2019, 100 Aufnahmen). Die Analysen in dieser Studie erfolgen auf der Grundlage von Interviews aus den Korpora IS und ISW, d.h. mit der ersten Generation deutschsprachiger Migrant*innen in Palästina/Israel. Die drei Korpora sind im ‚Archiv für gesprochenes Deutsch‘ (AGD) des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache (IDS) in Mannheim angesiedelt und über die ‚Datenbank für gesprochenes Deutsch‘ (DGD) öffentlich zugänglich.
Die deutsche Sprachwissenschaftlerin Anne Betten entwarf das Projekt ursprünglich, um der Hypothese über die Bewahrung des Deutschen bzw. einer bestimmten Varietät des Deutschen, dem Bildungsbürgerdeutsch, bei überwiegend in den 1930er Jahren aus deutschsprachigen Gebieten eingewanderten Israelis nachzugehen. Gerade wegen der Fokussierung auf die Sprachproblematik und auf die Rolle der deutschen Sprache sowie anderer im Laufe der Lebensgeschichte erlernter Sprachen im Identitätsprozess können die narrativen Interviews im Korpus auch als Sprachbiographien betrachtet werden (Betten 2010).
In ihren Studien zu Sprachbiographien übernimmt Brigitta Busch (Busch 2017) das bereits von John Gumperz (Gumperz 1964) ausgearbeitete Konzept des „Sprachrepertoires“; im Gegensatz zu den bisherigen strengen soziolinguistischen Kategorisierungen wird das Sprachrepertoire, d.h. die verschiedenen Varietäten, die den Sprechenden zur Verfügung stehen, als offenes System verstanden, als Positionierungsakte der Sprechenden in der Interaktion (König 2014), die je nach Situation variieren.
Unter Positionierung versteht man die diskursive Konstruktion des Selbst (positioning), wie sie zunächst von Davies & Harré (1990) und Harré & Lagenhove (1999) herausgearbeitet wurde; letztere ziehen auch die Unterscheidung zwischen Selbst- und Fremdpositionierung. Bamberg (z.B. 1997), der drei Ebenen der Positionierung unterscheidet, hat dann dazu beigetragen, das Konzept für die Erzählanalyse zu verfeinern: Die erste Ebene betrifft die Art und Weise, wie die Erzähler*innen die Figuren auf der Erzählebene zueinander positionieren, die zweite die Positionierung der Erzähler*innen in Bezug auf die Zuhörer*innen und die dritte die Positionierung der Erzähler*innen in Bezug auf sich selbst, d.h. die Selbstkonstruktion im Kontext dominanter Diskurse („with regard to dominant discourses or master narratives“, Bamberg & Georgakopoulou 2008). Diese ausgesprochen dialogische Sichtweise der Positionierung ist in der Erzähl- und Konversationsanalyse besonders nützlich, weil sie, wie Deppermann (2013: 9) anmerkt, auf die „double temporal indexicality of narratives, which includes both representation and action, and its biographical, individual dimension“ verweist.
In den letzten Jahrzehnten haben Busch und weitere Soziolinguist*innen (z.B. Jan Blommaert, 2008) zudem hervorgehoben, wie das sprachliche Repertoire einer Person nicht nur eine diatopische, mit dem Herkunftsort zusammenhängende Dimension besitzt, sondern sich auch diachron verändert, denn es hängt von der Lebensgeschichte der Sprechenden und ihren Erfahrungen ab. Außerdem sollte das Repertoire nicht nationalen Grenzen und somit nationalen Sprachen entsprechen; vielmehr sollten auch die verschiedenen diatopischen Varietäten eines Gebiets sowie mögliche Minderheitensprachen, einschließlich solcher, die mit Migrationsphänomenen in Verbindung stehen, miteingeschlossen werden. Ein weiteres zu berücksichtigendes Element ist schließlich das „Spracherleben“, d.h. wie unser Sprachgebrauch mit Erfahrungen und daher Emotionen verwoben ist, die sowohl damit zusammenhängen, wie sich Menschen in Interaktionen als sprechende Subjekte selbst wahrnehmen, als auch damit, wie sie von anderen wahrgenommen werden – oder sich wahrgenommen fühlen (vgl. Busch 2017: 20–22): Brigitta Busch fasst wie folgt zusammen: „Zugespitzt formuliert geht es darum, das sprechende und erlebende Subjekt in die Sprachwissenschaft zurückzuholen“ (Busch 2017: 21).
Diese Annahmen beruhen auf einer Konzeption von Sprache als grundlegendem Element nicht nur für die Identitätskonstruktion des Individuums, sondern auch für die Teilnahme an der symbolischen Kommunikation einer Gemeinschaft, an der Dynamik der Übernahme sozialer Rollen und für die Selbstdarstellung (Mead 1934). Dabei geht es weder um eine einzelne Varietät oder Sprache noch um das sprechende Subjekt, sondern um das „Spracherleben“ (s. Busch mehrmals, z.B. 2010: 58):
Mit dem Begriff Spracherleben umreißen wir einen Ansatz, der danach fragt, wie Menschen in mehrsprachigen Lebenszusammenhängen ihre Sprachlichkeit wahrnehmen und bewerten und welche Erfahrungen, Gefühle oder Vorstellungen sie damit verbinden. […] Gefragt wird nach dem Bezug des Spracherlebens zur individuellen Lebensgeschichte einerseits, zu historisch-gesellschaftlichen Konfigurationen mit ihren Zwängen, Machtgefügen, Diskursformationen und Sprachideologien andererseits.
Sprachideologien umfassen auch die Verflechtungen zwischen sprachlichen Formen sowie Routinen und Identität (sowohl individuell als auch kollektiv) einerseits und zwischen soziokulturellen Beziehungen andererseits, also auch Positionierungsakte (Jaffe 2020). Dies ergibt sich daraus, dass Sprachideologien „a mediating link between social forms and forms of talk“ (Woolard 1998) darstellen.
Die von Sprecher*innen entwickelten Einstellungen zu Sprachen und Varietäten hängen von den Sprachideologien ab, die in diskursiven Praktiken über Sprache, ‚richtigen‘ Sprachgebrauch und prestigereiche bzw. stigmatisierte Varietäten vermittelt werden.
3. Jiddisch und der monolinguale Habitus im deutschsprachigen Raum
Dominante Sprachideologien tragen wesentlich zu Hierarchisierungsprozessen unter Sprachen bei. Die Etablierung einer Standardsprache geht mit einem Vertikalisierungsprozess einher, in dem sich bestimmte Varietäten – u.a. im Rahmen von Ausgleichsverfahren – als Leitvarietäten entwickeln, während weiteren diatopischen bzw. diastratischen Varietäten eine deutlich nachrangige Rolle beigemessen wird (Blommaert 2008). In der Entwicklung zur deutschen Standardsprache betraf dieser sich seit der frühen Neuzeit abspielende Prozess nicht nur diatopische Varietäten, d.h. Ortsdialekte und regionale Sprachen wie Niederdeutsch und Friesisch, sondern auch diastratische, sprachgemeinschaftsspezifische Sprachen, wie die von den westlichen aschkenasischen Juden und Jüdinnen gesprochene Varietät, die unter dem Namen Westjiddisch, Jüdischdeutsch oder auch Judendeutsch2 bekannt ist (s. Fleischer 2018: 239; Mende 2022: 115).
Solche Vertikalisierungsprozesse stehen mit einer allgemeineren Hierarchisierung von Sprachen in Zusammenhang, in deren Rahmen z.B. einer Mehrheitssprache ein höherer Wert als einer Minderheitensprache, einer Landessprache ein höherer Wert als einem Ortsdialekt oder einer nicht-territorialen Varietät (wie z. B. Jiddisch) zugeschrieben wird. Ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts vermehren sich im deutschsprachigen Gebiet auf der einen Seite kritische Stellungsnahmen gegen die Mehrsprachigkeit, auf der anderen Forderungen nach Sprachreinheit (Polenz 1994: 72; Polenz 1999: 109; vgl. neuerdings auch Mende 2022).
In Hinblick auf die vorherrschenden Sprachideologien unter den Sprechenden aus dem Israelkorpus stellt Betten fest, dass die Interviewten oft betonten, „wieviel Wert in ihren Elternhäusern auf ein ‚gutes Deutsch‘ gelegt wurde – auch (und gerade) der große Teil derer, deren Eltern aus Osteuropa nach Deutschland oder Österreich zugewandert waren“ (Betten 2000). Dies bringt mit sich eine ausdrückliche Stigmatisierung von Varietäten, die vom Standard abweichen – wie Dialekt –, aber auch vom Jiddischen.
Das (West)Jiddisch wurde in Deutschland und in Österreich im Zuge der Emanzipation und der kulturellen Assimilation an die nichtjüdische Gesellschaft v.a. zugunsten standardnahem Bildungsbürgerdeutsch aufgegeben, denn „[d]as damals stark bildungssprachlich standardisierte Deutsch erschien als das wirksamste Mittel der Emanzipation und gesellschaftlichen Integration“ (Polenz 1994; Mende 2022). In diesem Rahmen ist auch Moses Mendelssohns Pentateuch- und Psalmenübersetzung (1783) ins Deutsche – wenn auch noch in hebräischer Schrift – zu verstehen. Die Einstellung zur ursprünglichen gemeinschaftsspezifischen Varietät wurde zunehmend kritisch, wie die Bezeichnungen für das (West)Jiddisch zeigen: Seit dem späten 18. Jahrhundert benutzten v.a. bedeutende jüdische Persönlichkeiten, die die Assimilation vorantrieben, den aus dem Französischen stammenden Jargon als abwertende Bezeichnung. Ebenso abwertend wurden die Verben jüdeln und mauscheln (< Mauschel, Koseform zu Mausche, aschkenasischer Form für Moses) verwendet, wie die entsprechenden Einträge in Daniels Sanders (selbst Jude) Wörterbuch der deutschen Sprache (Sanders 1860-1865) zeigen:
(1a)
jüdeln, intr. (haben): die Weise eines Juden haben oder zeigen […] auch: wuchern […]; jüdisch markten und feilschen, knausern etc. […]; wie ein Jude sprechen: Dieser Schauspieler jüdelt vorzüglich etc.; Mundart. wie ein Jude riechen (Sanders 1860: s.v.)
(1b)
Mauscheln, intr. (haben): wie ein Mauschel sprechen, jüdeln (s.d.): Was wir in Norddeutschland m. nennen, ist Nichts anders als die eigentliche Frankfurter Landessprache und sie wird von der unbeschnittenen Population ebenso vortrefflich gesprochen wie von den beschnittenen. Heine Börn [sic] (Sanders 1860: s.v.).
Neben den eindeutig negativen Konnotationen ist ferner der unter mauscheln angeführte Beleg (vgl. 1b) aus Heinrich Heines Über Ludwig Börne interessant, denn hier zeigt sich die Verschränkung der diastratische mit der diatopischen Dimension.
Die o.g. Vertikalisierungsprozesse gehen im Lauf der nationalistisch geprägten Sprach- und Kulturpolitik des 19. Jahrhunderts eindeutig mit der Etablierung des von Ingrid Gogolin (1994) eingangs behandelten „monolingualen Habitus“ an deutschen Schulen einher; dabei bezieht sie sich auf Pierre Bourdieus Begriff des Habitus als „Erzeugungsmodus von Praxisformen“ (Bourdieu 1979: 164). Diese „Monolingualisierung des Schulwesens“ (Gogolin 1994: 37) entspricht einem monodimensionalen Verständnis von Sprache und Kultur, die wiederum als eine Einheit aufgefasst werden. Gogolin präzisiert den chronologischen und gesellschaftlichen Rahmen wie folgt: „Der Anfang liegt in der Zeit der Konstituierung des bürgerlichen deutschen Nationalstaats, also in jenem Abschnitt der Geschichte, in dem Kultur zur Nationalkultur umgeprägt und das Deutsche zur Muttersprache der Deutschen erhoben wurde“ (Gogolin 1994: 41).
Solche monolingualen Sprachideologien haben sich im 19. Jahrhundert allgemein in den westlichen Gesellschaften so stark durchgesetzt, dass der monolinguale Habitus immer noch als Normalfall gilt (Busch 2017: 41; 158). Obwohl nicht wenige Sprechende aus den Israelkorpora einen Migrationshintergrund aus Osteuropa hatten (s.o. Kap. 2, ferner Du-nour 2000; Pellegrino 2023 und in diesem Band), sind die meisten in Deutschland und in Österreich zu einer Zeit aufgewachsen, in der die Ideologie der (künstlichen) sprachlich-ideologischen Vereinheitlichung und des entsprechenden monolingualen Habitus besonders ausgeprägt waren.
Westjiddisch war zu ihren Zeiten als lebendige Varietät längst untergegangen (s.o.) – dennoch wurden sie aber mit dem (Ost)jiddischen konfrontiert, da ab dem Ende des 19. Jahrhunderts – begünstigt durch den Ausbau des Eisenbahnnetztes – eine große Migrationswelle aus den östlichen Gebieten nach Deutschland und Österreich strömte, die auch eine starke jüdische Komponente besaß (vgl. Leonardi im Druck). Ferner wurde die jüdische Migration Richtung Westen durch die zahlreichen Pogrome im Osten vorangetrieben3: Ende 1920 gab es in Berlin, das damals ungefähr vier Millionen Einwohner*innen zählte, 137.000 Juden, von denen 13.000 aus dem ehemaligen russischen und österreichisch-ungarischen Reich sowie aus Rumänien stammten; 1925 waren ein Viertel der mehr als 172.000 Berliner Juden Einwanderer*innen (Estraikh & Krutikov 2010: 5). Die während des Ersten Weltkriegs angerichteten Verwüstungen und Zerstörungen in Galizien – damals Teil der Habsburgermonarchie – verursachten massive Einwanderungswellen nach Wien und Budapest (Brinkmann 2010: 28).
Die Habsburgermonarchie gilt zwar als multiethnisch und mehrsprachig, jedoch konnte man bei den Volkszählungen, die ab 1869/70 bis 1910 etwa alle zehn Jahre durchgeführt wurden, eine einzige Umgangssprache in den cisleithanischen Ländern4 bzw. Muttersprache (im Königreich Ungarn) angeben (Wolf 2012: 68–69)5. Darüber hinaus durften solche Umgangssprachen lediglich aus einer Liste behördlich festgelegter landesüblicher Sprachen gewählt werden. Darunter war Jiddisch nicht vorgesehen, was wohl dem Jiddischen ein Stigma zugesetzt hat. Das geschah auch, weil Juden und Jüdinnen – im Gegensatz zum Zensus im Russischen Reich und später in der Sowjetunion – nicht als eigene ‚Nationalität‘ angesehen wurden (Wolf 2012: 70). Jiddisch wurde in diesem Rahmen meist als Dialekt des Deutschen behandelt, aber Galizien wurde nach dem Ersten Weltkrieg Polen zugesprochen, weil 1910 eine Million (v.a. Jiddisch sprechende) Juden Polnisch (und nicht Deutsch) als ihre Umgangssprache angegeben hatte (Spolsky 2014: 207).
4. Einstellungen zum Jiddischen im sog. Israelkorpus
In diesem Abschnitt werden Textstellen aus den Israelkorpora6 analysiert, aus denen unterschiedliche Einstellungen zum Jiddischen und zur Mehrsprachigkeit hervorgehen.
4.1. Monolingualer Habitus und Migrationsspuren
Im Folgenden wird auf Textbeispiele fokussiert, in denen der monolinguale Habitus besonders zum Ausdruck kommt. Schon am Anfang seines Interviews mit Anne Betten betont Josef Walk, langjähriger Direktor des Leo Baeck-Instituts in Jerusalem, seine Zugehörigkeit zum deutschen Kulturkreis, indem er zum einen darauf hinweist, dass er den Familiennamen nicht hebraisiert hat (dazu s. Leonardi 2022), zum anderen hebt er die ‚Reinheit‘ des Deutschen in seiner Geburtsstadt Breslau hervor: „Äh wir Breslauer waren immer sehr stolz darauf, dass außer Hannover, wir das reinste Deutsch sprechen“7. Er fährt dann wie folgt fort:
(2) Interview Anne Betten mit Josef Walk (JW) (*1914 in Breslau, Emigration 1936), Jerusalem, 16.4.1991 (IS_E_00135, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C403-8ACB-AC01-A, 1 min 37 s – 2 min 59 s)
001 JW: meine familie väterlicherseits stammt aus litauen (.)
002 aber hier eine interessante tatsache die zu der frage
003 (.) der: äh einstellung der juden (.) zur deutschen
004 sprache beziehungsweise zum problem °h des sogenannten
005 deutschen kulturkreises gehört (.) °h mein großvater ist
006 in wilna geboren (.) seinerzeit in russland (-)
007 allerdings war er schon (.) naturalisiert (.) bis heute
008 ist mir ein rätsel wie er das fertig gebracht hat °h
009 jedenfalls (-) mein vater (.) der: ebenfalls in einer
010 kleinen äh litauischen stadt geboren ist nicht weit der
011 (-) grenze (.) wurde schon als preußischer staatsbürger
012 geboren (–) nun (.) mein großvater konnte natürlich
013 russisch (-) er konnte sogar hebräisch (–) soweit man
014 damals (.) hebräisch äh sprechen konnte (.)
015 beziehungsweise schreiben konnte °h er war ein
016 aufgeklärter (-) aber (.) seine liebesbriefe an meine
017 großmutter schrieb er in deutschen (.) klassischen (.)
018 äh: im klassischen deutsch eines schiller und goethe (.)
019 ich besaß diese briefe °h und äh ich glaube dass das
020 kein zufall ist (.) ich habe (.) weder von ihm (.) noch
021 von meinem vater (.) zum beispiel jemals ein jiddisches
022 wort gehört (.) und obwohl ich in breslau wohnte und es
023 süddeutsche gab (.) die glaubten, dass breslau an der
024 polnischen grenze liegt (.) was mich immer beleidigt hat
025 °h habe ich kein wort jiddisch bis zum sechzehnten
026 lebensjahr verstanden.
In Walks Rekonstruktion seiner Familiengeschichte besteht die Erzählwürdigkeit (Lucius-Hoene & Deppermann 2004: 23 u. passim) dieses genealogischen Exkurses darin, dass er hierdurch seine Zugehörigkeit zur deutschen klassischen Kultur untermauert: Der Großvater sei zwar noch im Russischen Reich, in Wilna, geboren (Z. 006), er sei mehrsprachig (Z. 012–013), aber die Liebesbriefe habe er auf Deutsch geschrieben, „im klassischen Deutsch eines Schiller und Goethe“ (Z. 016–018). Als Coda zu dieser Episode ergänzt er, dass er seinen Großvater wie auch seinen Vater nie jiddisch habe sprechen hören (Z. 021–023). Dabei stellt er explizit einen kausalen Zusammenhang („ich glaube, dass das kein Zufall ist“, Z. 019) zwischen der Verdrängung des Jiddischen – die er nicht als eine solche erkennt – und der Nähe zur klassischen deutschen Kultur her. Abschließend fügt er seine eigene Erfahrung mit dem Jiddischen hinzu, und zwar, dass er erst mit 16 Jahren Jiddisch vernommen habe (Z. 025–026). Dies mag einem idealisierten Bild von Breslau entsprechen, denn der 1897 in Breslau geborene und aufgewachsene Soziologe Norbert Elias weist in einem Interview mit Arend-Jan Heerma van Voss und Bram van Stolk auf „Einwanderer aus dem Osten, die Jiddisch sprachen“ hin (Elias 1996: 20)8. Obwohl in Breslau im Vergleich zu den anderen größeren jüdischen Gemeinden in Deutschland der Anteil an ausländischen Juden gering war, hatten laut Volkszählung 1910 immerhin 7,2% der Breslauer Juden keine deutsche Staatsangehörigkeit (Rahden 2000: 269)9; diese Gruppe, auf die sich Norbert Elias bezogen haben muss, ist aus den Kindheitserinnerungen von Josef Walk keineswegs präsent.
Eine ähnliche Abwesenheit vom Jiddischen aus den Kindheitserinnerungen ist bei Josef Stern zu verzeichnen. Stern kommt dazu, auch von seiner (nicht) erlebten Erfahrung mit dem Jiddischen zu sprechen, als er Anne Betten von seiner Akkulturation in Palästina erzählt. Er wanderte im Alter von 15 Jahren, allein ein, dank der Organisation Jugendalijah, die jüdische Jugendliche bei ihrer Emigration nach Palästina unterstützte (s. Michaelis-Stern 1985). Er berichtet, dass er die Sprache schnell lernte, obwohl seine ‚jeckische‘ Aussprache des Hebräischen im Kibbuz, in den er kam, verspottet wurde. Es handelte sich nämlich um einen religiösen Kibbuz, der von Einwander*innen „aus Deutschland gegründet wurde, von denen ein großer Teil Ostjuden waren“10. Anschließend fragt Anne Betten, ob er „in Gießen, in Hessen schon Erfahrungen mit Ostjuden gemacht“ hätte (39 min 15 s). Stern verneint das und präzisiert dann seine Verhältnisse zu den ‚Ostjuden‘:
(3) Interview Anne Betten mit Josef Stern (JS) (*1921 in Gießen als Helmut Stern, Emigration 1936), Haifa, 2.5.1991 (IS_E_00124, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C3FB-6E6B-9401-E, 39 min 19 s – 39 min 38 s)
001 JS: ich habe nicht gewusst dass ein (-) gewisser teil (.)
002 ein kleiner teil °h von den äh ((räuspert sich)) leuten
003 der jüdischen gemeinde ostjuden waren (.) mein eigner
004 großvater (-) mütterlicherseits °h war einmal ein
005 flüchtling aus (.) russland (-) ich habe nie ein wort
006 jiddisch gehört (.) ich wusste gar nicht was das is
Stern teilt mit Walk nicht nur den osteuropäischen Migrationshintergrund eines Familienteils (Z. 003–004), sondern auch die nicht vorhandene Wahrnehmung des Jiddischen in der Kindheit, die er schließlich als fehlende Begrifflichkeit rekonstruiert (Z. 006)11.
4.2. Randgebiete und erlebte Mehrsprachigkeit
Facettenreichere Einstellungen zum Jiddischen und zur Mehrsprachigkeit im Allgemeinen scheinen Sprechende entwickelt zu haben, die in ihrer Kindheit oder Jugend in Gebieten lebten, in denen kein monolingualer Habitus vorherrschte (zum Israelkorpus s. Pellegrino 2023). Herbert Rosenkranz gehört zu den wenigen Interviewten aus dem Israelkorpus, die erst nach dem Krieg emigrierten: Selbst in Wien von aus Galizien stammenden Eltern 1924 geboren, wanderte er mit seiner Familie nach dem ‚Anschluss‘ nach Riga als Scheintourist aus. Nachdem er und seine Familie als ‚Deutsche‘ („für Hitler waren wir Juden, fürs Ausland waren wir Deutsche“) von 1941 bis 1947 in sowjetischer Gefangenschaft blieben, kehrte er erst 1947 nach Wien zurück. Nach dem Studium der Anglistik und der Geschichte in Wien emigrierte er 1953 nach Israel. Ganz am Anfang12 seines Interviews schildert er die Herkunft seiner Familie aus Osteuropa; zunächst erzählt er von der Mutter, wobei er seine eigene Sprachbiographie mit der ihrigen verschränkt:
(4) Interview Maria Dorninger und Hannes Scheutz mit Herbert Rosenkranz (HR) (*1924 in Wien, Emigration nach Israel 1953), Jerusalem, 3.2.1998 (ISW-_E_00023, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C439-381C-6401-4) 28 s 2 min 09.
001 HR: kolomäa (-) das ist in (.) ostgalizien (3.0) und äh
002 (3.0) und im_meinen im haus meiner eltern (-) war es
003 verpönt (3.0) dialekt zu sprechen (4.0) nach meiner
004 einreise hier (–) hat man plötzlich entdeckt (2.0) dass
005 ich gut dialekt kann (–) zum beispiel nestroy (2.0)
006 aber äh (–) im haus wurde nicht dialekt geduldet (3.0)
007 meine mutter (3.0) wuchs bis zum sechsten lebensjahr mit
008 jiddisch auf (–) denn das war die sprache der juden (-)
009 die die hälfte der stadtbevölkerung betrugen (-) in
010 kolomäa (2.0) aber mit sechs jahren lernte sie in der
011 schule (.) polnisch (2.0) nachher (.) deutsch (-) und
012 sie war die vorzugsschülerin (2.0) äh und äh als sie
013 nach wien kam °hh hat sie äh einen sprachlehrer genommen
014 (–) um deutsche äh dramen zu lesen und mit ihm ins
015 theater zu gehen.
In diesem Abschnitt weist Rosenkranz einerseits auf den Topos der Sprachreinheit sowohl in Bezug auf sein Elternhaus (Z. 002 und 006) als auch auf das seiner Eltern (Z. 002) hin, andererseits unterstreicht er die Vielsprachigkeit der Mutter (Z. 007–012), deren Muttersprache Jiddisch war (Z. 007). Durch die adversative Konjunktion aber (Z. 010) deutet er jedoch an, dass die jiddische Einsprachigkeit der Mutter nur vorübergehend war, denn bald kamen auch Polnisch und Deutsch (Z. 011) hinzu. Das weitere Detail, das sie eine Vorzugsschülerin (Z. 012) war, lässt durchblicken, dass die Mutter auch im Deutschen erfolgreich war. Diesen Punkt entwickelt er weiter, indem er vom Interesse der Mutter für die deutsche Literatur (Z. 014) und für das Theater (Z. 015) berichtet, weswegen sie sich in Wien sogar einen speziellen Sprachlehrer (Z. 013) anschaffte. Die Rolle der Literatur in der Rekonstruktion der sprachbiographischen Entwicklung hatte er bereits im Zusammenhang mit seiner Dialektkompetenz (Z. 005) erwähnt: Obwohl seine Eltern auf der Stigmatisierung des Dialekts (Z. 006) bestehen, beherrschte er auch den Dialekt (Z. 005), was er mit seiner Lektüre von Nestroy (Z. 005) in Zusammenhang bringt – dadurch erfährt die Dialektkompetenz eine Aufwertung. Unmittelbar daran schließt Rosenkranz einen Bericht zur Herkunft seines Vaters an:
(5) Interview Herbert Rosenkranz (HR), 2 min 9 s–2 min 57 s
001 HR: mein vater (.) kam neunzehundertsiebzehn aus
002 zentralpolen (.) aus h° radom (–) nach wien (–) weil
003 er erstens (.) nicht ins cheder gehen wollte (-) sie
004 wissen(.) was das ist (.) ja (.) zweitens nicht in der
005 russischen ar armee dienen wollte (–) er wollte nach
006 (-) palästina (-) aber (.) es reichten nicht die mittel
007 (-) und äh so äh blieben sie in wien (–) mein vater äh
008 liebte das jüdische theater (–)
Rosenkranz positioniert den jungen Vater klar als zionistisch eingestellt (Z. 005–006), zudem als jemand, der sich einerseits gegen die alttradierten (ost)jüdischen Bräuche sträubt – hier metonymisch durch das Cheder, die traditionelle jüdische Schule für Jungen (Z. 003) dargestellt, andererseits wollte er der Assimilierung in die russische Gesellschaft durch den Wehrdienst entgehen (Z. 005). Sein ‚dritter Weg‘ wäre das zionistische Palästina gewesen, aber aus Geldmangel blieb er in Wien. Seine zionistische Einstellung zeigte sich auch in seiner Liebe für „das jüdische Theater“ (Z. 008) (wobei jüdische höchstwahrscheinlich eine Hyperkorrektur für Jiddisch ist13 – die Entrundung des im deutschen Standard umgelauteten Vokals gehört zu den Divergenzmerkmalen des Jiddisch, s. Kiefer 2004: 3263).
Die Erwähnung des jüdischen Theaters in (5) ist für Rosenkranz Anlass, die beiden Hauptkomponente seiner Erziehung zu betonen:
(6) Interview Herbert Rosenkranz, 2 min 58 s–7 min 48 s
001 HR: und so wuchs ich auf mit (3.0) deutscher klassik (–)
002 und mit äh jiddischen (-) liedern (3.0) mit meiner (-)
003 großmutter (-) sprach ich jiddisch (3.0) achtunddreißig
004 (3.0) erlebten wir den anschluss ((40 s Auslassung: wie
005 er und Familie den ‚Anschluss‘ erlebten)) anfangs äh
006 oktober [1938] em emigrierten wir (–) nach riga (—)
007 als äh scheintouristen ((2 min 59 s Auslassung:
008 Reise nach Riga)) und äh (–) habe ein wunderbares
009 judentum kennen gelernt (–) das viel vielsprachig war
010 und offenes herz (–) und (3.0) ein judentum wie ich es
011 als mensch sonstwo nicht erlebt habe.
Rosenkranz scheint hier die Komponente der jiddischen Lieder (Z. 002) gleichrangig mit der der deutschen Klassik (Z. 001) für seinen Bildungsprozess zu bewerten. Daraufhin präzisiert er (vgl. dazu aber auch Bsp. 7), dass er Jiddisch mit seiner Großmutter sprach (Z. 003). Zeitgleich muss er seine Lebensgeschichte und die dazugehörende Chronologie innerlich zurückverfolgen, denn unmittelbar danach erwähnt er den ‚Anschluss‘ (Z. 005), der für ihn und die ganze Familie selbstverständlich ein tiefer Einschnitt bedeutete. Der ‚Anschluss‘ ist der Grund für die Auswanderung nach Riga. Diesbezüglich ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass Rosenkranz an dieser Stelle erneut die Sprachenfrage wieder fokussiert, denn mit Riga verbindet er ein „wunderbares Judentum“ (Z. 008–009), dessen positive Merkmale er exemplarisch durch die Eigenschaften der Mehrsprachigkeit14 (Z. 009) und Offenherzigkeit (Z. 010) ausdrückt.
Die Aussage unter (6), nach der Rosenkranz Jiddisch mit seiner Großmutter gesprochen habe, wird allerdings an einer späteren Stelle relativiert. Nachdem Rosenkranz die soziale und kulturelle Zugehörigkeit seiner Familie zum Ostjudentum und zum Zionismus betont hat, fragt Hannes Scheutz ausdrücklich nach der Verwendung des Jiddischen im Elternhaus. In seiner Antwort bezieht sich Rosenkranz auf die Zeit in Wien, denn die Großeltern (mütterlicherseits) wanderten nicht nach Riga aus – wie er an anderer Stelle erzählt (32 min 25 s), starb der Großvater 1942 an einem „Magenleiden“, während die Großmutter nach Theresienstadt deportiert und in Auschwitz ermordet wurde:
(7) Interview Herbert Rosenkranz, 50 min 24 s–50 min 47 s
001 HS: haben sie in ihrem elternhaus (-) jiddisch gesprochen?
002 HR: meine großmutter konnte nur jiddisch,
003 HS: mhm-
004 HR: meine großeltern;
005 HS: aha (3.0) haben sie mit ihren eltern auch jiddisch
006 gesprochen?
007 HR: nie.
008 HS: immer deutsch?
009 HR: deutsch (–)
010 HS: aha
011 HR: ich habe auch mit der großmutter nicht jiddisch
012 gesprochen.
013 HS: ah ja (–) aber sie mit ihr/ sie mit ihnen–
014 HR: ja.
In dieser Passage, die explizit auf den Sprachgebrauch fokussiert, lässt Rosenkranz weniger Raum für Mehrsprachigkeit als im Bsp. (6): Jiddisch scheint hier eine Notlösung zu sein, die lediglich durch die begrenzte Sprachkompetenz der Großmutter („meine Großmutter konnte nur Jiddisch“, Z. 002) bedingt war. Zudem verneint er, jemals Deutsch mit den Eltern gesprochen zu haben („nie“, Z. 007; s.a. Z. 008–009). Er präzisiert außerdem, dass er selbst „mit der Großmutter nicht Jiddisch gesprochen“ habe (Z. 011), sondern nur sie mit ihm (Z. 013–014).
An weiteren Stellen im Interview kommt Rosenkranz dazu, von seiner Verbundenheit mit ostjüdischen Traditionen zu sprechen. Er weist ferner darauf hin, dass er jiddische Lieder von der Mutter gelernt und dass er diese bei der B’nai B’rith-Loge, einer jüdischen Organisation, vorgetragen habe. In der Folge bejaht er eine Aussage Maria Dorningers, dass er diese Lieder an die Töchter weitergegeben habe; daraufhin fragt ihn Hannes Scheutz, ob er bereit wäre, ein Lied zu singen. Nach einem anfänglichen Zögern singt er tatsächlich das Lied Undzer shtetl brent!15 (2 h 25 min 11 s–2 h 27 min 24 s). Abschließend fasst er die verschiedenen Komponenten seiner Identität wie folgt zusammen:
(8) Interview Herbert Rosenkranz (HR), 2 h 34 min 12 s–2 h 34 min 15 s
001 HR: wenn man mich fragt (.) woher ich bin (.) so antworte
002 ich (-) ich bin wohl in wien geboren (–) aber sämtliche
003 jeckischen eigenschaften (-) falls mir solche eignen
004 sollten (.) habe ich von meiner mutter (.) aus galizien
005 geerbt.
In dieser bewusst paradoxen Äußerung nimmt Rosenkranz nicht nur das bereits am Anfang des Interviews (s. Bsp. 6, Z. 1–2) dargestellte Motiv des doppelten – deutschen und ostjüdischen – kulturellen Erbes wieder auf, sondern er verkörpert die beiden Komponenten in einem Oxymoron in der Person seiner aus Galizien stammenden Mutter, aus der er diese wiederum direkt ableitet.
Die sprachliche Vielfalt lettischer Gebiete zeigt sich auch im folgenden Passus, in dem die in Kurland – damals Russischem Reich, heute Lettland – geborene und aufgewachsene Paula Pesche Bernstein über die sprachbiographische Situation ihrer Kindheit berichtet:
(9) Interview Kristine Hecker mit Paula Pesche Bernstein (PS) (*1895 als Paula Lipschitz in Windau, Kurland, Russisches Reich – heute Lettland; 1929 Emigration in die USA, 1973 nach Israel), Kidron, 30.9.1989 (IS_E_00014, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C3AF-41FA-AB01-9) 11 min 27 s– 11 min 34s.
001 PB: bis neun bin ich in privatunterricht gewesen (.) ich
002 habe le gelernt lesen und schreiben (.) deutsch als
003 erstes und äh russisch nach neun
004 KH: ja
005 PS: nachdem ich neun war
006 KH: ja (.) und zuhause ham sie doch alle deutsch gesprochn
007 (.) nur deutsch (.) ja?
008 PB: i wouldnt say nur deutsch (.) nein (.) wir habn auch
009 jiddisch gesprochn (-) und wir hattn ein dienstmädchn
010 mit der ham wir lettisch gesprochn
011 KH: ja
012 PB: also wir kinder sind wirklich mit drei sprachn groß
013 gewordn jiddisch (.) lettisch (.) und deutsch.
014 KH: und das russisch spielte zunächst keinerlei rolle?
015 PB: russisch nur nachdem ich auf die schule kam;
016 KH: ja-
017 PB: ich kam auf die schule war ich schon zehn jahre alt,
018 KH: und mit den geschwistern (.) welche sprache ham sie mit
019 den geschwistern gesprochn?
020 PB: jiddisch (.) deutsch (.) lettisch (–) verschiedn.
Paula Bernstein wurde 1895 geboren – sie erzählt also von einer viel früheren soziolinguistischen Situation in Lettland, das in ihrer Kindheit noch zum Russischen Reich gehörte – aber ihre erste Schulsprache war Deutsch, während Russisch nach drei Jahren dazukam (Z. 002–003). Die Interviewerin Kristine Hecker geht offenbar vom monolingualen Habitus der meisten Interviewten aus, denn sie stellt die Frage in Z. 006–007, ob zu Hause „alle […] nur Deutsch gesprochn“ hätten, nur rhetorisch und erwartet, dass diese bejaht werde. Paula Bernstein verneint jedoch die Aussage (Z. 008) und bringt an diesem Punkt nicht nur das Jiddische ins Spiel (Z. 009), sondern sie erinnert sich auch, dass sie und ihre Familie mit dem „Dienstmädchen […] lettisch gesprochn“ haben (Z. 009–010). Daraufhin denkt sie über ihr damaliges Sprachrepertoire und das ihrer Geschwister nach und fasst zusammen, dass sie „wirklich mit drei Sprachn“ (Z. 012) aufwuchsen – d.h. Jiddisch, Lettisch und Deutsch. In Z. 020 weist sie ausdrücklich darauf hin, dass in der Kommunikation mit den Geschwistern alle drei Sprachen verwendet wurden. Bemerkenswert ist dabei, dass sie sowohl in Z. 013 als auch in Z. 020 Jiddisch als erste Sprache nennt.
David Sha’ari gehört zur selben Generation wie Rosenkranz, denn er ist nur zwei Jahre jünger als dieser. Er wurde in der Bukowina geboren, die von 1775 bis 1918 zu Österreich-Ungarn gehörte und in der Folge des Zerfalls der Habsburger Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg und der Besetzung durch die rumänischen Truppen schließlich vom Königreich Rumänien annektiert wurde. Wie viele Gebiete im Habsburger Reich (vgl. dazu Wolf 2012; speziell zum Israelkorpus s. Pellegrino 2023) war die Bukowina multiethnisch und vielsprachig: „Landessprachen“16 waren in der Bukowina Deutsch, Rumänisch und Ruthenisch (d.h. Ukrainisch) (Wolf 2012: 114). An der folgenden Stelle schildert David Sha’ari sein Sprachrepertoire (zur Sprachbiographie von David Scha’ri vgl. die Magisterarbeit von Samuela Begaj 2018):
(10) Interview Anne Betten mit David Scha’ari (DS) (*1922 als David Scheuermann in Jakobeni, Bukowina, Rumänien; Emigration nach Palästina 1941), Jerusalem, 29.4.1994 (IS_E_00155, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C412-5DCB-D501-7), 17 min 17 s–18 min 11 s
001 AB: nun sind sie eigentlich äh [spätestens]
002 DS: [wir haben ]
003 AB: ab ihrem sechsten lebensjahr schon mit vier sprachen in
004 kontakt gewesen (.)
005 DS: ja
006 AB: also jiddisch (.) deutsch äh rumänisch und [und
007 hebräisch]
008 DS: [wir
009 haben ] gelesen (—) als jugendliche °h vier fünf 010 sprachen °hh wir haben gelesen in rumänisch (.) wir
011 haben gelesen in deutsch (.) wir haben gelesen in
012 jiddisch °hh wir haben gelesen in in hebräisch (-) °hh
013 auch keine rumän hebräischen schulen waren nicht °hh
014 waren hebräische kurse °h wir haben erlernt hebräisch
015 (-) und ich (.) kannten viele von uns °h wenn ich
016 hergekommen bin (–) ich konnte zeitunglesen (.)
017 AB: ja
018 DS: ich konnte
019 AB: also nicht nur die gebetssprache (.) das war tiefer
020 ver[anlagt].
021 DS:[nein ] nein. das war:: hebräisch (.) modern
022 hebräisch.
Nachdem die Interviewerin Anne Betten in Z. 006–007 auf der Grundlage der gerade erwähnten Stelle (s.u. Bsp. 11) die von Scha’ari beherrschten Sprachen auflistet – Jiddisch, Deutsch, Rumänisch und Hebräisch – präzisiert dieser zum einen, dass er über Lesekompetenzen in allen vier Sprachen verfügt, zum anderen weist er ausdrücklich darauf hin, dass er aufgrund seiner zionistischen Einstellung modernes Hebräisch gelernt hatte. Genau genommen beansprucht er solche Sprachkompetenzen nicht für sich alleine, sondern für ein wir, das möglicherweise auch seine Geschwister und weitere jüdische Freund*innen in seinem Alter miteinschließt (zum Pronominagebrauch im Israelkorpus s. Betten 2007).
Der Sprachwechsel (10) folgt um ein paar Minuten einer Passage, in der Scha’ari ausführlicher insbesondere auf die Dynamiken zwischen Jiddisch und Deutsch im Elternhaus eingeht:
(11) Interview David Scha’ari (DS),13 min 22 s– 14 min 2 s.
001 DS: wir sprachen (—) zu hause °hh sprachen wir jiddisch
002 und deutsch.
003 AB: mhm
004 DS: mit den kindern sprach er ((der Vater)) deutsch (.)
006 wollte dass die kinder/ °hh was interessant (.) wir
007 deutsch gesprochen bis tausendneunhundertvierunddreißig
008 (–) °hh tausendneunhundertvierunddreißig als hitler kam
009 °hh haben wir (.) die kinder (-) revoltiert (-) wir
010 haben verlangt von den eltern (.) dass man zu hause
011 spricht jiddisch.
Gemäß dem monolingualen Habitus verlangt der Vater, dass zu Hause Deutsch – und nicht Jiddisch – gesprochen werde. Jedoch erwähnt hier Scha’ari eine chronologische Marke, die wesentlich zur Sprachsituation in der Familie beisteuerte: 1934, hier pauschal mit Hitler identifiziert, möglicherweise aber auch mit dem Erlass antijüdischer Gesetze in Rumänien verbunden, die ihrerseits durch den stetigen Aufstieg von zwei antisemitischen Organisationen, der „Liga zur national-christlichen Verteidigung“ und der „Eisernen Garde“ (bis 1930 „Legion des Erzengel Michael“) begünstigt wurde (Hausleitner 2008: 298). Solche politischen Ereignisse spiegeln sich in den Spracheinstellungen wider, so dass Deutsch mit den nationalsozialistischen Anschauungen gleichgesetzt wird, während Jiddisch als Widerstand dagegen wirkte.
4.3. Emigration und neue Einstellungen zur Mehrsprachigkeit
Die Migration bedeutet Brüche im Leben, aber auch Veränderungen, die nicht zuletzt die ursprünglichen Spracheinstellungen betreffen können, v.a. wenn die Personen bei der Auswanderung noch jung waren17. Dalia Großmann, die bereits 1933 als vierzehnjährige mit Familie von Berlin nach Palästina auswanderte, skizziert im folgenden Textbeispiel das Sprachrepertoire ihrer „Generation“ (Z. 001):
(12) Interview Miryam Du-nour mit Dalia Grossmann (DG) (*1919 als Hildegard Sachs in Berlin; Emigration mit den Eltern nach Palästina 1933), Jerusalem, 9.5.1991 (IS_E_00054, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C3C7-680B-0201-4) 57 min 34 s– 58 min 10 s.
001 DG: wir unsre generation konnte ja alle (-) mindestens drei
002 wenn nich vier fünf sprachen können (.) denn ich selbst
003 sprech ja doch immerhin noch ganz gutes deutsch °hh
004 hebräisch natürlich fluently englisch fluently (-) vre
005 versteh französisch °hh jiddisch (-) n ich entsinn mich
006 mutti hat niemals gewollt dass ich jiddisch spreche °hh
007 sie hat immer gesagt „das is ein (.) schlechtes deutsch“
008 (.) „dann red entweder mit mir deutsch oder hebräisch
009 aber mach die deutsche sprache nich kaputt“ °hh in der
010 zwischenzeit wissen wir alle was jiddisch im grunde (–)
011 bedeutet (.) und wie wichtich das jiddisch is.
Unter „unsere[r] Generation“ schließt Grossmann möglicherweise auch die 1927 in Jerusalem in einer Prager Familie geborene Interviewerin Miryam Du-nour ein – für beide ist Deutsch (Z. 003) Familiensprache, obwohl Iwrit die Hauptsprache wurde (Z. 004). Hinzu kam noch Englisch, das genau für ihre Generation, die doch etliche Jahre im Britischen Mandatsgebiet Palästina verbrachte, eine große Rolle spielte (Z. 004). Dann erwähnt sie noch Französisch als passive Kompetenz (Z. 005) und schließlich Jiddisch. Diesbezüglich verbalisiert sie zunächst die negative Einstellung ihrer Mutter (Z. 006–009), die auf der Stigmatisierung des hybriden Charakters des Jiddischen und auf dem Reinheit-Mythos beruht, zwei Merkmale des monolingualen Habitus (vgl. Gogolin 1994; Busch 2017). Dalia Grossmann distanziert sich aber ausdrücklich von der Mutter (Z. 009–011).
Jeanette Goldstein gehört derselben Generation an, wurde aber in Wien geboren und wanderte erst 1939 mit einem Studentenzertifikat aus; ihre Eltern konnten nachkommen. Folgende Passage entstammt einem Sprachwechsel, in dem sie von der Verwendung einiger Austriazismen (Schwammerl für ‚Pilze‘, Häferl für ‚Nachttopf‘, ‚Tasse‘) berichtet. Diesen Punkt möchte die Interviewerin Maria Hovdar vertiefen:
(13) Interview Gina Staats (GS) und Maria Hovdar (MH) mit Jeanette Goldstein (JB) (*1920 in Wien als Jeanette Deutsch; Emigration nach Palästina 1939), Jerusalem, 30.11.1998 (ISW_E_00009, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C430-7A1C-3F01-A) 1h 0 min 10 s– 1h 1 min 24 s.
001 MH: ist äh dialekt in ihrer familie noch vor der
002 auswanderung verwendet worden?
003 JG: äh h° (.) meine mutter hat mit den nachbarn ein bisserl
004 (.) äh dialekt gesprochen.
005 MH: hat (.) sie sich angepasst (.) meinen sie?
006 JG: ja (.) ja.
007 MH: und in der familie?
008 JG: bitte?
009 MH: in der familie?
010 JG: nein hat sie deutsch gesprochen ja schauen sie meine (.)
011 eltern äh sind äh:: vom (-) kaiser-königlichen reich
012 gekommen meine mutter hat in einer deutschen schule ge
013 mein vater hat äh (–) nicht äh (.) er hat deutsch
014 gesprochen (.) aber (.) er hat äh äh nicht ein ganz ein
015 akzentfreies deutsch gespr[ochen].
016 MH: [hm ]hm al[so eine art
017 umgangssprache]?
018 JG: [ja ein bisschen
019 ins jid]dische herein.
020 MH: hmhm
021 JG: °h und hier komischerweise hat meine mutter begonnen °h
022 durch die nachbarn jiddisch zu sprechen (-) auch auch
023 jiddisch zu sprechen.
024 MH: hm (.) aber nicht wiener dialekt? also nicht wiener
025 dialekt?
026 JG: nein (.) da hat sie keine gelegenheit gehabt.
027 MH: hmhm
028 JG: sie hatte eine freundin in wien gehabt (.) sonst hat sie
029 keine gelegenheit gehabt.
Jeanette Goldstein verneint (010ff.), dass die Mutter in der Familie tatsächlich Dialekt gesprochen habe. Ihr Sprachgebrauch entspricht daher dem des Wiener Bürgertums (s. Gierlinger 2005 zum Sprachgebrauch der österreichischen Interviewten aus dem Israelkorpus). An dieser Stelle möchte sie dann als Kontrast (013) etwas zum Sprachgebrauch des Vaters hinzufügen, aber zunächst fehlen ihr die Worte (013–015). Das Zögern und die Suche nach einer Alternative zeigt, dass das, was sie ausdrücken möchte, problematisch ist. So sagt sie, ihr Vater habe „nicht ein ganz ein akzentfreies deutsch gesprochen“ (014–015), was die Interviewerin Maria Hovdar als Umgangssprache deutet (016–017), während Goldstein schließlich präzisiert, das Deutsch des Vaters sei eher „ins jiddische herein“ (019) – das soll nicht verwundern, denn beide Eltern wurden in Tarnopol, damals Galizien (heute Ternopil, Ukraine) geboren18. Vermutlich hat sie auch deswegen früher betont, die Mutter habe eine deutsche Schule besucht (012). Anschließend weist sie darauf hin, dass sie Mutter in Israel (hier, 021) angefangen habe, Jiddisch zu sprechen – sie leitet diese Aussage mit komischerweise (021) ein, was ihrer Einstellung zum Sachverhalt entspricht. Dass die Interviewerin wieder den Wiener Dialekt ins Spiel bringt, zeigt, dass ihr die soziolinguistische Situation in Israel um die Staatsgründung (1948) nicht klar ist (s. dazu Spolsky & Shohami 1999): Jiddisch sprach sie mit Nachbarn, die wohl nicht wie sie und ihr Mann an die österreichische Kultur assimiliert waren – die Nachbarn sprachen Jiddisch, aber höchstwahrscheinlich nicht Deutsch.
Auch Jehoshua Julius Brünn geht in seinem Interview mit der aus Berlin stammenden Eva Eylon19 auf die Verwendung von Jiddisch in seinen ersten Jahren in Palästina ein:
(14) Interview Eva Eylon mit Jehoshua Julius Brünn (JB) (*1913 in Allenstein, Ostpreußen; Emigration nach Palästina 1933), Petach Tikwa, 20.8.1991 (IS_E_00020, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C3B1-F1AA-B801-E) 31 min 42 s– 32 min 7 s.
001 JB: die umgangssprache war iwrit (.) aber die die die die
002 die wussten doch (.) wir sind alles neueinwanderer wir
003 konnten kein hebräisch (.) hat man mit uns jiddisch
004 gesprochen (.) ja?
005 EE: jiddisch.
006 JB: mehr jiddisch gesprochen wie hebräisch.
007 EE: aha. und jiddisch haben sie verstanden?
008 JB: ja. ja. damals wie ich nach paris kam (.) hat man mich
009 sogar gebracht in eine versammlung von den freiheiten
010 (.) hab ich noch (den chaver20) gefragt (.) was ist das
011 für ein deutscher dialekt?
012 EE: ja
013 JB: da hat mir das mir erklärt (.) ja?
014 EE: ach (.) das hatten sie vorher gar [nicht gewusst?]
015 JB: [gar nicht gewu]sst
016 hab ich gar nicht gewusst.
Brünn, der in Ostpreußen geboren wurde, erzählt hier (Z. 001–004), dass im Palästina der 30er Jahren unter Neueinwanderern aus verschiedenen (ost- und zentraleuropäischen) Ländern Jiddisch als eine Art Lingua Franca fungierte, weil viele noch kein Hebräisch konnten. Die Berlinerin Eva Eylon zeigt sich darüber recht verwundert (Z. 007 aha) und fragt, ob er Jiddisch verstanden hätte. Brünn bestätigt das (Z. 008), er fügt aber gleich eine Anekdote aus der Zeit vor der Emigration nach Palästina hinzu, als er noch in Paris war und an einer (wohl zionistischen) Versammlung teilnahm: Das war das erste Mal, dass er das Jiddische hörte und er dachte, es sei ein „deutscher Dialekt“ (Z. 011). Davor habe er „gar nicht gewusst“ (Z. 015, 016), dass es Jiddisch gab.
Von einem weiteren Fall der Änderung des Sprachgebrauchs und der Spracheinstellungen im Rahmen von Migrationserfahrungen berichtet der Journalist Ari Rath in (15). Rath, der in einem assimilierten Elternhaus in Wien geboren wurde – wobei beide Eltern aus Galizien stammten (zur soziolinguistischen Situation in Galizien s. oben § 5) – konnte 1939 mit der Organisation Jugendalijah nach Palästina auswandern, während dem Vater und dessen zweiter Frau Rita die Flucht in die USA gelang; die erste Frau, die Mutter von Ari Rath und von seinem Bruder, hatte sich 1929 das Leben genommen (s. Z. 003–004 und Luppi & Pellegrino im Druck). Im hier nicht angeführten Teil des Interviews erzählt Ari Rath der Interviewerin Anne Betten, dass er Ende 1946 vom damaligen noch Britischen Mandatsgebiet Palästina nach New York zum Vater reiste, den er zuletzt 1938 gesehen hatte, als die Gestapo ihn verhaftet hatte. Anne Betten erinnert sich, dass Rath in einem früheren Gespräch gesagt hatte, mit dem Vater habe er später nur noch Englisch gesprochen, aber sie geht nun von der Annahme aus, dass der Vater in New York mit der Familie (d.h. mit der zweiten Frau und mit der gemeinsamen Tochter Henny) weiterhin Deutsch gesprochen hätte21. Das verneint Rath und beginnt, das familiäre Sprachrepertoire diachron zu präzisieren:
(15) Interview Anne Betten (AB) mit Ari Rath (AR) (*1925 in Wien als Arnold Rath; Emigration nach Palästina mit Jugendalijah 1939), Jerusalem, 27.12.1999 (IS_E_00021, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C438-B62C-5F01-7) 17 min 4 s–19 min 41 s
001 AR: ja ja (.) die [Rita] konnte auch polnisch (.) sie kam
002 aus sambor (.) der vater kam aus kolomea (.) und meine/
003 unsere eigene mutter (-) die neunundzw/
004 neunzehnneunundzwanzig in wien gestorben ist äh kam aus
005 stryj (–) äh dann hat man aber man hat nicht jiddisch
006 (-) mit der großmutter (.) der mutter unserer mutter
007 noch ein bisschen gel/ aber ist mir sofort aufgefallen
008 (–) mein (-) vater hat gleich gejiddelt (–) also so
009 ein/ ein halbes jiddisch: (-) denn englisch konnte ich
010 leider noch nicht sprechen (.) mit der rita hat er sehr
011 viel englisch gesprochen ((35 s Auslassung))
012 das war von anfang an (.) das ist ganz interessant mit
013 meinem bruder habe ich hebräisch gesprochen °h mit dem
014 vater (-) bis wir englisch sprechen konnten (-)
015 eigentlich so bisschen gejiddelt (.) das war kein reines
016 jiddisch ((45 s Auslassung))
017 und äh aber das ist ganz interessant (-) und wenn ich da
018 einen kurzen vorsprung/ die letzten fünf jahre seines
019 lebens (.) wie der vater (-) bei mir hier in jerusalem
020 (-) gelebt hat von zweiundsiebzig bis siebenundsiebzig
021 (-) haben wir (-–) auch meistens englisch gesprochen
022 (-–) oder so ein bisschen (-–) jiddisch so:: (-––) wenn
023 das im weg so ( ) aber (-) nie (-) wieder (-) hoch
024 (-) deutsch (-) obwohl man zu hause (.) wirklich (-)
025 ein/ kein wiener dialekt (-) oder vielleicht ein
026 österreichisch genäseltes äh dingsda.
Nachdem Rath darauf hingewiesen hat, dass alle in der Familie aus Galizien stammten (Z. 001–005), betont er, dass während seiner Kindheit in Wien in der Familie kein Jiddisch gesprochen wurde (Z. 005) – die einzige Ausnahme bildeten Gespräche mit der Großmutter (Z. 006–007). Aber als er in New York ankam, habe er gleich bemerkt, dass der „Vater […] gejiddelt“ (Z. 008) habe. Rath erklärt dann, was er unter gejiddelt versteht, d.h. „ein halbes Jiddisch“ (Z. 009). Das gehörte offenbar zu einer Kommunikationsstrategie des Vaters, der die deutsche Sprache vermeiden wollte, denn mit seiner Frau habe er bereits „viel Englisch gesprochen“ (Z. 010–011). Das war mit Ari Rath noch nicht möglich, weil er damals noch kein Englisch konnte (Z. 009–010). In New York hätten sich dementsprechend die Kommunikationssprachen innerhalb der Familie gründlich geändert, was Rath selbst metanarrativ zweimal als besonders erzählwürdig (Lucius-Hoene & Deppermann 2004: 127–128) einstuft (Z. 012 und 017). Der Grund zum Sprachwechsel wird nicht explizit genannt, es liegt aber auf der Hand, dass er sich im Rahmen einer Stigmatisierung der deutschen Sprache als Folge der Shoah ereignet hat.22 Deutsch wird negativ bewertet und vermieden, während Jiddisch aufgewertet wir. Da Rath kein Englisch kann, wird ins Jiddische gewechselt, aber das sei „kein reines Jiddisch“ gewesen – paradoxerweise (s. § 3) wird das Adjektiv rein nun für das Jiddisch verwendet. Mit dem Bruder habe er schon eine weitere gemeinsame Sprache gehabt, Hebräisch (Z. 013), die sie nach der Emigration konsequent statt Deutsch verwendet haben. Er schildert ferner auch die spätere Sprachsituation mit dem Vater, als dieser „die letzten fünf Jahre seines Lebens […] in Jerusalem“ (Z. 018-019) bei dem Sohn lebte: Sie sprachen dann meist Englisch, gelegentlich Jiddisch (Z. 021-022), „aber nie wieder Hochdeutsch“, wie Rath selbst betont (Z. 023). Diesen Abschnitt zu den Folgen der Shoah auf die Familiensprache schließt Rath mit dem Hinweis ab, dass früher zu Hause auch kein Wiener Dialekt gesprochen wurde (Z. 025).
5. Diskussion und Schluss
Die hier angeführten Textbeispiele aus dem Israelkorpus haben die Vielfalt an Spracheinstellungen gegenüber dem Jiddischen unter den Interviewten von Anne Bettens Projekt gezeigt. Die Ausschnitte in Abschnitt 4.1. deuten auf eine nahezu vollständige Verdrängung des Jiddischen hin, denn beide Sprecher distanzieren sich deutlich von ihm und halten es vom eigenen Sprachrepertoire fern: Walk (Bsp. 2) hebt zum einen die Migrationsgeschichte der Familie aus dem Osten hervor, zum anderen betont er aber, dass er weder vom Großvater noch vom Vater „jemals ein jiddisches Wort gehört habe“ (Z. 012–103). Ähnliches gilt für den jüngeren Josef Stern (Bsp. 3), der erzählt, wie er in seiner Kindheit und Jugend die jüdische Gemeinde in seiner Heimatsstadt Gießen als kulturell, sozial und sprachlich homogen wahrnahm – dadurch blendet er sowohl die Migrationsgeschichte der eigenen Familie als auch deren heteroglossischen Sprachgebrauch aus. Beide Sprecher, Walk und Stern, sind Beispiele für die Macht des monolingualen Habitus in Deutschland (Gogolin 1994), der entscheidend dazu beiträgt, dass sie vom Jiddischen Abstand nehmen.
Aus den in Abschnitt 4.2. analysierten Beispielen geht hervor, dass die Sprechenden schon in ihrer Kindheit Mehrsprachigkeit erlebt und gelebt haben, was mit einer positiven Einstellung dem Jiddischen gegenüber verbunden ist: Für Rosenkranz (Bsp. 4, 5, 6, 7 u. 8), Bernstein (Bsp. 9) und Scha’ari (Bsp. 10 und 11) gehört Jiddisch seit ihrer Kindheit zum eigenen Sprachrepertoire. Die Positionierung von Rosenkranz, der in Wien geboren wurde und dort die Kindheit verbrachte, ist eigentlich noch von einer gewissen Ambivalenz gekennzeichnet, denn im Bsp. 7 präzisiert er schließlich, dass er in Wien nur eine passive Kompetenz des Jiddischen gehabt habe. Hingegen ist sowohl das Repertoire von Bernstein, die aus Kurland stammte, als auch von Scha’ari, der in der Bukowina lebte, von aktiver Mehrsprachigkeit gekennzeichnet. Beide Regionen waren lange Randgebiete von mehrsprachigen Reichen – Kurland vom Russischen Reich, Bukowina von der Habsburger Monarchie – in denen sich der monolinguale Habitus nie wirklich durchsetzen konnte (das gilt übrigens auch für Galizien, woher Rosenkranz’ Familie stammte).
Abschnitt 4.3 hat schließlich Beispiele untersucht, in denen Änderungen der Spracheinstellungen und Sprachgebrauch als Folge von Migrationserfahrungen thematisiert wurden. Dalia Grossmann (Bsp. 12), als vierzehnjährige mit der Familie nach Palästina ausgewandert, positioniert sich selbst und ihre ganze Generation gerade zum Thema Sprachgebrauch und Sprachrepertoire explizit im Gegensatz zur Generation der Eltern. Anschließend betont sie ausdrücklich die bedeutende Rolle des Jiddischen (Bsp. 12, Z. 9–11). Jeanette Goldstein (Bsp. 13) unterstreicht auf der einen Seite, dass die Mutter höchstens mit den Nachbarn in Wien Dialekt gesprochen habe, als Zeichen der Nähe ihnen gegenüber und um eine gemeinsame sprachliche Basis mit ihnen zu haben (Bsp. 12, Z. 003–004); dagegen habe sie, obwohl aus Galizien stammend, in der Familie nur Deutsch gesprochen (Bsp. 12, Z. 010). Auf der anderen Seite weist sie darauf hin, dass sie in Israel ihr Sprachrepertoire erweitert habe, um auch das Jiddisch miteinzuschließen – wieder als Zeichen der Nähe den (neuen) Nachbarn gegenüber und um eine gemeinsame sprachliche Grundlage mit ihnen zu konstruieren (Bsp. 12, Z. 021–023). Jehoshua Julius Brünn (Bsp. 14) erklärt, wie er in den ersten Jahren in Palästina mit weiteren Neueinwander*innen (wohl aus Osteuropa) Jiddisch als gemeinsame Lingua Franca gesprochen habe, obwohl er ursprünglich aus einer ähnlichen Position wie Walk oder Stern (Abschn. 1), d.h. mangelnder Wahrnehmung bzw. Unkenntnis des Jiddischen, ausgegangen sei. Ari Rath (Bsp. 15) erzählt schließlich, wie die Judenverfolgung und die Shoah nicht nur Zäsuren in den Lebensgeschichten der Familie, sondern auch in ihrem Sprachgebrauch verursacht hätten. Als er 1946 in New York nach acht Jahren den Vater wiedersah, bemerkt er sofort, dass dieser „ein halbes Jiddisch“ (Z. 015) mit ihm sprach, während früher in der Familie normalerweise Deutsch gesprochen wurde. Dadurch wollte der Vater seine Distanz zur deutschen Kultur ausdrücken. Mit dem Vater habe er nie mehr Hochdeutsch gesprochen (Bsp. 15, 23–024).
Für zukünftige Forschungen könnte es ertragreich sein, Informationen aus den Interviews des Israelkorpus mit anderen Materialien zu ergänzen, die mit den Interviewten in Verbindung stehen, wie z.B. weitere Interviews oder Archivmaterial (Betten & Leonardi 2023)23, so dass eine Art Triangulation der verfügbaren Quellen durchgeführt werden kann. Auch eine feinere Ausdifferenzierung unterschiedlicher Spracheinstellungen, die z.B. sowohl das Jiddische als auch den Dialekt mitberücksichtigt – und dementsprechend auch weitere sozial-sprachideologische Konstellationen, könnte zu einem vollständigeren Bild der Spracheinstellungen der Interviewten aus dem Israelkorpus beitragen.
Korpora
IS = Emigrantendeutsch in Israel, DGD, Leibniz-Institut für deutsche Sprache; PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C3A7-393A-8A01-3
ISW = Emigrantendeutsch in Israel: Wiener in Jerusalem, DGD, Leibniz-Institut für deutsche Sprache; PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C42A-423C-2401-D
Literatur
Bamberg, Michael. 1997. Positioning Between Structure and Performance. Journal of Narrative and Life History. John Benjamins.
Bamberg, Michael & Alexandra Georgakopoulou. 2008. Small stories as a new perspective in narrative and identity analysis. Text & Talk 28(3). 377–396.
Begaj, Samuela. 2018. Biografie linguistiche empiriche e letterarie: „Storia di una vita“ di Aharon Appelfeld e tre interviste dall’Israelkorpus. Pisa: Università di Pisa Bachelorarbeit (Dissertazione finale).
Berry, John W., Jean S. Phinney, David L. Sam & Paul Vedder (eds). 2006. Immigrant Youth in Cultural Transition: Acculturation, Identity, and Adaptation Across National Contexts. New York: Psychology Press.
Betten, Anne (Hg.). 1995. Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Teil I: Transkripte und Tondokumente (Phonai 42). Tübingen: Niemeyer.
Betten, Anne. 2000. „Vielleicht sind wir wirklich die einzigen Erben der Weimarer Kultur“. Einleitende Bemerkungen zur Forschungshypothese ,Bildungsbürgerdeutsch in Israel‘ und zu den Beiträgen dieses Bandes. In Anne Betten & Miryam Du-nour (Hg.), Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Teil II: Analysen und Dokumente (Phonai 45), 157–181. Tübingen: Niemeyer.
Betten, Anne. 2007. Zwischen Individualisierung und Generalisierung: Zur Konstruktion der Person in autobiografischen Emigranteninterviews. In Irmtraud Behr, Anne Larrory & Gunhild Samson (Hg.), Der Ausdruck der Person im Deutschen (Eurogermanistik 24), 173–186. Tübingen: Stauffenburg.
Betten, Anne. 2010. Sprachbiographien der 2. Generation deutschsprachiger Emigranten in Israel: Zur Auswirkung individueller Erfahrungen und Emotionen auf die Sprachkompetenz. (Hg.) Rita Franceschini. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (LiLi) 40(160. Sprache und Biographie). 29–57.
Betten, Anne. 2011. Sprachheimat vs. Familiensprache Die Transformation der deutschen Sprache von der 1. zur 2. Generation der Jeckes. In Christian Kohlross & Hanni Mittelmann (Hg.), Auf den Spuren der Schrift: Israelische Perspektiven einer internationalen Germanistik (Conditio Judaica 80), 205–228. Berlin/Boston: de Gruyter.
Betten, Anne. 2013. Sprachbiographien deutscher Emigranten. Die „Jeckes“ in Israel zwischen Verlust und Rekonstruktion ihrer kulturellen Identität. In Arnulf Deppermann (Hg.), Das Deutsch der Migranten (Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2012), 145–192. Berlin, Boston: de Gruyter.
Betten, Anne. 2016. Zusammenhänge von Sprachkompetenz, Spracheinstellung und kultureller Identität – am Beispiel der 2. Generation deutschsprachiger Migranten in Israel. In Simona Leonardi, Eva-Maria Thüne & Anne Betten (Hg.), Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narrativen Interviews: Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten, 353–381. Würzburg: Königshausen & Neumann.
Betten, Anne. 2023. Interview mit Anne Betten zur Entstehungsgeschichte und Archivierung der sog. Israelkorpora. (Hg.) Barbara Häußinger, Carolina Flinz, Simona Leonardi, Ramona Pellegrino & Eva-Maria Thüne. germanica; 33 (Erzählte Chronotopoi: Orte und Erinnerung in Zeitzeugeninterviews und -berichten zu erzwungener Migration im 20. Jahrhundert). 9–50.
Betten, Anne & Miryam Du-nour (Hg.). 2000. Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Teil II: Analysen und Dokumente (Phonai 45). Tübingen: Niemeyer.
Betten, Anne, Carolina Flinz & Simona Leonardi. 2023. Emigrantendeutsch in Israel: Die Interviewkorpora IS, ISW und ISZ im Archiv für Gesprochenes Deutsch des IDS. In Marc Kupietz & Thomas Schmidt (Hg.), Neue Entwicklungen in der Korpuslandschaft der Germanistik: Beiträge zur IDS-Methodenmesse 2022 (Korpuslinguistik und Interdisziplinäre Perspektiven auf Sprache – Corpus linguistics and Interdisciplinary perspectives on Language (CLIP) 11). Tübingen: Narr Francke Attempto.
Betten, Anne & Simona Leonardi. 2023. Das Interviewkorpus „Sprachbewahrung nach der Emigration / Emigrantendeutsch in Israel“: Ein sprach- und kulturwissenschaftliches Archiv des deutschsprachigen Judentums im 20. Jahrhundert. Tsafon Hors-série no 11 (Archives de la Diaspora / Diaspora des Archives. Penser la mémoire de la dispersion à partir de l’espace germanophone). 233–258.
Betten, Anne, Eva-Maria Thüne & Simona Leonardi. 2016. Einleitung. In Simona Leonardi, Eva-Maria Thüne & Anne Betten (Hg.), Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narrativen Interviews: Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten, vii–xvii. Würzburg: Königshausen & Neumann.
Blommaert, Jan. 2008. Grassroots literacy: writing, identity and voice in central Africa (Literacies). London / New York: Routledge.
Bourdieu, Pierre. 1979. Entwurf einer Theorie der Praxis: auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 291). Üb. von Cordula Pialoux & Bernd Schwibs. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Brinkmann, Tobias. 2010. Jüdische Migration. In EGO = Europäische Geschichte Online. Mainz: Institut für Europäische Geschichte. http://www.ieg-ego.eu/brinkmannt-2010-de.
Busch, Brigitta. 2017. Mehrsprachigkeit (UTB Sprachwissenschaft 3774). 2. Auflage. Wien: facultas.
Davies, Bronwyn & Rom Harré. 1990. Positioning: The Discursive Production of Selves. Journal for the Theory of Social Behaviour 20(1). 43–63.
Du-nour, Miryam. 2000. Sprachenmischung, Code-Switching, Entlehnung und Sprachinterferenz. Einflüsse des Hebräischen und Englischen auf das Deutsch der fünften Alija. In Anne Betten & Miryam Du-nour (Hg.), Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Analysen und Dokumente (Phonai 45), 445–477. Tübingen: Niemeyer.
Elias, Norbert. 1996. Über sich selbst (Edition Suhrkamp 3329). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Estraikh, Gennady & Mikhail Krutikov. 2010. Yiddish in Weimar Berlin: at the crossroads of diaspora politics and culture (Legenda 8). London: Legenda.
Fleischer, Jürg. 2018. Western Yiddish and Judeo-German. In Sarah Benor & Benjamin H. Hary (Hg.), Languages in Jewish communities, past and present, 239–275. Berlin / Boston: De Gruyter Mouton.
Gierlinger, Maria. 2005. Wienerisch versus Burgtheaterdeutsch. Soziolinguistische Überlegungen zur Sprache der österreichischen Jeckes. In Moshe I. Zimmermann & Yotam Ḥotam (Hg.), Zweimal Heimat. Die Jeckes zwischen Mitteleuropa und Nahost, 51–58. Frankfurt am Main: Beerenverlag.
Gogolin, Ingrid. 1994. Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule (Internationale Hochschulschriften 101). Münster / New York / München / Berlin: Waxmann.
Gumperz, John J. 1964. Linguistic and Social Interaction in Two Communities. American Anthropologist 66(6). 137–153.
Harré, Rom & Luk van Lagenhove (Hg.). 1999. Positioning theory: moral contexts of intentional action. Oxford / Malden, MA: Blackwell.
Hausleitner, Mariana. 2008. Rumänien. In Wolfgang Benz & Werner Bergmann (Hg.), Handbuch des Antisemitismus: Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, 290–298. München: K.G. Saur.
Jaffe, Alexandra. 2020. Language ideologies and linguistic representations: Two lenses for a critical analysis of polynomie in Corsica. International Journal of the Sociology of Language 2020(261). 67–84.
Kiefer, Ulrike. 1991. Sprachenpolitik gegenüber fremdsprachigen Minderheiten im 19. Jahrhundert: Jiddisch. In Rainer Wimmer (Hg.), Das 19. Jahrhundert: Sprachgeschichtliche Wurzeln des heutigen Deutsch, 172–177. Berlin / New York: de Gruyter.
Kiefer, Ulrike. 2004. Jiddisch/Deutsch. In Werner Besch, Anne Betten, Oskar Reichmann & Stefan Sonderegger (Hg.), Sprachgeschichte (HSK 2), Teil. 4, 3260–3268. Berlin / New York: De Gruyter / Mouton.
Koesters Gensini, Sabine E. & Simona Leonardi. 2023. Orte und Erinnerungen: Breslau im Israelkorpus. In Tim Buchen & Maria Luft (Hg.), Breslau / Wrocław 1933–1949. Studien zur Topographie der Shoah, 469–496. Berlin: Neofelis Verlag.
König, Katharina. 2014. Spracheinstellungen und Identitätskonstruktion: eine gesprächsanalytische Untersuchung sprachbiographischer Interviews mit Deutsch-Vietnamesen (Empirische Linguistik, Empirical Linguistics ; 2 Band 2 =). Berlin / Boston: De Gruyter.
Leonardi, Simona. 2019. Deutsche Sprache und Kultur in autobiographischen Zeugnissen dreier deutschsprachiger israelischer Intellektueller. In Norbert Otto Eke & Stephanie Willeke (Hg.), Zwischen den Sprachen – Mit der Sprache? Deutschsprachige Literatur in Palästina und Israel., 79–110. Bielefeld: Aisthesis Verlag.
Leonardi, Simona. 2022. Nomi, identità e spazi nelle interviste narrative dell’Israelkorpus. In Francesca M. Dovetto & Rodrigo Frías Urrea (Hg.), Nome, identità e territorio / Nombre, identidad y territorio (Linguistica delle differenze 7), 329–381. Roma: Aracne.
Leonardi, Simona. im Druck. Lingua sotterranea, lingua di famiglia, lingua segreta: lo yiddish e migrazioni dall’Europa Orientale in Germania nelle testimonianze dell’Israelkorpus. In Massimiliano De Villa & Roberta Ascarelli (Hg.), Mitteleuropa ebraica. Milano: Mimesis.
Lucius-Hoene, Gabriele & Arnulf Deppermann. 2004. Rekonstruktion narrativer Identität: ein Arbeitsbuch zur Analyse narrativer Interviews. 2. Aufl. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
Luppi & Pellegrino. im Druck. Emotionsausdruck und thematisches Wiederholungsverfahren in narrativen Interviews. DIEGESIS 13 (1).
Mende, Jana-Katharina. 2022. Geschichte von Mehrsprachigkeit in Deutschland. In Csaba Földes & Thorsten Roelcke (Hg.), Handbuch Mehrsprachigkeit (Handbücher Sprachwissen (HSW) 22), 107–130. Berlin / Boston: De Gruyter.
Michaelis-Stern, Eva. 1985. Erinnerungen an die Anfänge der Jugend-Alijah in Deutschland. Bulletin des Leo-Baeck-Instituts 70. 55–66.
Pellegrino, Ramona. 2023. Erinnerte Mehrsprachigkeit in den Gebieten der Habsburgermonarchie: Beispiele aus narrativen Interviews des Israelkorpus. Schnittstelle Germanistik 3(1). 13–37.
Polenz, Peter von. 1994. Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. II. 17. und 18. Jahrhundert. Berlin / New York: de Gruyter.
Polenz, Peter von. 1999. Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. III. 19. und 20. Jahrhundert. Berlin / New York: de Gruyter.
Rahden, Till van. 2000. Juden und andere Breslauer: die Beziehungen zwischen Juden, Protestanten und Katholiken in einer deutschen Grossstadt von 1860 bis 1925 (Kritische Studien Zur Geschichtswissenschaft Bd. 139). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Reichmann, Oskar. 1991. Sprache ohne Leitvarietät vs. Sprache mit Leitvarietät: ein Schlüssel für die nachmittelalterliche Geschichte des Deutschen? In Werner Besch (Hg.), Deutsche Sprachgeschichte. Grundlagen, Methoden, Perspektiven. Festschrift für Johannes Erben zum 65. Geburtstag, 141–158. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang.
Sanders, Daniel. 1860. Wörterbuch der deutschen Sprache. Leipzig.: Wigand.
Sela-Sheffy, Rakefet. 2013. „Europeans in the Levant“ Revisited: German Jewish Immigrants in 1930s Palestine and the Question of Culture Retention. In José Brunner (Hg.), Deutsche(s) in Palästina und Israel: Alltag, Kultur, Politik (Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 41 (2013)), 40–59. Göttingen: Wallstein.
Selting, Margret, Peter Auer, Dagmar Barth-Weingarten, Jörg Bergmann, Pia Bergmann, Karin Birkner, Elizabeth Couper-Kuhlen, Arnulf Deppermann, Peter Gilles, Susanne Günthner, Martin Hartung, Friederike Kern, Christine Mertzlufft, Christian Meyer, Miriam Morek, Frank Oberzaucher, Jörg Peters, Uta Quasthoff, Wilfried Schütte, Anja Stukenbrock & Susanne Uhmann. 2009. Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT 2). Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 10, 353 – 402 <http://
www.gespraechsforschung-ozs.de/fileadmin/dateien/heft2009/px-gat2.pdf>
Spolsky, Bernard. 2014. The languages of the Jews: a sociolinguistic history. Cambridge: Cambridge University Press.
Spolsky, Bernard & Elana Shohami. 1999. The languages of Israel: policy, ideology and practice (Bilingual Education and Bilingualism 17). Clevedon: Multilingual Matters.
Suleiman, Susan Rubin. 2002. The 1.5 Generation: Thinking About Child Survivors and the Holocaust. American Imago 59(3). 277–295.
Verschik, Anna. 2018. Yiddish, Jewish Russian, and Jewish Lithuanian in the Former Soviet Union. In Benjamin Hary & Sarah Bunin Benor (Hg.), Languages in Jewish Communities, Past and Present, 627–643. Berlin / Boston: De Gruyter.
Wolf, Michaela. 2012. Die vielsprachige Seele Kakaniens. Böhlau Verlag.
Woolard, Kathryn A. 1998. Introduction: Language ideology as a field of inquiry. In Bambi B. Schieffelin, Kathryn A. Woolard & Paul V. Kroskrity (eds.), Language Ideologies: Practice and Theory., 3–47. Oxford: Oxford University Press.
1 Für eine quantitative und mixed-methods Analyse von Mehrsprachigkeit in den Israelkorpora 1. Generation s. Pellegrino in diesem Band.
2 In der wissenschaftlichen Literatur gibt es keinen Konsens für diesen Glottonym: „Different scholars may understand different linguistic entities when using the terms West(ern) Yiddish (or its equivalents, such as Yiddish mayrev-yidish, mayrevdik yidish, German Westjiddisch, etc.) or Judeo-German (or its equivalents, such as Judaeo-German, Jewish German, Yiddish yidish-daytsh, German Jüdisch-Deutsch, Judendeutsch, etc.)“ (Fleischer 2018: 239); vgl. auch Kiefer (1991).
3 Vgl. Brinkmann (2010: Abschn. 28): „Nach einer konservativen Schätzung fielen allein 1918/1919 mindestens 60.000 Juden vor allem im Gebiet der heutigen Westukraine gezielten Pogromen zum Opfer“.
4 Damit sind „die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder“, dem die Länder der Ungarischen Krone – transleithanische Länder – nicht gehörten (Wolf 2012: 68).
5 Die Vernachlässigung der individuellen Mehrsprachigkeit hat vermutlich zur Verfestigung schablonenhafter ethnischer Identitäten beigetragen, zumal weite Teile der Bevölkerung von einer Gleichsetzung von Umgangssprache und Nationalität ausgingen (Wolf 2012: 69).
6 Die Traskripte wurden in Anlehnung an das Transkriptionssystem GAT 2 erstellt (Selting et al. 2009); es handelt sich um Minimaltranskripte; Ausschnitte, die für die Analyse besonders ertragreich sind, wurden fett gesetzt.
7 Vgl. Interview Anne Betten mit Josef Walk (IS_E_00135, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C403-8ACB-AC01-A) – auf die Interviews aus den Israelkorpora wird mit der Ereignisnummer (hier IS_E_00135) und – falls vorhanden – mit der PID verwiesen, unter denen sie am Leibniz-Institut für deutsche Sprache archiviert sind. Zur Rolle des Bildungsbürgerdeutsch in der Rekonstruktion der eigenen (Sprach)biographie s. v.a. Betten (2000); vgl. ferner Gierlinger (2005).
8 Anderenorts haben Sabine Koesters Gensini und ich (Koesters Gensini & Leonardi 2023: 489) auf diese Stelle im Zusammenhang mit dem Sozialgefüge des Breslauer Judentums hingewiesen, das Elias als homogen bürgerlich darstellt – mit Ausnahme der Jiddisch sprechenden Einwander*innen aus dem Osten habe es in Breslau keine armen Juden gegeben. Jedoch sei nach historischen Forschungen „die Vorstellung, die Mehrheit der Juden in der schlesischen Hauptstadt habe dem Bürgertum angehört, irreführend“ (Rahden 2000: 98) – auch in Fall Elias’ handelt es sich wohl um ein idealisiertes Bild.
9 Bei derselben Volkszählung 1910 betrug „[i]n Berlin [der Anteil an ausländischen Juden] knapp 19%, in Frankfurt am Main und in Köln 13,5%, in München 35% und in Hamburg 16%“ (Rahden 2000: 269).
10 Vgl. Interview Anne Betten mit Josef Stern (IS_E_0024, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C3FB-6E6B-9401-E), 38 min 43 s.
11 Zu der Verschränkung zwischen Jiddisch bzw. Spuren von Jiddisch und Migrationsgeschichten aus Osteuropa nach Deutschland in den Narrativen aus dem Israelkorpus s. Leonardi (im Druck)
12 Die Aufnahme beginnt mit folgenden Worten des Interviewers Hannes Scheutz: „durch ein Missgeschick fehlen die ersten zwei Minuten dieses Interviews, in denen Herbert Rosenkranz einige Sätze über seine Herkunft aus Galizien, bzw. die Herkunft seiner Großeltern aus Galizien, gesprochen hat“ (ISW-_E_00023, 0 min–27 s).
13 S. dazu auch folgenden späteren Wortwechsel zwischen Maria Dorninger (MD) und Herbert Rosenkranz (HR): „MD: Sie sagen immer die jüdische Sprache, ist das für sie Jiddisch? HR: Jiddisch, natürlich. MD: Nicht Hebräisch, sondern Jiddisch. HR: Natürlich“ (1 h 53 min 08 s).
14 Soziolinguistische Vielfalt und mehrsprachige Sprachgemeinschaften gekennzeichneten Lettland und im besonderen Maße die dortige jüdische Bevölkerung: „Latvia had about 100,000 Jews, whose sociolinguistic and socioeconomic profile was more diverse than in Lithuania […]. There were several competing cultural orientations (Yiddishist, Hebraist, German, Russian, secular, traditional, left- and right-wing, etc.), especially in the capital, Riga […]. Jews spoke regional varieties of Yiddish, as well as Russian and (Baltic) German“ (Verschik 2018: 632).
15 Vgl. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/song/our-town-is-burning.
16 Wolf (2012: 74) weist darauf hin, dass eine eindeutige und einschlägige Definition von Landessprache fehlt, denn „in einschlägigen Gesetzen […] die Begriffe nicht erläutert und dementsprechend auch von Fall zu Fall unterschiedlich angewendet“ wurden.
17 Zu den Besonderheiten von Akkulturationsdynamiken jüngerer Zuwanderer*innen, die Susan Rubin Suleiman (2002) die „Generation 1.5“ nannte, s. Berry et al. (2006); Sela-Sheffy (2013); speziell zu den Interviews und Lebensgeschichten aus den Israelkorpora s. Leonardi (2019).
18 Vgl. den entsprechenden von Jeanette Goldstein ausgefüllten Fragebogen im Rahmen des Interviewprojekts.
19 Eva Eylon, selbst Interviewte im Rahmen von Anne Bettens Projekt (s. DGD, Ereignis IS–_E_00035), hat einige Interviews durchgeführt, nachdem Anne Betten die Kassetten mit ihren ersten 50 Interviews gestohlen wurden (vgl. Betten 2023: 23–25).
20 Hebr. ‚Genosse‘.
21 Vgl. ISW-_E_00021, 16 min 43 s: „Du hast gesagt, später hast du mit deinem Vater nur Englisch gesprochen, als du/ als ihr euch begegnet seid, da wieder, der sprach doch sicher mit seiner Frau Rita Deutsch, nicht?“.
22 Zur Stigmatisierung der deutschen Sprache in Palästina/Israel s. die Untersuchungen von Betten, v.a. diejenigen, die auf die Akkulturation der 1. Generation in Palästina und auf die 2. Generation fokussieren, etwa Betten (2010); Betten (2011); Betten (2016).
23 S. bereits in dieser Themenausgabe Pellegrino, die in ihrem Beitrag zu Interviews aus dem Israelkorpus auch die Fragebögen der Interviewten und das Genealogie-Archiv Geni als Quellen für die Ermittlung sämtlicher Herkunftsorte berücksichtigt.