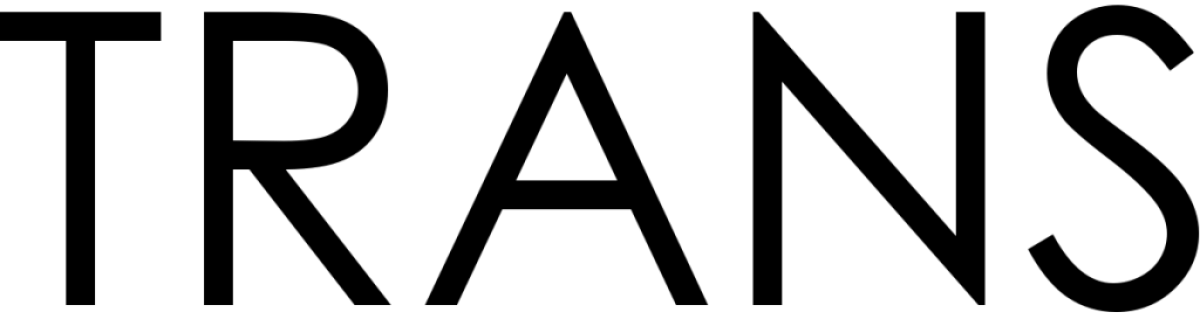David Pappalardo
(Università degli Studi di Catania / Europa-Universität Viadrina Frankfurt Oder)
david.pappalardo@phd.unict.it
Abstract
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit einer sprachwissenschaftlich orientierten Analyse des autobiografischen Romans Lena Goreliks, Wer wir sind (2021). Dabei wird Bezug auf die Begriffe von Linguizismus und sprachlich-kultureller Zugehörigkeit genommen. Während die sprachwissenschaftliche Forschung das Phänomen des Linguizismus bereits in unterschiedlichen kommunikativen Alltagskontexten beobachtet hat, konzentriert sich diese Analyse auf die emotionalen Auswirkungen des Linguizismus auf das Zugehörigkeitsgefühl am Beispiel von Goreliks narrativem Werk. Im Fokus der Untersuchung stehen dementsprechend Scham- und Stolzempfindungen als emotionale Reaktionen auf sprachliche und soziokulturelle Ausgrenzungserfahrungen, mit der sich die Familie der Protagonistin vor und nach ihrer Einwanderung nach Deutschland konfrontiert sah. Abschließend widmet sich der Beitrag der Darstellung, wie die sprachlich-soziale Zugehörigkeit auch durch das Gefühl der Scham erfahrbar gemacht werden kann und inwieweit Sprachen im Allgemeinen eine aktive Rolle bei der Gestaltung der eigenen sozialen Selbstverortung(en) einnehmen können.
Il presente contributo propone un’analisi dei rapporti tra linguismo e appartenenze linguistico-culturali all’interno del romanzo autobiografico di Lena Gorelik, Wer wir sind (2021). Laddove la ricerca in ambito sociolinguistico si è occupata di studiare le dinamiche del linguismo nella quotidianità di contesti comunicativi disparati, il presente articolo concentra la propria analisi sugli effetti emotivi e di appartenenza sociale di un’opera narrativa autobiografica, in questo caso del romanzo di Lena Gorelik. Nello specifico, nel presente contributo si rivolge particolare attenzione ai sentimenti di vergogna e orgoglio, presenti come reazioni emotive alle esperienze di emarginazione e discriminazione linguistica e socioculturale vissuta dalla famiglia della protagonista prima e dopo la propria immigrazione in Germania. Infine, il contributo mostra sulla base di tale narrazione fino a che punto le lingue possano giocare un ruolo nella formazione di appartenenze sociali e come queste ultime possano essere vissute e marcate da sentimenti di vergogna per la propria identità.
The following paper attempts to realize a linguistic-oriented analysis of Lena Gorelik’s autobiographical novel, Wer wir sind (2021), with reference to the concepts of linguicism and linguistic-cultural belonging. While sociolinguistic research has already observed the dynamics of linguicism in various everyday communicative contexts, the following study uses Gorelik’s autobiographical work to qualitatively reflect on the emotional consequences of linguicism and its effect on the affected people’s sense of belonging. More specifically, the following study focuses on feelings of shame and pride as emotional reactions to linguistic and socio-cultural experiences of marginalisation faced by the protagonist’s family before and after her immigration to Germany. Finally, the article aims at discussing, on the one hand, how linguistic-social belonging can be marked by feelings of shame and, on the other hand, to what extent languages in general can play an active role in shaping one’s own social self-positioning(s).
1. Einführung
Im vorliegenden Beitrag wird eine Analyse des autobiografischen Romans Lena Goreliks, Wer wir sind (2021), unter Berücksichtigung des sprachwissenschaftlichen Konzepts des Linguizismus vorgeschlagen. Das Wort „Linguizismus“, eine Form von linguistischem Rassismus, betrifft oft Menschen, die weniger privilegierte Sprachen und Sprachvarietäten in unseren globalisierten Gesellschaften sprechen. Obwohl dieses Phänomen ursprünglich meistens in englischsprachigen Kontexten untersucht wurde, hat es im Verlauf des letzten Jahrzehnts auch in Deutschland an Aufmerksamkeit gewonnen, und zwar nicht nur in akademischen Kreisen. Dies wird dadurch bestätigt, dass sich immer mehr literarische Werke der Gegenwart mit diesem Thema auseinandersetzen: Dazu zählt auch der Roman Goreliks, der im Mittelpunkt dieses Beitrags steht.
Lena Gorelik hat bereits 2004 durch ihren Debütroman Meine weißen Nächte das deutschsprachige Publikum auf sich aufmerksam gemacht. Doch während die meisten Prosatexte der mehrfach ausgezeichneten Autorin und Journalistin kaum autobiografische Bezüge enthalten, erzählt sie in ihrem neuen Roman direkt ihre eigene(n) Geschichte(n) und die ihrer Familie (Watty 2021). Um einen Vorgeschmack auf die Themen dieses Buches zu geben, sollen die folgenden Worte aus Sigrid Löfflers Rezension angeführt werden:
Es geht in „Wer wir sind“ also um Würde und Respekt, um Kulturwechsel und die Nöte der Migration, um das Ringen um Mehrfach-Identität, um gelebte, verschüttete und verlorene Traditionen, um die Unzuverlässigkeit von Familienlegenden, um Wehmut über eine vergangene und verschwundene Lebensart, um das Rätsel der Ankunft im Zufluchtsland Deutschland. (Löffler 2021)
In Wer wir sind erzählt nun die Autorin durch die Augen der gleichnamigen Protagonistin von ihrer Kindheit in Sankt Petersburg, von ihrer Familie, von der Einwanderung nach Deutschland, von ihrem Fieber im Asylantenwohnheim und von ihrer Gegenwart als Schriftstellerin, Mutter und gleichzeitig auch Tochter. Eine einfache Autobiografie ist der Roman allerdings nicht. Vielmehr inszeniert er einen narrativen und daher auch fiktiven Versuch, eine erzählerische Antwort auf die Identitätsfrage zu finden: Wer sind wir? Um die Bedeutung einer vertieften analytischen Auseinandersetzung mit diesem Roman besser verstehen zu können, sollen zuerst einige biographische Details über die Autorin erwähnt werden.
Lena Gorelik wurde 1981 in Sankt Petersburg geboren. Die jüdische Abstammung ihrer Familie hatte es ermöglicht, dass sie kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion als Kontingentflüchtling nach Deutschland einreisen durfte. In Baden-Württemberg, wo sie auch die Schule besuchte, verbrachte sie die ersten Jahre mit ihrer Familie. Später absolvierte sie in München eine journalistische Ausbildung und studierte Osteuropa-Studien (Gorelik 2022).
Ihr literarisches Talent wurde kurz nach Absolvierung der Schule auch in der Öffentlichkeit bekannt: Sie erhielt den Scheffelpreis für ihre Abiturleistung im Fach Deutsch (Scheffelbund) und im Alter von sechsundzwanzig Jahren wurde ihr zweiter Roman Hochzeit in Jerusalem (2007), dessen Titel an Hermann Grabs Erzählungen Hochzeit in Brooklyn (1955) erinnert, für den Deutschen Buchpreis nominiert (Deutscher Buchpreis 2007). Allerdings ist die Belletristik nicht das einzige Feld, in dem Lena Gorelik aktiv ist: Große Aufmerksamkeit erregte ihr 2012 erschienenes Essay Sie können aber gut Deutsch!, in dem sie die rassistische und sprachliche Diskriminierung beklagt, die viele Bürger:innen nicht-westeuropäischer Abstammung in Deutschland oft in der Öffentlichkeit erleben. Zudem ist ihr das Thema der Bedeutung des heutigen Jüdischseins wichtig, wie das ihrem Sohn gewidmete Buch Lieber Mischa…Du bist ein Jude (2011) beweist. Nach den Romanen Die Listensammlerin (2013), Null bis unendlich (2015) und Mehr Schwarz als Lila (2017) berichtet Lena Gorelik mit großer Ehrlichkeit in ihrem 2021 erschienenen autobiografischen Roman Wer wir sind von ihrer eigenen Vergangenheit und von ihrer Gegenwart. In diesem Zusammenhang sollen nachfolgend hier erzählte Spracherlebnisse in den Blick genommen werden, in denen die der Scham für die eigenen Wurzeln und des damit verbundenen Linguizismus im Mittelpunkt stehen und in diesem Roman einen breiten Nachklang finden.
Schon beim Lesen des Titels „Wer wir sind“ werden die Leser:innen über die Frage aufgeklärt, die den erzählerischen Fokus des gesamten Buches bestimmt. Der Roman kann in der Tat als ein Versuch interpretiert werden, auf diese Identitätsfrage unterschiedliche (unvollständige) Antworten durch eine Sammlung von vielfachen Episoden aus dem Leben der Protagonistin zu finden. Deutlich wird dabei vor allem die Art und Weise, wie nicht nur die Protagonistin, sondern jeder Mensch die eigenen Geschichten konstruiert und auf diese Weise die eigenen Identitäten der Vergangenheit und Gegenwart erzählerisch miteinander verwebt. So heißt es tatsächlich im Roman: „Wir merken uns das Leben in Geschichten, die sich gut erzählen lassen. Bei einem Glas Wein zum Beispiel, vor anderen Menschen. Wir bilden Legenden, wer wir sind, wie wir das geworden sind, wer wir früher einmal waren“ (Gorelik 2021: 131).
Im Mittelpunkt der Erzählung stehen die Gefühle der Scham und des Stolzes, die auf das eigene Selbst und die eigene Familie gerichtet und häufig mit Fragen von soziokultureller Zugehörigkeit zum sozialen Umfeld verflochten sind. Besonders prägend erscheint – insbesondere aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive – die Komplexität der Erfahrung der Mehrsprachigkeit, die sich am Beispiel eines anscheinend so gespalteten Lebens entfaltet, wo Sprachen als symbolische Mittel zur Identitätskonstruktion wirken. Um noch deutlicher zu machen, wie dieser Text auf konkrete Art und Weise auch zur aktuellen sprachwissenschaftlichen Forschung als narratives Zeugnis beitragen kann, sollen zunächst die Fragestellung und die methodologische Vorgehensweise bei der Analyse geklärt werden.
2. Fragestellung und Methode
Ziel dieses Beitrags ist die qualitative Erforschung des Einflusses des Linguizismus auf narrative Identitätskonstruktionen am Beispiel eines Prosatextes. Untersuchungsgegenstand ist, wie schon oben erwähnt, Lena Goreliks autobiografischer Roman, in dem den Sprachen und den damit verbundenen Spracherlebnissen eine sowohl thematisch als auch stilistisch besondere Rolle zukommt. Goreliks Narration erweist sich vor allem deshalb als so geeignet, da sie verdeutlicht, wie sich die Erfahrungen ihrer Familie in Bezug auf sprachliche und herkunftsbezogene Diskriminierung auf bestimmte Dynamiken von Scham und Stolz im alltäglichen Interaktionsbereich auswirken, d.h. dass die Erfahrung des Linguizismus einen Einfluss auf die Kommunikation und auf die Identitätskonstruktionen der Figuren innerhalb der Familie und in der Öffentlichkeit besitzt. Wenn einerseits die Auswahl eines literarischen Textes im Rahmen einer sprachbiographischen bzw. sprachanalytischen Untersuchung Anlass für Kritik sein kann, da ein Roman nicht mit einem sprachwissenschaftlich orientierten Interview vergleichbar wäre, kann diesem Kritikpunkt andererseits entgegengesetzt werden, dass auch Interviews immer auch eine gewisse Fiktionalität aufweisen können, ohne dass die interviewende Person dies bemerkt. Des Weiteren kann Literatur an sich als ein Sprachgebrauch betrachtet werden, der sich durch eine außergewöhnliche kreative Prägung auszeichnet, so dass sie durchaus – selbstverständlich mit gewisser Vorsicht – als Untersuchungsgegenstand der Sprachwissenschaft in Frage kommt. Demzufolge kann Goreliks Wer wir sind sicherlich als ein sehr geeignetes Zeugnis für individuelle Spracherlebnisse gelten.
Um die im Text aufgezeigten Spracherlebnisse analysieren zu können, soll zunächst der Linguizismus-Begriff näher beleuchtet werden. In diesem Zusammenhang werden einige textuelle Beispiele angeführt, die das Auftreten des Linguizismus im Text belegen, um den Umgang der Figuren mit den von ihnen verwendeten Sprachen zu veranschaulichen. Im Anschluss daran soll erörtert werden, inwiefern bestimmte Spracherfahrungen der Kritik an klassischen sprachlichen Zugehörigkeitsparadigmen dienen und welche Rolle die Gefühle Scham und Stolz beim Sprechen mehrerer Sprachen in der Öffentlichkeit spielen können.
3. Linguizismus – Begrifflichkeit und Konzepte
Im Laufe der Erzählung kommen häufig Episoden vor, in denen sich die Protagonistin und ihre Angehörigen dafür schämen, sich in der Öffentlichkeit in ihren Herkunftssprachen bzw. mit den daraus hervorgehenden Akzenten klar und laut auszudrücken. Hiervon sind oft die Eltern betroffen, die sich früher in der Sowjetunion von den jiddischen Wörtern der Großeltern und später in Deutschland von ihrem russischen Akzent schämen. Zum Beispiel lassen die Eltern im Restaurant ihre Tochter mit dem Personal sprechen, denn sie spricht akzentfrei Deutsch: „Wenn wir essen gehen, bestelle ich für alle, obwohl die Kellner meist erwartungsvoll meinen Vater ansehen, den Patriarchen. Bestelle für alle, es ist Ihnen am liebsten so, dass die Tochter bestellt, die ohne Akzent“ (Gorelik 2021: 245). Manchmal sind es hingegen dritte Figuren, die diese Scham vorwurfsvoll verursachen: „«Lernen Sie doch erstmal Deutsch.» Sagen sie. Zu mir nicht mehr, aber immer noch zu meinen Eltern. Mein Vater beeilt sich zu bestellen, in der Hoffnung, dass er den Kellern nicht auffällt“ (Gorelik 2021: 246).
Bereits an diesen wenigen Beispielen wird das Phänomen des Linguizismus deutlich, das bei den Sprechenden ein Schamgefühl hervorruft, auch wenn dieses nicht ausschließlich in der Sprache begründet ist, sondern auch in der Diversität anderer Eigenschaften der Familie (u.a. Essen, Gewohnheiten, Geschmack, Sichtweisen). Die Tochter schämt sich in ihrer Adoleszenz z.B. dafür, dass ihre Mutter bei ihrer ersten Arbeit in Deutschland als Putzfrau russisches Essen für die Kinder einer deutschen Familie gekocht hat: „Ich schäme mich für das russische Essen“ (Gorelik 2021: 212). Ähnlich ist ihre Reaktion auf die Gespräche der Eltern, die sich miteinander auf Russisch unterhalten, während sie am Tisch mit einem deutschen Paar sitzen, das ins Asylantenwohnheim irgendwie zum Helfen gekommen war: „Sage ich auch später, weil ich manche Geschichten meiner Eltern gar nicht übersetzen möchte“ (Gorelik 2021: 163). Unter den oben erwähnten Faktoren stellt allerdings gerade die Sprache das symbolische Medium par excellence dar, in dem die Scham für die eigenen Wurzeln zum Ausdruck kommt. Diese Scham entsteht in der Familie der Protagonistin allerdings nicht erst nach der Einwanderung nach Deutschland. Die Familie hat unter anderen Gründen die Sowjetunion wegen des sich dort verbreitenden Antisemitismus verlassen und, wie später gezeigt wird, war anscheinend das Sprechen in jiddischer Sprache in der Öffentlichkeit ein Grund für Scham. Die Erfahrung solcher Formen von sprachlich-kulturellen (und unvermeidlich auch sozial geprägten) Diskriminierungen ist in der Forschung bereits seit den 1980er Jahren unter dem Begriff „Linguizismus“ bekannt.
3.1. Linguizismus in der Forschung
Die erste Wissenschaftlerin, die das Phänomen des Linguizismus empirisch betrachtet hat, ist Tove Skutnabb-Kangas, die den Begriff folgendermaßen definiert: „ideologies, structures and practices which are used to legitimate, effectuate, regulate and reproduce an unequal division of power and resources (both material and immaterial) between groups which are defined on the basis of language” (Skutnabb-Kangas 1988: 13). Die Existenz des Linguizismus ist nun stark mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen verknüpft, indem sprachliche Diskriminierungen oft aus existierenden sozialen Ungleichheiten zwischen dominanten Sprachen und Minderheitssprachen entstehen. Dazu listen Skutnabb-Kangas und Phillipson die folgenden Faktoren auf, von denen solche Diskriminierungsphänomene abhängen: 1) welche Sprachen man spricht, 2) wie man sie gebraucht und 3) welche Sprachen man nicht kennt bzw. mit anscheinend ungenügender Kompetenz beherrscht:
Linguicism can apply to (i) which language(s) one uses; (ii) how one uses them; and (iii) which language(s) one does not use/know or is not competent in, all according to the norms of those who arrogate to themselves the power to judge others by their language/s. (Skutnabb-Kangas und Phillipson 2022: 11)
Mit anderen Worten erfolgen sprachliche Diskriminierungen in kommunikativen Kontexten, in denen Sprecher:innen dominanter Sprachen und Sprachvarietäten sich das Recht nehmen, den Gebrauch von unprivilegierten Sprachen direkt oder indirekt zu ahnden. Infolgedessen können vor allem Sprecher:innen von sozial benachteiligten Sprachen, zumeist in migrantischen Kontexten, nicht selten über einen begrenzten Zugang zum kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Kapital (vgl. Bourdieu 1986) im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft verfügen (vgl. Watkins, Razee und Richters 2012; Chang und Holm 2017; Rasi 2020). İnci Dirim definiert daher Linguizismus als „ein Instrument der Machtausübung gegenüber sozial schwächer gestellten Gruppen mit der Funktion der Wahrung bzw. Herstellung einer sozialen Rangordnung“ (Dirim 2010: 91). In Einklang mit Dirims These vertreten Skutnabb-Kangas und Phillipson die Auffassung, dass sich im Linguizismus Spuren von kolonialistischen Denkweisen und sozialen Ungleichheiten finden lassen:
Most practices that result in people getting unequal access to power and both material and immaterial resources, based on their language/s, reflect linguicism. This unequal access is often produced through attempts at colonising people’s consciousness, through three processes: glorification, stigmatisation, and rationalisation. (Skutnabb-Kangas und Phillipson 2022: 11)
Vor diesem theoretischen Hintergrund haben Sprachwissenschaftler:innen im Laufe der letzten fünf Jahre unterschiedliche Räume und Zusammenhänge beobachtet, in denen Linguizismus heute verstärkt vorkommt: im Bildungsbereich (Baker-Bell 2020; Mackenzie 2020; Nguyen 2022), im Kontakt zwischen dominanten und offiziellen Minderheitssprachen (Jean-Pierre 2018), in Bezug auf die Standardsprache und ausländische Akzente (Dovchin 2020; Dryden und Dovchin 2021) oder im Verhältnis zwischen Hochsprachen und Dialekten (Piccardi, Nodari und Calamai 2021). Obwohl alle diese Studien diskriminierende Erfahrungen bestimmter Sprechergruppen dokumentiert haben, die aus guten Gründen als Opfer von Linguizismus betrachtet werden können, haben die Forscher:innen dennoch gezeigt, dass diese Diskriminierungserfahrungen auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sind, wie beispielsweise Rassismus, Akzent, usw. Um die Vielfalt hinter dem Begriff von Linguizismus nun begreifen zu können, erscheint das Modell von Nguyen und Hajek strategisch, die den Begriff in drei Kategorien unterteilen: rassenbezogene, sprachvarietätsorientierte und generelle Diskriminierungen (z. B. im Fall von institutionalisierten Ungerechtigkeiten) (Nguyen und Hajek 2022).
Kurz zusammenfassend lässt sich demzufolge Linguizismus als Oberbegriff für sprachlich bedingte Diskriminierungsdimensionen verstehen, die durch soziokulturelle, ethnische, genderbezogene oder religiöse Faktoren bestimmt sind.
3.2. Linguizismus und Zugehörigkeitsfragen
Im Anschluss an die Erläuterung der Ausdrucksformen von Linguizismus besteht ein weiterer wichtiger Aspekt in der Darlegung der Auswirkungen dieses Phänomens auf die betroffenen Sprecher:innen. Dementsprechend hat Assimina Gouma, die Leitfadeninterviews mit Teilnehmenden eines lokalen partizipativen Projekts über emanzipatorische Sprachlernmethoden in Österreich durchgeführt hat, das sowohl Migrant:innen als auch Nicht-Migrant:innen umfasste, einige qualitativ aussagekräftige Berichte zu diesem Thema gesammelt. Sie merkt an, dass Migrant:innen in Österreich oft zu „IntegrationsverweigerInnen aufgrund ihrer sprachlichen Praktiken stilisiert werden“ (Gouma 2020: 80), Praktiken, für die sie „beschämt“ werden (Gouma 2020: 134). Die Marginalisierung bestimmter Sprecher:innen bewirkt folglich eine sprachlich bedingte Unterscheidung zwischen einem kollektiven „Wir“ und einem „Nicht-wir“, wodurch sich die vom Linguizismus betroffenen Menschen von dem kollektiven „Wir“ (bzw. der Mehrheitsgesellschaft) ausgegrenzt fühlen. Weil von Sprachen auch eine symbolische Macht ausgeht (Bourdieu 1991: 23; Kramsch 2020: 4), können unprivilegierte Sprachen von der Mehrheitsgesellschaft als Symbole von geringem sozialen Zustand rezipiert werden, so dass ihre Sprecher:innen aufgrund ihrer sozialen, kulturellen oder ethnischen Herkunft marginalisiert werden (vgl. Baumann 2021). Linguizismus kann demzufolge zu Ausgrenzungsphänomenen innerhalb der Gesellschaft bedeutsam beitragen.
Vor diesem Hintergrund scheint es nicht verwunderlich, dass Linguizismus und die daraus resultierende Marginalisierung die Entwicklung eines Gefühls von Nicht-Zugehörigkeit zur Mehrheit vergrößern kann. So zeigen beispielsweise Winstead und Congcong, wie spanisch-englischstämmige Studierende in einem monolingualen Bildungsumfeld Nordamerikas Identitätskonflikte, die durch ihre Herkunft ausgelöst werden, erleben (Winstead und Congcong 2017). Eine weitere Studie, die von Sender Dovchin (2020) realisiert wurde, legt die Benachteiligung ausländischer Studierender, mit der sie sich aufgrund ihrer Akzente konfrontiert sehen, in Australien offen ebenso wie die negativen psychologischen Folgen, die hierdurch auslöst werden, u.a. ein geringes Selbstwertgefühl und das Empfinden, nicht dazuzugehören (vgl. Dovchin 2020: 12). Zudem verdeutlicht die Untersuchung von Denise N. Obinna am Beispiel von Zuwanderer:innen und Sprecher:innen von indigenen mesoamerikanischen Sprachen in den Vereinigten Staaten, dass das Phänomen des Linguizismus sogar ein diskriminierendes Justizsystem aufrecht hält, das ihnen das Asylverfahren fast unmöglich macht (Obinna 2021).
Angesichts solcher Studien ist demnach davon auszugehen, dass die bisherige Forschung in den letzten Jahren Daten mit einer aussagekräftigen empirischen Evidenz zusammengestellt hat, aus denen deutlich hervorgeht, dass Linguizismus eine konkrete Art von Diskriminierung darstellt, die auf der gleichen Ebene von Phänomenen wie Rassismus, Ableismus usw. anzusiedeln ist. Im Rahmen dieses Beitrags soll genau diese Wahrnehmung der Spaltung zwischen „Wir“ und „Nicht-wir“ fruchtbar gemacht werden, die nicht nur die enge Verbindung zwischen persönlichen Identitätskonstruktionen und Sprachen, sondern auch die Zentralität der Mehrsprachigkeit im Zusammenhang mit dem Gefühl der sozialen Zugehörigkeit bezeugt. Dass Mehrsprachigkeit und Sprachideologien starken Einfluss auf individuelle Zugehörigkeitskonstruktionen haben können, erläutert im Übrigen auch Brigitta Busch mit den folgenden Worten:
Über Sprachideologien werden soziale, ethnische, nationale und andere Zugehörigkeiten konstruiert. In Bezug auf das sprachliche Repertoire bedeutet dies, dass die einschränkende Macht sprachlicher Kategorisierungen besonders dann wahrgenommen wird, wenn Sprache nicht wie selbstverständlich zur Verfügung steht, wenn Menschen zum Beispiel nicht als legitime Sprecher*innen einer bestimmten Sprache oder Sprechweise anerkannt werden oder sich selbst nicht als solche wahrnehmen. Das kann der Fall sein, wenn sie – zum Beispiel infolge von Migration – die sprachliche Umgebung wechseln, das heißt, wenn sie in einen sozialen Raum eintreten, in dem andere als die ihnen gewohnten sprachlichen Praktiken vorherrschen, in dem ein anderes Sprachregime (siehe Kapitel 3) Geltung hat. (Busch 2021: 31)
4. Phono-artikulatorische Merkmale und Scham
Wie bereits zuvor erwähnt, sind im Roman mehrere Anekdoten zu finden, die entweder direkt oder indirekt auf Linguizismus Bezug nehmen. In der folgenden Analyse wird gezeigt, wie einige Figuren ein Schamgefühl für ihren eigenen Sprachgebrauch entwickeln, um eine mögliche Ausgrenzung bzw. soziokulturelle Stigmatisierung abzuwehren. Dies soll im Folgenden anhand einiger ausgewählter Textstellen dargestellt und vor dem Hintergrund des oben erläuterten Linguizismus-Konzeptes diskutiert werden.
4.1. Das „ungerollte «R»“ im Russischen
Ich kenne ein Foto von meiner Mutter als Mädchen, habe ihren dicken, festen Zopf aus Locken auf diesem Foto gesehen und Geschichten gehört, in denen die anderen Kinder sie auslachten, weil das Mädchen ein jüdisches war und das «r» nicht richtig aussprechen konnte, was, so sagte man mit absoluter Überzeugung in der Sowjetunion, den Juden selten gelang. Ich erbte das ungerollte «r» von ihr und von all den anderen Jüdinnen und Juden. Sie schleppte mich geduldig von Logopäde zu Logopädin, um mir ihre eigene Demütigung zu ersparen, und ich tue genau das mit meinen Kindern, ihnen meine Demütigungen zu ersparen, und wahrscheinlich werden sie das mit ihren Kindern ebenfalls tun. (Gorelik 2021: 137)
Nicht zuletzt wegen der sich weit verbreitenden antisemitischen Gefühle haben viele jüdische Familien in den 1990er Jahren die Sowjetunion verlassen, um nach Westeuropa auszuwandern. Einige historische Studien zum Antisemitismus in der Sowjetunion beweisen, wie oft sich die jüdische Bevölkerung dort mit Antisemitismus konfrontiert sah. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist die Studie von Mstoiani und Glöckner: Anhand von narrativen Interviews mit Menschen jüdischer Abstammung, die seit 1990 aus der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten ausgewandert sind, wird hier deutlich, dass „die seit Mitte der 1990er Jahre aufkeimenden nationalistischen Umtriebe“ als „existentiell bedrohlich“ empfunden wurden (Mstoiani und Glöckner 2015: 262). Andere Studien belegen jedoch, dass Antisemitismus in der Geschichte der Sowjetunion sogar in mehreren Fällen direkt vom Staat gefördert wurde. Salomon M. Schwarz zeigte z.B. in seiner Studie aus dem Jahr 1949, dass die jüdischen Bürger:innen der Sowjetunion für „NEP-Schieber“ gehalten wurden (Schwarz 1949: 253), d.h. für Gegner der von Lenin und Trotzki unterstützten Neuen Ökonomischen Politik (1921-1928), die eine Dezentralisierung der Landwirtschaft, des Handels und der Industrie anstrebte. Die Umsetzung dieser Politik hatte negative Folgen auf den sozioökonomischen Zustand vieler jüdischen Bürger:innen (Kagedan 1985: 120), die daher für Gegner der NEP gehalten waren. Sehr viel aktueller ist hingegen die historiographische Analyse von Antonella Salomoni, in der dokumentiert wird, wie Antisemitismus in der Nachkriegszeit in der Sowjetunion nochmals direkt durch den Staat gefördert wurde, indem Stalin die Presse und die Buchindustrie in jiddischer Sprache unterdrückte und die Auflösung des Netzes der überlebenden Kultureinrichtungen anordnete (Salomoni 2010). Man kann daher davon ausgehen, dass die von der Mutter der Protagonistin erlebte Judenfeindlichkeit eine historisch belegte Realität darstellte und sich auch durch die Vorurteile hinsichtlich sprachlicher Aspekte manifestierte. Die Mutter der Protagonistin schämte sich deshalb für ein eigenes phono-artikulatorische Merkmal, das in einer antisemitischen Gesellschaft diskriminierend für ein „Kennzeichen“ von Juden gehalten war, nämlich das „ungerollte «r»“.1
Der oben präsentierte Textausschnitt zeigt außerdem, wie Menschen mit jüdischer Abstammung während der Kindheit der Mutter von dem oben erwähnten kollektiven „Wir“ auch sprachlich ausgeschlossen waren. Diesbezüglich schreiben Schwarz-Friesel und Reinharz: „Antisemitism thus signifies exclusion of Jews and Judaism by labeling them as the absolute and total negation of the world order defined as normal” (Schwarz-Friesel und Reinharz 2017: 19). Tatsächlich werden den in antisemitischen Interaktionen betroffenen Sprecher:innen sprachliche ethnoreligiöse Vorurteile zugeschrieben, denen eine bewusste Intention zugrunde liegt zu beleidigen und auszugrenzen. Man könnte anhand des narrativen Beispiels Goreliks über ein herrschendes Sprachregime (Coulmas 2005) sprechen, in dem phonetische Stereotype als das Judentum prägende Shibboleth stilisiert werden, nämlich als sprachliches Merkmal „used to assign someone to a particular social group or region“ (Busch 2015: 7).
In Anbetracht solcher theoretischen Überlegungen veranschaulicht der Text, wie die von der Mutter erlebte Marginalisierung ein Gefühl von Scham erregt, das sie in dieser Weise womöglich als Reaktion auf ihre Exklusion erlebt haben könnte. Dass eine solche Exklusion aufgrund sprachlich-kultureller Merkmale in anderen sprachlich-kulturellen Kontexten hingegen von Vorteil sein könnte, bringt der anschließende ironische Kommentar der Tochter eindrucksvoll zum Ausdruck:
Was für ein Glück das war, dass ich das rollende «r» niemals bewerkstelligt hatte, im Nachhinein beinahe ein Zeichen. Dass ich deshalb Deutsch klinge, sagt sie, als hätten sich mit dieser Fähigkeit alle weiteren Anstrengungen eines Lebens erübrigt. (Gorelik 2021: 138)
4.2. Der russische Akzent im Deutschen
Allerdings sind die Hauptfiguren des Romans nicht nur in der Sowjetunion vom Phänomen des Linguizismus betroffen. Auch in Deutschland werden die Eltern für ihre Sprache getadelt:
Wenn wir essen gehen, bestelle ich für alle, obwohl die Kellner meist erst erwartungsvoll meinen Vater ansehen, den Patriarchen. Bestelle für alle, es ist ihnen am liebsten so, dass die Tochter bestellt, die ohne Akzent. Die Tochter ohne Akzent will ihre Eltern zurück, die ihr die Welt erklären, die mehr verstehen als sie. (Gorelik 2021: 246)
Während die Scham aus den vorigen Beispielen durch ethnoreligiöse Vorurteile ausgelöst wird, ist der letzte Ausschnitt hingegen Beweis dafür, dass der Linguizismus auch rein sprachvarietätsbezogene Gründe haben kann. Anhand dieses Beispiels lässt sich in der Tat eindeutig ablesen, dass sich die Eltern in Deutschland für ihren Akzent schämen, wenn sie die deutsche Sprache in der Öffentlichkeit sprechen. Zwar liegt in diesem Fall keine wirkliche Diskriminierung vor, denn die Eltern wurden vom Kellner nicht direkt zurechtgewiesen. Vielmehr sind es ihre vergangenen Diskriminierungserfahrungen, die sie dazu veranlassen, sich weiterhin wegen ihres Sprachgebrauchs zu schämen: „»Lernen Sie doch erst mal Deutsch.« Sagen sie. Zu mir nicht mehr, aber immer noch zu meinen Eltern. Mein Vater beeilt sich zu bestellen, in der Hoffnung, dass er den Kellner nicht auffällt.“ (Gorelik 2021: 246)
Auch in Deutschland müssen die Eltern demzufolge eine Marginalisierung erdulden, die sie aus einer imaginierten sprachlich-kulturellen Mehrheit ausgrenzt; eine Marginalisierung, die die Tochter nur anfänglich berührt, wenn sie z. B. mit der Familie nach Sankt Petersburg zurückfährt: „Da bin ich nicht mehr dabei, fürchte, mich für mein Russisch schämen zu müssen“ (Gorelik 2021: 172). Im Laufe dieser ersten Phase erwirbt die Tochter die deutsche Sprache schneller als ihre Eltern. So erzählt sie von ihrem Telefonat mit ihnen, als sie bei der Farmerin Anita ist, die mit ihr nur auf Schwäbisch redet: „Die Entfremdung lässt sich an den deutschen Worten abmessen, die sich im russischen Erzählschwall selbstbewusst breitmachen, bis sie sich nicht mehr messen lässt. Unsere Eltern hören zu, quetschen Nachfragen dazwischen: „Wann kommt ihr wieder?““ (Gorelik 2021: 186). Die Entfremdung lässt sich darum in der Kommunikation zwischen Kind und Eltern abmessen, wo die Eltern die Distanz sowohl von ihrer Tochter als auch von dem deutschsprachigen Umfeld spüren. Dem Schamgefühl kommt nun die Funktion einer emotionalen Reaktion auf die implizite Bedrohung von Nicht-Zugehörigkeit zu2, die durch den Linguizismus durchaus explizit bestärkt werden kann.
4.3. Jiddisch als Quelle von Scham und Stolz
Eine weitere Sprache, die in der Erzählung eine quantitativ nur marginale Rolle einnimmt, deren Präsenz in diesem Roman jedoch aufschlussreiche Überlegungen zum Thema Linguizismus anbietet, ist das Jiddische. Der Umgang des sowjetischen Staates mit dem Jiddischen war nicht immer von Toleranz geprägt, wie Miriam Weinstein anmerkt: „In Mütterchen Russland und in ihrem Nachfolgestaat, der Sowjetunion wurde Jiddisch oft erniedrigt, gepriesen und ausgebeutet – je nach den plötzlichen und anscheinend irrationalen Wandlungen in der Politik, die ein Kennzeichen des Landes waren“ (Weinstein 2003: 113). Insbesondere vor Stalins Tod war das Jiddische politisch unterdrückt, als die Regierung eine antisemitische Kampagne führte, für die u.a. die Ärzteverschwörung vom Jahr 1953 ein deutlicher Beweis ist (vgl. Brent und Naumov 2003). Außerdem war von den 1960er bis Mitte der 1980er Jahre in der Sowjetunion nur eine einzige Zeitschrift namens Sovetish Heymland offiziell berechtigt, ihre Beiträge auf Jiddisch zu veröffentlichen (Chernin 1995; Estraikh 2008).
Angesichts der unprivilegierten Rolle des Jiddischen innerhalb der Sowjetunion lässt sich erschließen, dass sich die Mutter für diese Sprache schämte: „Meine Mutter schämte sich für ihre Großmutter, des Jiddisch wegen, wegen Koseworten wie diesem [mej Vejgele]“ (Gorelik 2021: 138). Möglicherweise verfügte das Jiddische im damaligen Sankt Petersburg über einen defizitären sozialen Wert, für den sich die Mutter schämen musste: „Sie schämte sich, erzählt meine Mutter, schämte sich ihrer Großmutter und deren Jiddisch, des jüdischen Honigkuchens, den sie jetzt nachzubacken versucht“ (Gorelik 2021: 288-289). Hinzu kommt noch, dass die Eltern ihre jüdische Abstammung im Allgemeinen versteckt zu halten versuchten, wie das folgende Beispiel zeigt: „Wir sind Juden?“ „Pst, schrei doch nicht so“ […] “Und sag das niemandem“ (Gorelik 2021: 196). Zusammenfassend lässt sich demnach also schlussfolgern, dass der persönliche Umgang der Eltern mit dem Jiddischen eher privat erfolgte und durch Scham geprägt war, zumindest in der Zeit, als sie noch in der Sowjetunion lebten.
Aus den bisher kommentierten Episoden lässt sich feststellen, dass sich der Linguizismus negativ auf den Umgang der Eltern mit ihren Sprachen und demzufolge auch auf ihr Zugehörigkeitsgefühl ausgewirkt haben dürfte. Allerdings kann der Umgang mit Sprachen auch durch Stolz geprägt sein, was im Folgenden näher ausgeführt werden soll. Zudem bewirkt die Auswanderung neue Umgangsformen mit dem eigenen Sprachrepertoire, wie aus dem folgenden Beispiel hervorgeht, in dem die Mutter nach der Auswanderung nach Deutschland tatsächlich ein anderes Verhältnis zu ihrer jüdischen Identität entwickelt:
Meine Mutter spricht vom Schtetl, ein echtes Schtetl, es schwingt Stolz in ihrer Stimme, wenn sie das sagt, als wären wir damit richtige Juden. Mein Urgroßvater trug Pejes, Schläfenlocken, auch das sagt sie so, in breitem Jiddisch, für das sie sich in Russland geschämt hatte, auf das sie in Deutschland stolz ist. (Gorelik 2021: 288)
Sogar die Großmutter (Бабушка, Babuschka) nimmt das Jiddische in der Kommunikation in der Öffentlichkeit problemlos in Anspruch. So berichtet sie beispielsweise, dass sie sich bei ihren täglichen Spaziergängen im Park mit einem Mann, den sie „den Türken“ nennt, auf Jiddisch unterhält: „«Er kann kein Deutsch», erzählt sie uns. Sie spricht Jiddisch mit ihm, oder sie sprechen gar nicht. Vielleicht nicken sie sich auch nur zu, lächeln, «dieser Türke» und sie“ (Gorelik 2021: 80).
4.4. Lenas Scham und Stolz
Die Protagonistin Lena bleibt von der sprachlich-kulturellen Scham jedenfalls nicht verschont. Die starke Entfremdung, die sie in Deutschland spürt, kommentiert sie auf folgende Weise.: „Das Anderssein ist beige, ist hässlich, ist ich“ (Gorelik 2021: 159). Anfänglich versucht sie sich von der Identität der Eltern zu distanzieren, indem sie z. B. auf einer Hochzeit so oft wie möglich auf Schwäbisch zu reden versucht:
Der Hund ist in Russland geblieben, wir sind jetzt hier, sind gerade erst nach Deutschland gekommen, und nun, nur wenige Monate nach der Ankunft, auf einer deutschen Hochzeit. Wirft sie einfach ins Gespräch, meine Mutter, um zu offenbaren, wer ich eigentlich bin. Ich versuche, möglichst einwandfreies Schwäbisch zu sprechen.“ (Gorelik 2021: 165)
Sie spricht im lokalen Dialekt, um sich der sprachlichen Mehrheit anzugleichen und auf diese Weise eine soziale Zugehörigkeit zu konstruieren. Auf der anderen Seite empfindet Lena jedoch ein Schamgefühl, als sie nach Russland fährt und sich dort ihrer scheinbar unzureichenden Russischkenntnisse bewusstwird: „Da bin ich nicht mehr dabei, fürchte, mich für mein Russisch schämen zu müssen.“ (Gorelik 2021: 172)
Dieser Zustand des Dazwischen erfährt die Protagonistin intensiv in der ersten Hälfte der Erzählung, bis sie schließlich einen Ausweg findet. Dieser Ausweg besteht im Wesentlichen darin, auf die Anpassung an kulturelle und nationale Standards zu verzichten und sich selbst als Mensch zu akzeptieren, unabhängig von externen Bestimmungen. Nur so kann sie sich von der Scham befreien:
-
„Dauert zu lang, bis ich meine Eltern zu schützen beginne. Bis ich mich vor sie stellen kann, bis die Scham weicht“ (Gorelik 2021: 249);
-
„Ich muss diese Stadt von Gleis 16 verlassen, um zu verstehen, dass ich mich nicht schämen muss, und um zu verstehen und stolz und froh darüber sein zu können, wie viel ich von ihnen lernte, meinen Eltern“ (Gorelik 2021: 240);
Auf einer weiteren Reise nach Russland muss sich die Tochter nicht mehr für ihr Russisch schämen bzw. durch den Gebrauch der Sprache beweisen, ob sie dort hingehören darf oder nicht: „Mein Russisch ist vollkommen in Ordnung, und ich habe bereits aufgegeben, was ich mir vorgenommen hatte: hier möglichst mit deutschem Akzent zu sprechen, damit niemand vergisst, wer ich jetzt bin, eine aus Deutschland“ (Gorelik 2021: 220).
So erlebt die Protagonistin Lena eine lange Phase der Aushandlung ihrer sprachlich-sozialen Selbstverortung, an deren Ende das ursprüngliche Interesse an einer national-kulturell bestimmten Zugehörigkeit verblasst. Im Gegensatz zu ihren Eltern erwirbt sie schneller nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch die lokale Varietät und ist auf diese Weise zunehmend weniger Linguizismuserscheinungen ausgesetzt.
5. Schlussfolgerungen
Das Thema der sozial-kulturellen Zugehörigkeit nimmt in Lena Goreliks Roman Wer wir sind einen großen Raum ein. Eine bedeutende Rolle spielt dabei die Selbstverortung der zentralen Hauptfiguren innerhalb ihres sozialen Umfelds, die im Rahmen der Spaltung und dem Spannungsverhältnis zwischen dem kollektiven „Wir“ und dem „Nicht-Wir“ ihre Identität kritisch hinterfragen müssen. Diese Spaltung, mit der insbesondere die Eltern konfrontiert sind, wird vom Linguizismus besonders verstärkt.
Es ist offensichtlich, dass Linguizismus einen bedeutenden Einfluss auf die eigene Identitätskonstruktion ausübt und in der Lage ist, Gefühle wie Scham und Stolz zu bewirken, je nach der persönlichen Reaktion der Sprecher:innen auf ihre eigenen Spracherlebnisse. In dieser Hinsicht verdeutlichen die in diesem Beitrag analysierten Textstellen, dass Dynamiken von Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit durch eine enge Verbindung mit Sprachen, Sprachideologien und Sprachrepertoires bedingt sind. Zugehörigkeit soll daher sprachwissenschaftlich nicht unbedingt als positiver Prozess der Verbindung des Individuums mit einer soziokulturellen Gruppe konzipiert werden, sondern vielmehr in weiteren Sinne als eine Art von Bindung, die bei den Sprecher:innen auch Scham auslösen kann. Zugehörigkeit kann schließlich auch vom Individuum negativ bewertet werden. Bedeutende Spracherlebnisse wie die Auswanderung und die Transponierung in ein anderes kommunikatives Umfeld können (müssen aber nicht) die eigene Selbstverortung beeinflussen.
Des Weiteren verweisen die besprochenen Beispiele in Bezug auf den Linguizismus auf zwei unterschiedliche Perspektiven: zum einen die Perspektive der Tochter auf ihre Eltern, insbesondere auf ihre Mutter, die der Scham und dem Linguizismus viel länger ausgesetzt sind; zum anderen die selbstreflektierende Perspektive der Tochter, die sich mit ihrer sozialen Verortung aktiv und kritisch auseinandersetzt und versucht, sich von Diskriminierungserfahrungen nicht beeinflussen zu lassen. Die Identität wird somit zu einem fluiden Konstrukt, in dem Sprachen eine mitgestaltende Rolle spielen (können).
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Lena Gorelik, Wer wir sind. Rowohlt, 2021.
Sekundärliteratur
Baker-Bell, April. „Dismantling Anti-Black Linguistic Racism in English Language Arts Classrooms: Toward an Anti-Racist Black Language Pedagogy.“ Theory into Practice, 59(1), 2020, 8-21, https://doi.org/10.1080/00405841.2019.1665415.
Baumann, Beate. “Il potere del plurilinguismo. Riflessioni su lingua e lingue nel contesto delle società (post)migratorie.” Studi Comparatistici, 25(1), 2020, 59-82.
Bourdieu, Pierre. Language and symbolic power. Harvard University Press, 1991.
Bourdieu, P. “The forms of capital.” Handbook of theory and research for the sociology of education, hearusgegeben von J. G. Richardson, Greenwood Press, 1986, 241-258.
Busch, Brigitta. Linguistic repertoire and Spracherleben, the lived experience of language. King’s College London, 2015.
Busch, Brigitta. Mehrsprachigkeit. UTB, 2021.
Chang, Chia-Chien, und Gunilla Holm. „Perceived challenges and barriers to employment: The experiences of University educated Taiwanese women in Finland.“ Immigrants and the labour markets, herausgegeben von Elli Heikkilä, Migration Institute of Finland, 2017, 161-176.
Chernin, Velvel. „Institutionalized Jewish Culture in the 1960s to the mid-1980s.“ Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union, herausgegeben von Yaacov Ro’I , Frank Cass, 1995, 226-236.
Coulmas, Florian. “Changing language regimes in globalizing environments.” International Journal of the Sociology of Language, 175, 2005, 3-15, https://doi.org/10.1515/ijsl.2005.2005.175-176.3.
Deutscher Buchpreis, “ dbp 2007. Roman des Jahres, Shortlist, Longlist und die Jury des Deutschen Buchpreises von 2007“, 2007, https://www.deutscher-buchpreis.de/archiv/jahr/2007#tab-longlist (zuletzt abgerufen am 19.05.2023).
Dirim, İnci. „„Wenn man mit Akzent spricht, denken die Leute, dass man auch mit Akzent denkt oder so.“ Zur Frage des (Neo-)Linguizismus in den Diskursen über die Sprache(n) der Migrationsgesellschaft.“ Spannungsverhältnisse. Assimilationsdiskurse und interkulturell-pädagogische Forschung, herausgegeben von Paul Mecheril, Inci Dirim, Mechtild Gomolla, Sabine Hornberg und Krassimir Stojanov, Waxmann, 2010, 91-113.
Dovchin, Sender. “The psychological damages of linguistic racism and international students in Australia.” International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 23, 2020, 1-15, https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1759504.
Dryden, Stephanie, und Sender Dovchin. “Accentism: English LX users of migrant background in Australia.” Journal of Multilingual and Multicultural Development, 2021, 1-13, https://doi.org/10.1080/01434632.2021.1980573.
Estraikh, Gennady. “The era of Sovetish Heymland: Readership of the Yiddish press in the former Soviet Union.” East European Jewish Affairs, 25(1), 1995, 17-22, https://doi.org/10.1080/13501679508577792.
Gorelik, Lena. „Zur Person.”, 2022, https://www.lenagorelik.de/zur-person (zuletzt abgerufen am 19.05.2023).
Gouma, Assimina. Migrantische Mehrsprachigkeit und Öffentlichkeit. Linguizismus und oppositionelle Stimmen in der Migrationsgesellschaft. Springer, 2020.
Jean-Pierre, Johanne. “The Experiences of and Responses to Linguicism of Quebec English-Speaking and Franco-Ontarian Postsecondary Students.” Canadian review of sociology = Revue canadienne de sociologie, 55(4), 2018, 510-531, https://doi.org/10.1111/cars.12220.
Kagedan, Allan L. “Soviet Jewish Territorial Units and Ukrainian-Jewish Relations.” Harvard Ukrainian Studies, 9 (1/2), 1985, 118-132, https://www.jstor.org/stable/41036135.
Kramsch, Claire. Language as Symbolic Power (Key Topics in Applied Linguistics). Cambridge University Press, 2020.
Irvine, Judith T. und Susanne Gal. “Language ideology and linguistic differentiation.” Regimes of language: Ideologies, polities, and identities, herausgegegben von P. V. Kroskrity, School of American Research Press, 2000, 35-84.
Leary, Mark R. “Motivational and Emotional Aspects of the Self.” Annual Review of Psychology, 58(1), 2007, 317-344, https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085658.
Lewis, Michael. “Self-Conscious Emotions.” American Scientist, 83(1), 1995, 68-78. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/29775364.
Lippi-Green, Rosina. “Language Ideology and Language Prejudice.” Language in the USA: Themes for the Twenty-First Century, herausgegeben von Edward Finegan und John R. Rickford, Cambridge University Press, 2004, 289-304.
Löffler, Sigrid. “Lena Gorelik: ‘Wer Wir Sind’ – Ein Glasschränkchen Als Schrein.” Deutschlandfunk Kultur, https://www.deutschlandfunkkultur.de/lena-gorelik-wer-wir-sind-ein-glasschraenkchen-als-schrein-100.html (zuletzt abgerufen am 19.05.2023).
Mackenzie, Lee. “Discriminatory job advertisements for English language teachers in Colombia: An analysis of recruitment biases.” TESOL Journal, 12(1), 2021, 1-21, https://doi.org/10.1002/tesj.535.
May, Michelle. “Shame! A System Psychodynamic Perspective.” The Value of Shame, herausgegeben von Elisabeth Vanderheiden und Claude-Hélène Mayer, Springer, 2017, 43-59, https://doi.org/10.1007/978-3-319-53100-7_2.
Mstoiani, Khatuna und Olaf Glöckner. ““Ich bin Mensch, und ich bin jüdischer Abstammung, das ist gut so, ja.“: Antisemitismuserfahrungen russischsprachiger Juden in der UdSSR, ihren Nachfolgestaaten und in der Wahlheimat Deutschland.“ Zeitschrift Für Religions- Und Geistesgeschichte, 67(3/4), 2015, 259-277, https://www.jstor.org/stable/43973995.
Nguyen, Thang Thi Thuy. “Educational linguicism: linguistic discrimination against minority students in Vietnamese mainstream schools.” Lang Policy, 21, 2022, 167-194, https://doi.org/10.1007/s10993-021-09601-4.
Obinna, Denise N. “Alone in a Crowd: Indigenous Migrants and Language Barriers in American Immigration.” Race and Justice, 0(0), 2021, 1-18, https://doi.org/10.1177/21533687211006448.
Piccardi, Duccio, Rosalba Nodari und Silvia Calamai. “Linguistic insecurity and discrimination among Italian school students.” Lingua, 269, Aufsatz Nr. 103201, 2022, https://doi.org/10.1016/j.lingua.2021.103201.
Rasi, Sasan. “Impact of Language Barriers on Access to Healthcare Services by Immigrant Patients: A Systematic Review.” Asia Pacific Journal of Health Management, 15(1), 2020, 35-48, https://doi.org/10.24083/apjhm.v15i1.271.
Salomoni, Antonella. “State-Sponsored Anti-Semitism in Postwar USSR. Studies and Research Perspectives in Jews in Europe after the Shoah. Studies and Research Perspective.” Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of the Fondazione CDEC, 1, 2010, http://www.doi.org/10.48248/issn.2037-741X/728.
Scheff, Thomas J. “Shame in Self and Society.” Symbolic Interaction, 26, 2003, 239-262, https://doi.org/10.1525/si.2003.26.2.239.
Scheffelbund, “Bekannte Scheffel-Preisträger – Beispiele“, https://web6.karlsruhe.de/Kultur/MLO/scheffel-preistraeger/ (zuletzt abgerufen am 19.05.2023).
Schwarz, Solomon M. “Der Antisemitismus in der UdSSR.” Ost-Probleme, 1(9), 1949, 251-260, http://www.jstor.org/stable/44922315.
Schwarz-Friesel, Monika, und Jehuda Reinharz. Inside the antisemitic mind: the language of Jew-Hatred in contemporary Germany. Brandeis University Press, 2017.
Skutnabb-Kangas, Tove. “Multilingualism and the education of minority children.” Minority Education: From Shame to Struggle, herausgegeben von Tove Skutnabb-Kangas und Jim Cummins, Multilingual Matters, 1988, 9-44.
Skutnabb‐Kangas, Tove, und Robert Phillipson. „Introduction: Establishing Linguistic Human Rights.“ The Handbook of Linguistic Human Rights, herausgegeben von T. Skutnabb-Kangas und R. Phillipson, John Wiley & Sons, 2022, 1-21.
Watkins Paula G., Husna Razee und Juliet Richters. “I’m Telling You … The Language Barrier is the Most, the Biggest Challenge”: Barriers to Education among Karen Refugee Women in Australia.” Australian Journal of Education, 56(2), 2012, 126-141, https://doi.org/10.1177/000494411205600203.
Watty, Christine. “Lena Gorelik über „Wer wir sind“ Zwischen Assimilation und Ablehnung.“ Deutschlandfunk Kultur, 2021, https://www.deutschlandfunkkultur.de/lena-gorelik-ueber-wer-wir-sind-zwischen-assimilation-und-100.html (zuletzt abgerufen am 19.05.2023).
Weinstein, Miriam. Jiddisch. Eine Sprache reist um die Welt. Aus dem Englischen übersetzt von Mirjam Pressler, Kindler, 2003.
Winstead, Lisa und Wang Congcong. „From ELLs to Bilingual Teachers: Spanish-English Speaking Latino Teachers‘ Experiences of Language Shame & Loss.“ Multicultural Education, 24, 2017, 16-25, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1162651.pdf.
1 Zum Thema Sprachideologie und sprachliche Vorurteile, vgl. Irvine und Gal 2000 und Lippi-Green 2004.
2 Auch in einigen psychologischen Ansätzen zum Thema Scham wird diese als Reaktion entweder auf eine Bedrohung von sozialer Ausgrenzung oder geringem sozialen Zustand verstanden (vgl. Scheff 2003; Leary 2007; May 2017) oder generell auf Misserfolg in Bezug auf eigene Normen, Regeln und Ziele (Lewis 1995: 71).