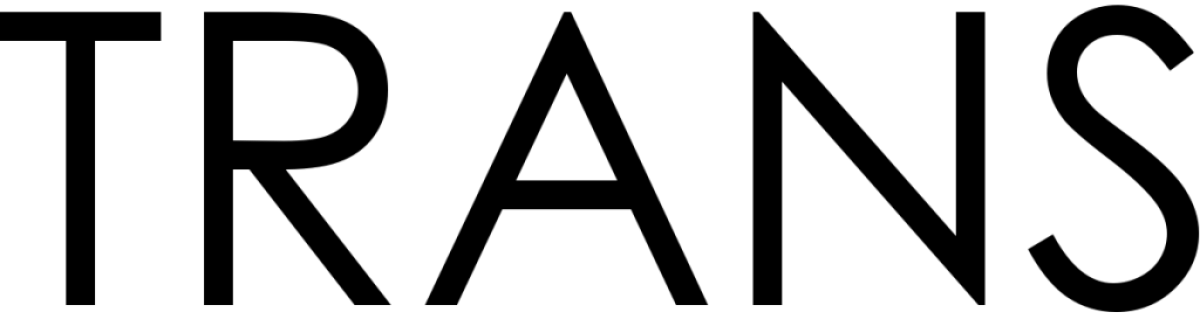Sandra Vlasta
(Università degli Studi di Genova)
sandra.vlasta@unige.it
Abstract
Jhumpa Lahiri erhielt im Jahr 2000 den Pulitzer Prize for Fiction für ihr erstes Buch, den Kurzgeschichtenband Interpreter of Maladies (1999), und gilt seither als eine der wichtigsten amerikanischen GegenwartsautorInnen. 2011 beschloss sie, mit ihrer Familie nach Rom zu ziehen, wo sie In altre parole (2015), ein Buch über ihre Erfahrung mit der italienischen Sprache, auf Italienisch schrieb. Sie beschloss, fortan nur mehr auf Italienisch zu schreiben und hat bislang einen Roman, Erzählungen, Gedichte sowie Essays in dieser Sprache veröffentlicht.
Der Beitrag zeichnet den Weg dieser mehrsprachigen Autorin nach, die in den letzten Jahren zudem als Übersetzerin und Selbstübersetzerin vom Italienischen ins Englische wieder zu ihrer ersten Literatursprache zurückgekehrt ist. In meiner Analyse konzentriere ich mich auf den Zusammenhang zwischen Lahiris Mehrsprachigkeit und ihrer Übersetzertätigkeit, denn erst durch das Schreiben auf Italienisch wurde Lahiri zur Übersetzerin und schließlich zur Selbstübersetzerin. In diese Überlegungen beziehe ich die poetologischen Reflexionen der Autorin als (Selbst-)Übersetzerin sowie ihre Rezeption mit ein.
Jhumpa Lahiri ha vinto il Pulitzer Prize for Fiction nel 2000 per il suo primo libro, la raccolta di racconti Interpreter of Maladies (1999), e da allora è considerata un’importante scrittrice americana contemporanea. Nel 2011 ha deciso di trasferirsi a Roma con la famiglia, dove ha scritto In altre parole (2015), un libro che racconta la sua esperienza con la lingua italiana. Da allora ha deciso di scrivere solo in italiano e finora ha pubblicato un romanzo, racconti, poesie e un saggio in questa lingua.
Il presente contributo ripercorre il percorso dell’autrice, che negli ultimi anni è tornata alla sua prima lingua letteraria come traduttrice e autotraduttrice dall’italiano all’inglese. Nell’analisi, mi concentro sul legame tra il multilinguismo di Lahiri e il suo lavoro di traduttrice: è, infatti, solo scrivendo in italiano che Lahiri diventa, prima, traduttrice e, infine, autotraduttrice. Il presente studio si concentrerà in particolare sulle riflessioni poetologiche dell’autrice come (auto)traduttrice e sulla ricezione della sua opera.
Jhumpa Lahiri won the Pulitzer Prize for Fiction in 2000 for her first book, the short story collection Interpreter of Maladies (1999), and has since been considered an important contemporary American writer. In 2011, she decided to move to Rome with her family, where she wrote In altre parole (2015), a book about her experience with the Italian language, in Italian. She decided to write only in Italian from then on and so far has published a novel, stories, poems and essays in that language.
This article traces the path of this multilingual author, who in recent years has also returned to her first literary language as a translator and self-translator from Italian into English. In my analysis, I focus on the connection between Lahiri’s multilingualism and her work as a translator, because it was only through writing in Italian that Lahiri became a translator and finally a self-translator. In these considerations, I include the poetological reflections of the author as a (self-)translator as well as her reception.
Einleitung1
Jhumpa Lahiri war von Beginn ihrer Karriere eine erfolgreiche Schriftstellerin. Ihr erstes Buch, die Kurzgeschichtensammlung Interpreter of Maladies (1999), wurde sowohl von der Literaturkritik als auch von der breiten Öffentlichkeit sehr positiv aufgenommen. Im Jahr 2000 erhielt sie den Pulitzer-Preis für Belletristik und ist seither als bedeutende amerikanische Autorin anerkannt.
Nach einem längeren Aufenthalt mit ihrer Familie in Rom Anfang der 2010er Jahre traf Lahiri eine überraschende und mutige Entscheidung: Sie beschloss, fortan nur noch auf Italienisch zu schreiben. Im Gegensatz zu anderen AutorInnen – sowohl zeitgenössischen als auch historischen –, die aufgrund von Exil oder Flucht von einer Sprache zur anderen wechselten (wie Milan Kundera, Ágota Kristóf und viele andere) oder weil ihre erste(n) Sprache(n) es ihnen nicht erlaubte(n), eine breitere Leserschaft anzusprechen (wie die Nobelpreisträger Wole Soyinka und Adulrazak Gurnah), wechselte Lahiri ohne besonderen äußeren Druck vom Englischen zum Italienischen. Auf diese Weise kehrte sie der dominierenden Sprache der Weltliteratur den Rücken, um auf Italienisch zu schreiben, einer Sprache, die sowohl in Bezug auf die Anzahl der SprecherInnen (d. h. der potenziellen LeserInnen) als auch in Bezug auf literarische Übersetzungen (im Vergleich zu den gängigeren Ausgangssprachen wie Englisch und Französisch) eine untergeordnete Rolle spielt.
Im Folgenden zeichne ich Lahiris Weg von einer (vermeintlich, wie wir sehen werden) einsprachigen Schriftstellerin zur mehrsprachigen Autorin und Übersetzerin/Selbstübersetzerin nach. Diese Entwicklung, so meine These, wurde stark von ihren Erfahrungen mit literarischer Mehrsprachigkeit beeinflusst bzw. überhaupt erst ausgelöst. Erst nachdem sie begonnen hatte, auf Italienisch zu schreiben, wurde sie zur Übersetzerin, zunächst von Werken anderer, dann auch von eigenen Texten. Das gleiche gilt für ihre Rezeption: Obwohl ihr literarisches Werk schon immer stark von Mehrsprachigkeit geprägt gewesen war, wurde dies von der Kritik erst seit ihrer Hinwendung zum Italienischen erkannt.
Wie ich zeigen werde, war Lahiri von Anfang an eine translinguale Schriftstellerin – d. h. nach der Definition von Steven Kellman (2000) eine Schriftstellerin, die in einer Sprache schreibt, die nicht ihre erste ist, oder die in vielen Sprachen schreibt. In der Tat bewegt sie sich zwischen mindestens drei Sprachen: Bengali, Englisch und Italienisch. Wir könnten auch Latein und Griechisch zu dieser Liste hinzufügen, da sich Lahiri für ihr aktuelles Projekt der Übersetzung von Ovids Metamorphosen mit diesen klassischen Sprachen auseinandersetzt (hauptsächlich Latein, aber eben auch Griechisch). Parallel zu ihrer Übersetzertätigkeit hat Lahiri begonnen, sich in ihren poetologischen Kommentaren in Zeitschriftenartikeln, Essays und Vorträgen (die kürzlich in einem Band mit dem Titel Translating Myself and Others, 2022, zusammengefasst wurden) als mehrsprachige Dichterin und Übersetzerin zu positionieren.
In diesem Beitrag analysiere ich nach einer kurzen Vorstellung der Autorin ihren Werdegang von der Schriftstellerin zur Selbstübersetzerin. Ich stelle die Frage, ob wir erstens von einer translingualen Wende und zweitens von einer übersetzerischen Wende in Lahiris Karriere als Schriftstellerin sprechen können. Ich interessiere mich besonders dafür, wie sie sich als mehrsprachige Dichterin und Übersetzerin positioniert und wie sie von den Verlagen und der Literaturkritik als solche positioniert wird.
Jhumpa Lahiri
Jhumpa Lahiri wurde 1967 in London geboren und wuchs in den USA auf. Ihre Eltern waren aus Westbengalen, einem Bundesstaat im Nordosten Indiens, ausgewandert. Seitdem sie 2000 den Pulitzer-Preis für Belletristik erhalten hatte, wurde sie für die Romane The Namesake, 2003, und Lowland, 2013, sowie für ihre zweite Kurzgeschichtensammlung, Unaccostumed Earth, 2008, als amerikanische Autorin geschätzt. Bald wurde sie eine auch international anerkannte Schriftstellerin; so wurde sie 2009 für Unaccostumed Earth mit dem Premio Gregor von Rezzori der italienischen Stadt Florenz ausgezeichnet.2
Lahiri begann in ihren späten Zwanzigern Italienisch zu lernen, nach einem Aufenthalt in Florenz, wo sie sich, wie sie in In altre parole (2015; Mit anderen Worten, 2017) erzählt, in die italienische Sprache verliebte. Es war, wie sie schreibt, „un colpo di fulmine“ (21; Liebe auf den ersten Blick3). Nachdem sie jahrelang Italienisch gelernt hatte, beschloss Lahiri 2011, mit ihrer Familie für drei Jahre nach Rom zu ziehen, wo sie schließlich eine language memoir auf Italienisch über ihre Erfahrungen mit der italienischen Sprache schrieb, das bereits erwähnte In altre parole.4 Sie beschloss, von nun an nur noch auf Italienisch zu schreiben und gab die englische Sprache auf, um einen Essay (Il vestito dei libri, 2016; Die Kleider der Bücher, 2018), einen Roman (Dove mi trovo, 2018; Wo ich mich finde, 2020), Kurzgeschichten (Racconti romani, 2022 [Römische Erzählungen]) und Gedichte (Il quaderno di Nerina, 2020 [Nerinas Notizbuch]) auf Italienisch zu verfassen. Es ist wichtig zu betonen, dass Lahiri in dieser Zeit keine Originalwerke in englischer Sprache veröffentlichte, um sich auf das Italienische zu konzentrieren und es zu schützen („protect“, Lahiri 2017 [2016], xiii), wie sie es ausdrückt.5 Schon in ihrer language memoir erzählt sie außerdem von ihrer Entscheidung, nurmehr auf Italienisch zu lesen, ein Projekt, das sie schon früher begonnen hatte. Als Folge ihrer Weigerung, auf Englisch zu schreiben, wurden ihre italienischen Bücher auch von anderen übersetzt: Ann Goldstein, eine renommierte Übersetzerin, die Elsa Morante, Primo Levi und Elena Ferrante ins Englische übertragen hat, übersetzte Lahiris In Altre Parole. Il vestito dei libri wurde von Lahiris Ehemann, Alberto Vouvoulias-Bush, übersetzt. Die Kritik lobte Lahiri sogar für ihre Entscheidung, In Altre Parole nicht selbst zu übersetzen, und für ihr Eingeständnis ihrer eigenen Grenzen als Übersetzerin (siehe Rainier Grutman 2018).
Vor kurzer Zeit ist Lahiri zum Englischen zurückgekehrt, weniger als Schriftstellerin (obwohl sie einige kürzere Sachtexte auf Englisch veröffentlicht hat), sondern als Übersetzerin aus dem Italienischen. Bislang hat sie drei Romane des italienischen Schriftstellers Domenico Starnone ins Englische übersetzt (Ties, 2017, Trick, 2018, und Trust, 2021). Im Jahr 2019 gab sie die Anthologie The Penguin Book of Italian Short Stories heraus, die vierzig Kurzgeschichten enthält, von denen Lahiri einige selbst übersetzt hat. Außerdem übersetzte sie ihren eigenen ersten italienischen Roman ins Englische (Dove mi trovo, veröffentlicht als Whereabouts, 2021).
Eines der zuletzt erschienenen Bücher Jhumpa Lahiris, Translating Myself and Others (2022), ist eine Sammlung bereits veröffentlichter Essays bzw. gehaltener Vorträge zum Thema Übersetzung, die sie zum Teil auf Englisch und zum Teil auf Italienisch verfasst hat (und die auch in dem Band in den beiden Sprachen wiedergegeben werden). In diesen Texten konzentriert sie sich auf ihre Erfahrungen als (Selbst-)Übersetzerin und ihre Herangehensweise an das Übersetzen. Dabei bezieht sie sich oft auf Ovids Metamorphosen und betont den grundlegend transformativen Charakter des Übersetzens.6 Lahiri beschränkt sich also nicht auf den Akt des Übersetzens aus dem Italienischen ins Englische, sondern scheint die Rolle der Übersetzerin in einer umfassenderen Weise angenommen zu haben, die auch Beiträge zu einer Theorie der Übersetzung einschließt.
Mit dieser Skizze von Lahiris Weg durch die Sprachen und ihren Übersetzungen aus verschiedenen Sprachen kehren wir zu unserer Frage nach den möglichen Übergängen oder Wendungen im Verlauf ihrer Karriere zurück. Wurde Lahiri erst zu einer translingualen Autorin, als sie begann, auf Italienisch zu schreiben? Das heißt, können wir zu diesem Zeitpunkt von einer „translingualen Wende“ in ihrer Karriere sprechen?
Vom Englischen zum Italienischen: Lahiris translinguale Wende?
Lahiri gibt in In altre parole an, dass ihre erste Sprache, ihre Muttersprache („lingua madre“, 2015, 110), Bengali ist. Allerdings hat sie nie in dieser Sprache geschrieben oder gelesen und ist dazu auch nicht in der Lage, wie sie auf denselben Seiten berichtet (Lahiri 2015, 109–110). Sie begann in ihrer zweiten Sprache, Englisch, zu schreiben, die sie als Stiefmutter („una matrigna“, Lahiri 2015, 110) bezeichnet. Englisch war die Sprache ihrer Schulbildung und ihrer weiteren Ausbildung und die Sprache, von der sie in den USA außerhalb ihres Elternhauses umgeben war. Wie sie in In altre parole betont, waren jedoch weder Bengali noch Englisch ihre eigentliche Sprache. Vielmehr wurden diese Sprachen von ihren Eltern (im Falle des Bengalischen) und von dem Umfeld, in dem sie lebte (im Falle des Englischen), bestimmt. Lahiri stellt diese beiden in der Tat als Sprachen dar, mit denen sie verbunden war, die sie aber nicht bewusst selbst gewählt hat. Vielmehr wurden sie von ihrer Familie und ihrer Umgebung für sie ausgewählt, was sie negativ beschreibt, wenn sie sagt: „Non riuscivo a identificarmi con nessuna delle due.“ (Lahiri 2015, 110; Ich konnte mich mit keiner der beiden identifizieren.) Jedoch verwendet Lahiri das Englische als ihre Literatursprache und das sehr erfolgreich. Außerdem betont sie selbst, dass Englisch die Sprache ist, die sie am besten beherrscht (was sie jedoch nicht davon abgehalten hat, in bislang zumindest einer anderen Sprache zu schreiben). In jedem Fall zeigen ihre Überlegungen zu ihren verschiedenen Sprachen, dass sie, auch wenn sie anfangs nicht als solche wahrgenommen wurde, schon immer eine translinguale Autorin war. Die Kritik jedoch hatte zwar stets ihren multikulturellen Hintergrund gewürdigt, nicht zuletzt wegen der Themen vieler ihrer früheren Bücher, hatte ihrer Mehrsprachigkeit aber vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Im Alter von etwa fünfundzwanzig Jahren entdeckte Lahiri die italienische Sprache für sich: „L’arrivo dell’italiano, il terzo punto sul mio percorso linguistico, crea un triangolo.“ (2015, 113; Die Ankunft des Italienischen, der dritte Punkt auf meinem sprachlichen Weg, schafft ein Dreieck.) Lahiri erinnert uns daran, dass das Dreieck eine dynamische Figur ist: „Il triangolo è una struttura complessa, una figura dinamica. Il terzo punto cambia la dinamica di questa vecchia coppia litigiosa. Io sono figlia di quei punti infelici, ma il terzo non nasce da loro. Nasce dal mio desiderio, dalla mia fatica. Nasce da me.“ (Lahiri 2015, 113; Das Dreieck ist eine komplexe Struktur, eine dynamische Figur. Der dritte Punkt verändert die Dynamik dieses alten, streitsüchtigen Paares. Ich bin die Tochter dieser unglücklichen Punkte, aber der dritte wird nicht von ihnen geboren. Er wird durch meinen Wunsch, durch meine Anstrengung geboren. Er wird von mir geboren.)
Lahiri verwendet dieses Modell, um die Beziehung zwischen ihren Sprachen zu erklären und ihre Beziehung zu ihnen zu veranschaulichen. Sie sieht sie zunächst als die Ecken und dann als die Seiten eines Dreiecks. Auch hier erhält das Englische durch seine Position an der Basis der geometrischen Figur Gewicht – es ist die Sprache, auf der alles andere aufbaut. Darüber hinaus ist das Dreieck eine Figur, die mit der sogenannten perfekten Zahl drei und, damit verbunden, dem religiösen christlichen Modell der Dreifaltigkeit assoziiert wird – ein Gott in drei Personen (Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist). Mit der Ankunft des Italienischen erfährt Lahiris Sprachbiographie eine Veränderung, sie wird vielleicht nicht perfekt doch zumindest ausgeglichener. Das Dreieck steht außerdem für die Kernfamilie – Mutter, Vater und Kind. Für Lahiri sind Sprachen und Familie eng miteinander verbunden. Ihre eigene Sprachgeschichte ist durch ihre Eltern und deren Migration geprägt; Lahiris Kinder und ihr Mann begleiteten sie auf ihrer Reise in die italienische Sprache nach Rom. Darüber hinaus hat ihr Mann einige ihrer Bücher übersetzt. Schließlich erinnert das Dreieck auch an die Triangel, ein Schlaginstrument: Lahiris Musikinstrument (und damit sein möglicher Klang) entsteht metaphorisch gesehen erst, als die dritte Sprache – Italienisch – hinzukommt.
Lahiri betont das Element der Wahl, das Teil dieser Ankunft war, und unterstreicht damit, dass ihre Beziehung zum Italienischen eher eine Zugehörigkeit als eine Abstammung ist. Es ist etwas, das sie selbst in ihre Sprachbiografie einbringt. Dennoch ist das Gefühl der Vollständigkeit, das das Dreieck impliziert, mit sprachlicher Unsicherheit verbunden, vor allem im Italienischen. Dies wird besonders deutlich, da Lahiri in der neuen Sprache keinen experimentellen mehrsprachigen Stil verwendet (wie zum Beispiel Tomer Gardi, Katalin Molnár, Sophie Herxheimer und viele andere zeitgenössische mehrsprachige AutorInnen), sondern auf Korrektheit und sprachliche Genauigkeit setzt.
Durch die Wahl des Italienischen hat sich Lahiri auch in die italienische Literatur eingeschrieben. In ihren Büchern wird diese Zugehörigkeit betont, beispielsweise wenn Lahiri sich auf Antonio Tabucchi bezieht, den sie im Motto zu In altre parole zitiert: „…avevo bisogno di una lingua differente; una lingua che fosse un luogo di affetto e di riflessione [… Ich brauchte eine andere Sprache; eine Sprache, die ein Ort der Zuneigung und der Reflexion war]“ (Tabucchi zitiert in Lahiri 2017 [2016], ohne Seitenzahlen). Der italienische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Antonio Tabucchi war ein Experte der portugiesischen Literatur, der sich dazu entschloss, seinen Roman Requiem (Uma alucinação) (1991; Lissabonner Requiem: Eine Halluzination, 1994) auf Portugiesisch zu schreiben. Indem Lahiri Tabucchi zitiert, bezieht sie sich auf einen sehr bekannten italienischen Schriftsteller und setzt ihr eigenes Werk in Beziehung zu seinem. Andererseits unterstreicht sie mit dieser besonderen Wahl und dem Zitat einen Aspekt der Translingualität, den sie mit Tabucchi teilt, nämlich die Suche und das Bedürfnis nach einer anderen Sprache. Dies tut sie auch in ihren Sachtexten, etwa wenn sie ihr eigenes Werk in Beziehung zu SchriftstellerInnen stellt, die die Sprache gewechselt haben, wie Samuel Beckett, Joseph Brodsky, Juan Rodolfo Wilcock, Jorge Luís Borges und Leonora Carrington (vgl. Lahiri 2022, 71).
Sowohl Lahiri als auch Tabucchi hatten die ästhetische und politische Freiheit, eine andere Sprache für ihr Schreiben zu wählen. Ihre Wahl war nicht ohne Risiko: Sowohl Lahiri selbst als auch die KritikerInnen haben unterstrichen, dass der Wechsel der Sprache eine riskante Entscheidung für SchriftstellerInnen ist. Der Unterschied zwischen Lahiri und anderen translingualen AutorInnen besteht darin, dass ihre (und Tabucchis) Entscheidung nicht durch Migration, Flucht oder Exil, die Notwendigkeit, eine neue Leserschaft anzusprechen, oder die Tatsache, dass ihre anderen Sprachen nicht ausreichend populär waren, beeinflusst wurde. Letzteres ist häufig bei AutorInnen aus afrikanischen Ländern der Fall, die sich für die englische oder französische Sprache entscheiden, weil ihnen das Schreiben in ihrer anderen, weniger verbreiteten Sprache (oft: Sprachen) keine Anerkennung bringen würde. Die Wahl des Englischen oder Französischen als Literatursprache verschafft hingegen Zugang zum globalen Literaturmarkt und zu einer größeren Leserschaft.7 In Lahiris Fall hat die Wahl des Italienischen ihre Leserschaft und den Markt, auf dem sie präsent ist, verkleinert. Ihre Wahl bedeutete den Schritt in einen kleineren Literaturbetrieb. Gleichzeitig handelt es sich bei dem literarischen Feld, in das Lahiri mit ihren italienischen Veröffentlichungen eintrat, um ein prestigeträchtiges. Ihr Schritt steht also nicht unbedingt im Gegensatz zu jenen (postkolonialen) Schriftstellern, die sich aus Gründen der Sichtbarkeit für einen Sprachwechsel entschieden haben.
Da Lahiri nie auf Bengali geschrieben hat und dies auch nie als Option in Betracht gezogen zu haben scheint, war es ihre Entscheidung, auf Italienisch zu schreiben, die sie dazu veranlasste, öffentlich über den Sprachwechsel nachzudenken und dies zu einem der Themen ihres Schreibens zu machen (wie in In Altre Parole und in vielen Essays). Sie begann auch über ihr zweisprachiges Aufwachsen zu reflektieren, das so ihrem Publikum bekannt wurde. Wenn man also von einer translingualen Wende in Lahiris Karriere sprechen kann, so gilt dies primär für ihre Selbstdarstellung und Rezeption: Seit sie auf Italienisch schreibt, wird sie als mehrsprachige Schriftstellerin wahrgenommen.
Von Autorin zu (Selbst-)Übersetzerin
Lahiris zweites direkt auf Italienisch geschriebenes Buch, der Roman Dove mi trovo, erschien 2018. Im Jahr 2021 wurde das Buch unter dem Titel Whereabouts auf Englisch veröffentlich, in der Selbstübersetzung der Autorin. Diese Übersetzung wurde von mehreren Kommentaren Lahiris begleitet, zum Beispiel in dem Essay „Where I Find Myself“.8 In diesem Text erklärt Lahiri, wie ihre Übersetzertätigkeit zur Entscheidung geführt hat, den Text selbst zu übersetzen, anstatt eine/n ÜbersetzerIn zu beauftragen, wie für ihr erstes auf Italienisch geschriebenen Buch, In Altre Parole. Die Selbstübersetzung und Lahiris Überlegungen führten dazu, dass sie nun nicht mehr nur als Schriftstellerin wahrgenommen wurde, die die Sprache gewechselt hatte, sondern zunehmend auch als Übersetzerin.
Tatsächlich hatte Lahiri aber davor schon übersetzt, und zwar einige Erzählungen für das von ihr herausgegebene Penguin Book of Italian Short Stories (2019). Außerdem hatte sie zwei Bücher von Domenico Starnone übersetzt, bevor sie ihren eigenen Roman übersetzte.9 Die Autorin selbst betont, dass „gaining experience translating other authors out of Italian before confronting [her own novel]” (Lahiri 2022, 83) wichtig für sie war. Zum Zeitpunkt der Übersetzung von Dove mi trovo/Whereabouts kann man also eher von einer selbstübersetzerischen als von einer übersetzerischen Wende in Lahiris Karriere sprechen.
Lahiri hat ausführlich über ihre Beziehung zur italienischen Sprache geschrieben und darüber, wie eine andere Sprache die Sicht auf die Welt verändert. Ihrer Meinung nach konfrontiert einen der Akt des Übersetzens noch stärker mit dem, was Wilhelm von Humboldt Weltansicht nannte – eine eigene Sicht der Welt, die jede einzelne Sprache besitzt.10 Für Lahiri erlauben das Übersetzen und Übersetzungen „di sconfinare, capire altri mondi, tempi, Paesi, culture“ (Rastelli 2023, o.S. [Grenzen zu überschreiten, andere Welten, Zeiten, Länder, Kulturen zu verstehen]).
Adrian Wanner (2023) hat in seinem detaillierten Vergleich zwischen der italienischen und der englischen Fassung von Dove mi trovo/Whereabouts gezeigt, dass Lahiris englische Übersetzung vom Italienischen kontaminiert ist, sie „displays some features of linguistic foreignness that one also encounters in her [Lahiri’s] occasionally English-inflected Italian“ (Wanner, 2023). Im Folgenden werde ich mich deshalb weniger auf einen Übersetzungsvergleich als auf andere Aspekte von Lahiris Selbstübersetzung konzentrieren.
Eva Gentes und Trish Van Bolderen definieren Selbstübersetzung als „the phenomenon of an author producing an additional text by translating their own written work into another language“ (2022, 36911). Diese Definition ist für Lahiris Fall und ihre Selbstübersetzung von Dove mi trovo gültig.
Darüber hinaus kann translinguales Schreiben als Selbstübersetzung per se verstanden werden, wie Kristine Anderson uns erinnert: „the mere act of writing in a language not one’s first is, in a sense, a type of self-translation.“ (2000, 1251) Nach dieser Definition nahm Jhumpa Lahiri den Status einer Selbstübersetzerin an, als sie ihr erstes Werk auf Italienisch, In altre parole, verfasste. Vielleicht nahm sie diesen Status sogar schon früher an, nämlich zu dem Zeitpunkt, als sie ihre ersten Texte auf Englisch verfasste, denn chronologisch gesehen war ihre erste Sprache (L1) Bengali und nicht Englisch. Doch anstatt Lahiri von Anfang an als Selbstübersetzerin zu betrachten, sollten wir überdenken, wie wir Sprachen und Sprachkenntnisse definieren. Indem sie ihre Beziehungen zu ihren verschiedenen Sprachen öffentlich macht, spricht Lahiri Aspekte des Sprachenlernens und des Sprachgebrauchs an, die für viele Menschen zum Alltag gehören. Sie teilt die Erfahrung vieler Einwanderer, deren erste Sprache (L1) zwar vielleicht die vertrauteste ist, in der sie sich am wohlsten fühlen, die aber nicht unbedingt diejenige ist, die sie in allen Bereichen am besten beherrschen. Lahiris kritische Einschätzung dieser Situation stellt die Vorstellung in Frage, dass die Reihenfolge, in der wir Sprachen erlernen (in der Linguistik üblicherweise als L1, L2, L3 usw. bezeichnet), notwendigerweise unsere Kompetenz in diesen Sprachen widerspiegelt. Also die Idee, dass wir zwangsläufig in unserer ersten Sprache, die im allgemeinen Sprachgebrauch oft als Muttersprache bezeichnet wird, am eloquentesten sind und in anderen Sprachen weniger gut (eine Überzeugung, die auch in der Übersetzungspraxis verbreitet ist). Vielmehr mag die Einteilung der Sprachen in L1, L2 usw. die Chronologie des Sprachenlernens ausdrücken (obwohl dies bereits schwierig wird, wenn Sprachen parallel gelernt werden), sie sagt aber wenig über den Sprachgebrauch, die Sprachkompetenz und schließlich über unsere emotionale Beziehung zu einer Sprache aus.
Eine weitere Frage, die sich im Zusammenhang mit der Selbstübersetzung stellt, betrifft die Richtung der Übersetzung. Bei der konventionellen, allographen Übersetzung – d. h. der Übersetzung, die nicht von den AutorInnen, sondern von einem anderen, einer/m ÜbersetzerIn, vorgenommen wird – wird gemeinhin angenommen, dass sie von der L2 (oder L3, L4 usw.) der/s ÜbersetzerIn zur L1 der/r ÜbersetzerIn verläuft, d. h.: L2 -> L1. Es gibt allerdings viele Beispiele von ÜbersetzerInnen, die in ihre L2, L3 usw. übersetzen, und somit Ausnahmen von dieser ‚Regel‘ bilden. Darüber hinaus wird diese Annahme schwierig bei ÜbersetzerInnen, deren L1 nicht klar festgestellt werden kann oder deren Kompetenz in ihrer L1 möglicherweise nicht so hoch ist wie in anderen Sprachen. Dennoch wird allgemein angenommen (und ist in der Übersetzungsbranche gängige Praxis), dass die Übersetzung, insbesondere von literarischen Texten, am besten funktioniert, wenn die ÜbersetzerInnen in ihre L1 übersetzen.
Bei der Selbstübersetzung ist die Richtung nicht von Anfang an klar. Die Übersetzung findet statt, aber es ist nicht per se klar, welche Position die Sprachen innerhalb der Sprachbiografie der/s ÜbersetzerIn einnehmen, dies kann nur jeweils individuell festgestellt werden: L? -> L? In Lahiris Fall übersetzt sie aus ihrer L3 (Italienisch) in ihre L2 (Englisch). Gleichzeitig übersetzt sie aus einer weniger verbreiteten Sprache in eine dominantere Sprache.12 Bei ihren eigenen Selbstübersetzungsprojekten ist die Richtung also die entgegengesetzte, als jene, die sie eingeschlagen hat, als sie begann, auf Italienisch zu schreiben. Während sie sich in ihren jüngsten Originaltexten für eine weniger verbreitete Sprache entschieden hat, (selbst-)übersetzt Lahiri für eine größere Leserschaft.
Wenn wir außerdem an den Unterschied zwischen zeitgleicher Selbstübersetzung (die nach Andersons Definition jede Form des translingualen Schreibens ist) und konsekutiver oder „verzögerter“ Selbstübersetzung denken (siehe Grutman 2016), ist Lahiris Arbeit eine Form der verzögerten Selbstübersetzung, die erst nach der Veröffentlichung des Originals stattfand. Lahiri hatte ursprünglich nicht vor, ihr eigenes Werk zu übersetzen; wie sie erklärt, wollte sie jemand anderen mit der Übersetzung beauftragen, und übernahm diese dann doch (vgl. Lahiri 2022, 73–74). Die Selbstübersetzung ist in ihrem Fall eng mit ihrer generellen Hinwendung zum Übersetzen verbunden. Die Übersetzung italienischer Texte anderer Autoren ins Englische weckte in ihr den Wunsch, dasselbe mit ihrem eigenen italienischen Text zu tun. Die Erfahrungen des Übersetzens und des Unterrichtens von Übersetzungen (an der Princeton University) wurden von einer intensiven Reflexion über das Übersetzen begleitet, die sie schließlich zur Selbstübersetzung führten.
Lahiris Selbstübersetzung stellt das Verhältnis zwischen dem Original und der Übersetzung in Frage. Stehen sie in einer hierarchischen oder in einer demokratischen Beziehung? Haben sie den gleichen ‚Wert‘, da sie vom gleichen Autor verfasst wurden, oder gibt es ein Original, das von höherem ‚Wert‘ ist, wie Kritiker im Falle allographer Übersetzungen oft feststellen? Als reflektierende Autorin und Übersetzerin thematisiert Lahiri selbst diese Fragen. Sie geht sogar noch weiter, wenn sie die Hierarchie „between what is authentic and what is derivative“ (Lahiri 2022, 49) anspricht, die nicht nur beeinflusst, wie literarische Werke – Originaltexte und Übersetzungen – wahrgenommen werden, sondern auch, „how we regard one another“ (Lahiri 2022, 49): „Who is original, who belongs authentically to a place? Who does not? Why are those who are not original to a place – migrants who did not ‚get there first‘ – treated as they are?“ (Lahiri 2022, 49–50). Obwohl sie es in ihrem Essay bei diesen Fragen belässt, macht sie deutlich, dass sie dem Akt der (Selbst-)Übersetzung politische Bedeutung verleihen.
In ihren Reflexionen stellt Lahiri Fragen, die in der Forschung zur Selbstübersetzung typischerweise behandelt werden: Welcher Text ist das Original? Bleibt der Text, der zuerst veröffentlicht wurde, das Original? Welcher Text wird die Grundlage für weitere Übersetzungen sein? Letzteres ist eine nicht unwesentliche Frage bei Texten, die durch Selbstübersetzung sowohl in größeren als auch in kleineren Sprachen veröffentlicht wurden. Auch wenn Dove mi trovo bereits aus dem Italienischen in andere Sprachen (wie Deutsch, Spanisch und Niederländisch) übersetzt wurde, bedeutet dies nicht, dass auch künftige Übersetzungen auf das italienische Buch zurückgreifen werden. Verlage könnten sich stattdessen für die englische Version als Grundlage entscheiden – eine Sprache, für die sich einfacher ÜbersetzerInnen finden lassen und die nicht zuletzt deshalb auch kostengünstiger ist. Da es sich um eine Selbstübersetzung handelt, wird die englische Fassung zukünftig möglicherweise als Original (oder zumindest als etwas, das dem Original nahekommt) wahrgenommen. Diese Auffassung scheint auch der britische Verlag zu teilen, wie ich noch erläutern werde.
Lahiri spricht in Bezug auf Dove mi trovo weiterhin vom italienischen Original und der englischen Übersetzung – eine Ansicht, die Adrian Wanner (2023) in seiner vergleichenden Lektüre teilt –, obwohl sie gleichzeitig einräumt, dass die Übersetzung Auswirkungen auf das Original hatte: Sie erwähnt mehrere kleine Korrekturen und erklärt, dass sie das italienische Taschenbuch, in dem diese Änderungen vorgenommen wurden, als endgültige Fassung des Romans betrachtet (vgl. Lahiri 2022, 85). Lahiri selbst verzichtet darauf, den Wert der beiden Texte zu vergleichen, aber die Frage nach dem Verhältnis der beiden Texte zueinander bleibt für ihre Rezeption besonders relevant, was uns zum letzten Punkt bringt, den ich ansprechen möchte.
Fragen der Rezeption
KritikerInnen und LeserInnen gehen davon aus, dass sich Selbstübersetzungen von allographen Übersetzungen unterscheiden. Während von allographen Übersetzungen erwartet wird, dass sie ein Gleichgewicht zwischen Angemessenheit und Akzeptanz herstellen (siehe Toury 1995), stehen bei der Selbstübersetzung die Absichten der AutorInnen im Vordergrund. Diese Absichten können eher ästhetische Qualität haben, zum Beispiel im Sinne einer Neufassung des Textes. Alternativ kann die Selbstübersetzung auch auf die Anpassung eines Werks für ein bestimmtes Publikum abzielen (siehe Gentes und Van Bolderen 2022, 372–73). Bei all diesen Aspekten werden SelbstübersetzerInnen mehr Autorität und agency zugestanden als allographen ÜbersetzerInnen.
Wie werden diese Aspekte der Selbstübersetzung den LeserInnen im Paratext eines Werkes präsentiert? Wie (wenn überhaupt) wird der Akt der Selbstübersetzung für das Publikum sichtbar? Im Fall von Lahiri finden wir zwei unterschiedliche Strategien: In der amerikanischen Ausgabe wird auf dem inneren Titelblatt des Buches vermerkt, dass der Roman auf Italienisch geschrieben und von der Autorin selbst ins Englische übersetzt wurde. Es heißt dort: „Written in Italian and translated by the author” (Lahiri 2021a, ohne Seite). In der britischen Ausgabe fehlt dieser Hinweis. Hier wird Lahiri als Autorin des englischen Textes genannt. Über die italienische Herkunft des Textes erfährt man erst auf der Seite mit dem Impressum – die viele LeserInnen gar nicht lesen –, wo es im Kleingedruckten heißt: „Originally published in Italy in 2018 as Dove Mi Trovo“ [alles in Großbuchstaben, sic; Lahiri 2021b, ohne Seite]. Das ist eine inhaltlich richtige Aussage, doch aus dieser Formulierung geht nicht hervor, dass es sich bei dem vorliegenden Text um eine Übersetzung handelt. Vielmehr scheint die Umwandlung ins Englische auf wundersame Weise geschehen zu sein, da kein/e ÜbersetzerIn genannt wird. Der Akt der Selbstübersetzung bleibt in dieser Ausgabe undurchsichtig, fast unsichtbar (siehe Dasilva 2011). In der amerikanischen Version hingegen wird er transparent; die Selbstübersetzung wird explizit gemacht.
Möglicherweise hat der amerikanische Verlag darauf gesetzt, dass die LeserInnen der englischen Übersetzungen von Lahiris Büchern auf ihre Hinwendung zur Selbstübersetzung vorbereitet sein würden. Denn obwohl das erste auf Italienisch verfasste Buch, In altre parole / In Other Words, von jemand anderem (Ann Goldstein) übersetzt worden war, erschien es als zweisprachige Ausgabe mit dem italienischen Text auf der einen und dem englischen Text auf der gegenüberliegenden Seite. Lahiris Mehrsprachigkeit war damit für die amerikanischen LeserInnen auch in der Übersetzung sichtbar. Außerdem enthält das Buch eine Einleitung von Lahiri, in der sie kurz ihre Entscheidung erläutert, ihr erstes italienisches Buch nicht selbst zu übersetzen. Die Selbstübersetzung ihres zweiten Buches kann also ex negativo als Folge einer Entscheidung gesehen werden, die sie inzwischen überdacht hat. Der britische Verlag schien nicht so überzeugt von Lahiris Entscheidung zu sein und verschleierte ihre Selbstübersetzung. Der Verlag von Lahiris Übersetzungen der Romane von Domenice Starnone, Europa Editions, verwendete dagegen ihren bekannten Namen auf dem Cover von Ties und Trick und machte ihre Rolle als Übersetzerin deutlich: „Translated and with an introduction by Jhumpa Lahiri“ heißt es auf den beiden Covern. Wir können also unterschiedliche Strategien beobachten, wenn es darum geht, mehrsprachige SchriftstellerInnen/ÜbersetzerInnen/SelbstübersetzerInnen wie Lahiri im literarischen Feld zu positionieren.
Zum Abschluss
In diesem Artikel habe ich Jhumpa Lahiris Werdegang von einer scheinbar einsprachigen Schriftstellerin zur mehrsprachigen Übersetzerin und Selbstübersetzerin nachgezeichnet (wobei sie im Laufe dieses Prozesses natürlich auch Autorin blieb, wie nicht zuletzt ihr 2022 erschienener Erzählband Racconti romani zeigt). Die vermeintlichen Veränderungen in ihrer Karriere habe ich als Lahiris translinguale Wende bzw. (selbst)übersetzerische Wende bezeichnet. Ein genauerer Blick auf die Autorin zeigt, dass sie von Anfang an eine mehrsprachige Schriftstellerin war, eine Tatsache, die von der Kritik erst in vollem Ausmaß gewürdigt wurde, als Lahiri zum Italienischen als Literatursprache wechselte. Dies passierte nicht zuletzt, weil Lahiri selbst ihr Verhältnis zu ihren verschiedenen Sprachen in In altre parole thematisierte.
Wie wird sich Lahiri als Autorin weiterentwickeln? Das Dreieck, das sie als Modell zur Erklärung der Beziehung zwischen Bengali, Englisch und Italienisch in ihrer Sprachbiographie verwendet, scheint bereits neue Formen angenommen zu haben. An diesem Punkt könnte Lahiri Latein und vielleicht auch Griechisch als weitere Elemente ihres sprachlichen Profils hinzufügen. In der Tat ist ihr nicht fremd, neue Formen des Schreibens zu erforschen, so wie sie sich von einer Autorin zur translingualen Autorin, von einer Übersetzerin zur Selbstübersetzerin und zuletzt zur Mitübersetzerin von Ovids Metamorphosen entwickelt hat. Lahiri hat wiederholt erwähnt, dass dieser Text mit seinem Thema der ständigen Verwandlung für ihre eigene Arbeit als Schriftstellerin von großer Bedeutung ist (Lahiri 2022, 147–155; „Fra una lingua e l’altra“ 2023). Dies kommt auch in Amanda Weiss’ Illustration des weiblichen Janus zum Ausdruck, der auf dem Cover von Lahiris Translating Myself and Others abgebildet ist. Angesichts dessen, was wir bisher gesehen haben, können LeserInnen und KritikerInnen weitere Metamorphosen dieser vielseitigen Schriftstellerin erwarten.
Bibliographie
Anderson, K. J. 2000. „Self-Translators“. In Encyclopaedia of Literary Translation into English, vol. 2, hg. von Olive Claase, 1250–1251. Chicago: Fitzroy Dearborn.
Dasilva, Xosé Manuel. 2011. „La autotraducción transparente y la autotraducción opaca”. In Aproximaciones a la autotraducción, hg. von Xosé Manuel Dasilva und Helena Tanqueiro, 45–68. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo.
Derrida, Jacques. 1996. Le monolinguisme de l’autre ou la prothèse d’origine Paris: Galilée.
„Fra una lingua e l’altra“. 2023. Di Paolo, Paolo. La lingua batte. Interview mit Jhumpa Lahiri. 26.2.2023. Radio 3. https://www.raiplaysound.it/audio/2023/02/La-lingua-batte-del-26022023-2c6fd762-dbd0-4d25-959a-68e58e2ef39b.html
Gentes, Eva und Trish Van Bolderen. 2022. „Self-Translation“. In The Routledge Handbook of Literary Translingualism, hg. von Steven G. Kellman und Natasha Lvovich, 369–81. Abingdon/New York: Routledge.
Grutman, Rainier. 2009. „Self-translation“. In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, hg. von Mona Baker und Gabriela Saldanha, 2. Aufl., 257–60. London: Routledge.
Grutman, Rainier. 2011. „Diglosia y autotraducción ‚vertical‘ (en y fuera de España)“. In Aproximaciones a la autotraducción, hg. von Xosé Manuel Dasilva und Helena Tanqueiro, 69–92. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo.
Grutman, Rainier. 2016. „Manuscrits, traduction et autotraduction“. In Traduire. Genèse du choix, hg. von Chiara Montini, 115–28. Paris: Éditions des Archives Contemporaines.
Grutman, Rainier. 2018. „Jhumpa Lahiri and Amara Lakhous: Resisting Self-Translation in Rome“. Testo & Senso, Nr. 19 (Oktober): 1–17. https://testoesenso.it/index.php/testoesenso/article/view/389.
Kaplan, Alice. 1993. French Lessons: A Memoir. Chicago: University of Chicago Press.
Kellman, Steven G. 2000. The Translingual Imagination. Lincoln: University of Nebraska Press.
Lahiri, Jhumpa. 2015. In altre parole. Mailand: Ugo Guanda Editore.
Lahiri, Jhumpa. 2016. In Other Words. (US Ausgabe). Übersetzt von Ann Goldstein. New York: Alfred A. Knopf.
Lahiri, Jhumpa. 2017 [2016]. In Other Words. (UK Ausgabe). Übersetzt von Ann Goldstein. London: Bloomsbury Paperbacks.
Lahiri, Jhumpa. 2018. Dove mi trovo. Mailand: Ugo Guanda Editore.
Lahiri, Jhumpa. 2021a. Whereabouts. New York: Alfred A. Knopf.
Lahiri, Jhumpa. 2021b. Whereabouts. London: Bloomsbury.
Lahiri, Jhumpa. 2022. Translating Myself and Others. Princeton: Princeton University Press.
Lamping, Dieter. 1992. „Die literarische Übersetzung als de-zentrale Struktur: Das Paradigma der Selbstübersetzung“. In Geschichte, System, literarische Übersetzung – Histories, Systems, Literary Translations, hg. von Harald Kittel, 212–28. Berlin: Erich Schmidt.
Popovič, Anton. 1976. Dictionary for the Analysis of Literary Translation. Edmonton: University of Alberta.
Rastelli, Alessia. 2023. „Igiaba Scego. Noi siamo la lingua che abitiamo“. Corriere della Sera, 12. Februar, 2023.
Reichardt, Dagmar. 2017. „‚Radicata a Roma‘: la svolta transculturale nella scrittura italofona nomade di Jhumpa Lahiri.“ In Il pensiero letterario come fondamento di una testa ben fatta, hg. von Marina Geat, 219–247. Roma: Roma TrE-Press.
Toury, Gideon. 1995. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
Wanner, Adrian. (2023) „‚At Sea, At Odds, Astray, Adrift‘: Linguistic Destabilization in Jhumpa Lahiri’s Self-Translated Novel Whereabouts.“ Journal of Literary Multilingualism.
1 Dieser Beitrag stellt eine überarbeitete und übersetzte Version des folgenden Artikels dar: Vlasta, Sandra. Im Druck. „Shifting multilingualism: Jhumpa Lahiri’s expansion from (multilingual) author to (self-)translator.“ Methis. Studia Humaniora Estonica. 31/32.
2 Der Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze [Gregor von Rezzori Preis – Stadt Florenz] ist ein italienischer Literaturpreis, der jährlich in Florenz für die beste Übersetzung ins Italienische verliehen wird. Siehe die Website des Preises: http://premiogregorvonrezzori.org.
3 Wenn nicht anders ausgewiesen, stammen alle Übersetzungen ins Deutsche von mir.
4 Ich übernehme den Begriff language memoir von Alice Kaplan, die ihn in ihrer eigenen language memoir, French Lessons (1993), geprägt hat, in der sie von ihrer Beziehung zum Französischen schreibt.
Für eine detaillierte Präsentation und Analyse von In altre parole siehe Dagmar Reichardts Beitrag, in dem sie Lahiris Text als Teil der modernen transkulturellen italienischen Literatur liest (Reichardt 2017).
5 Die kurze Einleitung, die Lahiri für die englische Übersetzung von In altre parole verfasst hat, bildet eine Ausnahme. Doch auch dort hält sie fest: “it [Italian] is the sole language in which I continue to write” (Lahiri 2017 [2016], xiii).
6 Wie Lahiri im gleichen Band festhält, arbeitet sie derzeit zusammen mit Yelena Baraz, ihrer Kollegin an der Princeton University, an einer englischen Übersetzung der Metamorphosen.
7 In vielen dieser Fälle ist Englisch oder Französisch auch die Sprache der ehemaligen Kolonialmacht; diese Wahl ist daher in kultureller und politischer Hinsicht eine schwierige Entscheidung. Siehe hierzu vor allem Derrida 1996.
8 Der Essay wurde zuerst im Online-Magazin Words Without Borders (April 2021) und später in der Essaysammlung Translating Myself and Others (2022) veröffentlicht.
9 Die zwei Bücher sind: Ties (2017; Übersetzung von Lacci (2014)) und Trick (2018; Übersetzung von Scherzetto (2016)). Der dritte von Lahiri übersetzte Text Starnones, Trust, wurde 2021, nach ihrer Selbstübersetzung, veröffentlicht.
10 Ich danke Marko Pajević für diesen und andere wertvolle Hinweise.
11 Siehe Popovič 1976 und Lamping 1992 für ähnliche Definitionen. Rainier Grutman unterstreicht die Mehrdeutigkeit des Begriffs Selbstübersetzung, wenn er festhält, dass “the term ‘self-translation’ can refer both to the act of translating one’s own writings into another language and the result of such an undertaking” (2009, 257).
12 Rainier Grutman (2011) nennt solche Übersetzungen „Supra-Selbstübersetzungen“ (im Gegensatz zu „Infra-Selbstübersetzungen“, die in die entgegengesetzte Richtung stattfinden, d. h. von einer dominanten zu einer weniger verbreiteten Sprache).