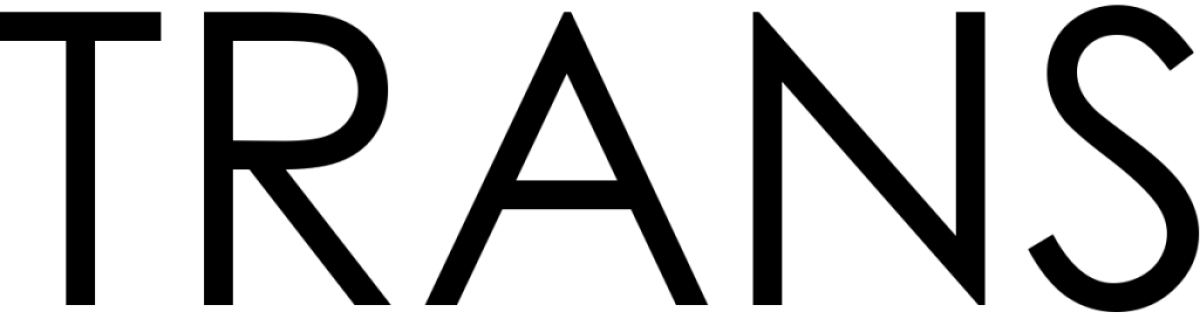Fassung: 7.6.2024
English
Die transdisziplinäre Internet Zeitschrift TRANS wird seit 1997 vom INST publiziert. In den 1990eer Jahren war eine digitale Publikation wissenschaftlicher Artikel noch ein neues Format für wissenschaftliche Veröffentlichungen. Das INST hatte vielfältig in Zentraleuropa, Asien, Afrika, Lateinamerika die Arbeit mit dem Internet in die kulturwissenschaftlichen Arbeiten eingeführt (darunter mit Internet Seminaren). Eine Entwicklung neuer Sprachreflexionen, Methoden etc., an der Tausende aus über 120 Ländern beteiligt waren bzw. sind, wurde mehrfach dokumentiert.
Bereits in der Vergangenheit hatte das INST vielfältige Formate für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet: nicht nur Zeitschriften, Zeitungen, Broschüren, Bücher, sondern zum Beispiel auch Textausstellungen (eine Vorform der heutigen digitalen Installationen), Filme, Digitalität als Technologie musealer Präsentationen.
Die neue Herausforderung für TRANS 28 war auch, inhaltliche Anregungen, Beiträge von rund 10.000 Beteiligten aus über 120 Ländern in ein neues Format einzubringen, das im Kontext eines Umbruchs in der Medienwelt, aber auch der Bildungswelt entsteht. Es wird nicht nur – wie in Österreich – um Maturaarbeiten gehen, sondern um eine komplett neue Herangehensweise an „Quellen“, Methodologien, Schreibformen. Dazu fehlt dem zuständigen Ministerium schon der begriffliche Ansatz, da es die Werbesprache des Marketing übernimmt.
TRANS 28 entsteht nun im Kontext einer neuen Kommunikationswelt. Der Marketing Hype um die Large Languages Models (LLM) wie ChatGPT ebbt bereits ab. Nicht nur aus Gründen prinzipieller Art, sondern auch wegen Ausfalls. Vielfältige Beispiele zeigen mittlerweile, was auch nach einem „Training“ der Software nicht funktionieren kann, weil künstlerisches, kulturelles, innovatives Agieren einer Maschine nicht möglich ist. Kommunikation funktioniert keineswegs nur linear wie bereits Jura Soyfer in seinem Stück Astoria zeigte. Die Leistung der LLM besteht aber in ihrer besonderen Form der Reproduktion. Beschränkung erfährt sie durch die Menge der Daten und durch die Art der Software, wie die Daten verarbeitet werden. Ausgeschlossen sind Innovationen, Intelligenz. Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ ist daher nicht sachbezogen, sondern steht in einer langen Tradition, etwas erscheinen zu lassen, was es nicht ist.
Aber die APA hatte zum Beispiel am 14.5.2024 eine neue Form der Multimedialität präsentiert, die auch der Realität heutiger künstlerischer Produktionen entspricht, aber keineswegs mit ihr ident ist. Der APA-NewsDesk tritt die Nachfolge des APA-OnlineManagers (AOM) an und bietet Contentplanung, Monitoring und umfassende Recherchen in einer Vielzahl von Quellen – alles mit den neuesten KI-Technologien der APA. Ein Schlüsselbegriff ist in diesem Zusammenhang für die APA „human control“. Die Maschine wird als das Werkzeug begriffen, das sie ist. Und insofern wahrgenommen wird, dass es sich um Maschinenkommunikation handelt, erlahmt auch das Interesse am Dargebotenen beim breiten Publikum. Mehr Bots bedeutet also keineswegs automatisch mehr Einfluss in öffentlichen Bereichen.
Das APA Modell hat zudem eine grundlegende Beschränkheit. Das zeigt sich bereits bei der Verwendung des Marketing Begriffs „Künstliche Intelligenz“ (KI). The Future of Fact Checking (eventmaker.at) wird als Zukunft eines Geschäftsmodells für Nachrichten und Demokratie verstanden. Freilich zeigt sich gerade aktuell, dass das ÖVP Modell Firma Österreich mit Politik als Marketing gescheitert ist. Ein zentrales Defizit des APA News-Desk ist auch das mangelnde kulturhistorische Bewußtsein. Die Fragwürdigkeit einer Timeline ergibt sich aus der Überwindung der mittelalterlichen Chronologie als Darstellungsform in ihrer Beschränktheit vor rund 200 Jahren. Im 19. Jahrhundert entstand auch ein neuer Umgang mit Quellen. Wiederum wird von der APA versucht, Themen zu setzen (der Zettelkasten war bereits im 19. Jahrhundert an seine Grenzen gelangt/ am Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dies prominent im Roman Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil reflektiert).
Die APA hat aber keinen Wahrheitsanspruch wie die Geschichtswissenschaft, sondern bietet Nachrichten am Markt an. Ihre Quellen können hilfreich sein, wie die Forschungen zum österreichischen Deutsch von Rudolf Muhr zeigen. Freilich ergeben sich aus dem Verständnis, dass Nachrichten angeboten werden, auch methodologische Probleme im Zusammenhang mit Fake News und der Bestimmung von Quellen, der fragwürdigen Ästhetisierung im Zusammenhang mit einem Schlüsselbegriff wie Erzählung und Schwerpunkten, die mehr dem Marketing denn der Realität entsprechen.
Das INST geht einen Schritt weiter und spricht von „cultural control“. Das meint, dass die Kontrolle genauso wenig zersplittert sein soll wie die Erarbeitung der Technik, der Software, der Technologie. Wie die APA ist das INST an übergreifenden Kooperationen interessiert. Die Notwendigkeit der transdisziplinären Kooperation war ein Grundgedanke bei der INST Gründung. Sie hat sich gerade bei Großprojekten bewährt, wie auch in TRANS 28 dokumentiert wird: mit dem Weltprojekt Jura Soyfer, dem Verhältnis von Sprachen, Literaturen, Künste und Digitalität, dem Weltprojekt der Berge.
Wichtig ist, dass sich die Kommunikationsverhältnisse seit den 1990er Jahren völlig gewandelt haben. Es geht nicht mehr darum, dass JournalistInnen WissenschafterInnen Marketing beibringen und zum Beispiel das Wissenschaftsministerium für Marketing bezahlt. Ohne neue Rolle der Wissenschaft und Forschung bei der kulturellen Kontrolle sind die Fehlleistungen vorprogrammiert und vielfach evident. Das betrifft auch die Bedingung des Geschäftsmodells von LLM durch Universitäten, Akademien, Ministerien etc. Hier geht es nicht nur um Verschwendung von Steuermitteln für Profit, sondern auch um die mangelnde oder fehlende Wahrnehmung der gesellschaftlichen Aufgabe von Wissenschaft und Forschung, der von einem strukturellen Antipluralismus begleitet wird.
Das eigentliche Problem mit der Digitalität beginnt freilich schon bei der Programmierung. Es fehlt am Grundverständnis, was mit 0 und 1 gemacht werden kann, was mit 0 und 1 nur als Simulation möglich ist. Weiters ist die Programmierung oft zu sehr individualisiert, woraus entsteht, dass es an Zugänglichkeit, Nachvollziehbarkeit fehlt, (großer) Ärger entsteht. Hier könnten Large Language Models (LLM) hilfreich sein, wenn die Rechtsfragen (die Fragen der Abgeltung von Arbeitsleistungen) geklärt sein werden. Die APA hat hier beispielhaftes vorzuschlagen. Sie entwickelte offene Modelle, weiß wie rasch Veränderungen notwendig sein können. Keineswegs geht es daher um technische Standards, wie sie jetzt ins Zentrum digitaler Aktivitäten der Museen gestellt werden. Neue Kunst nur als neue technische Form zu sehen, erkennt das Verhältnis von Technik/ Maschine und Mensch nicht. Aus einer solche Nicht-Erkenntnis heraus entstehen dann unsinnige Begriffe wie „Digitaler Humanismus“ (übersetzt: 0 und 1 Humanismus, Maschinen Humanismus).
Am 7.6.2024 wurde wie immer keine Endfassung einer TRANS Nummer vorgestellt. Es geht – wie bei den APA Modellen – um ein Zwischenergebnis, das dann noch jahrelang – wie in Fällen von anderen TRANS Nummern – ausgebaut werden kann und muss. Immer wieder wird es dazu Präsentationen via Medienagenturen geben, was neu ist. Diese Präsentationen werden Teil eines Kommunikationsprozesses sein, bei dem es im Kern um eine neue UNO geht. Weitergehende Vorschläge dazu werden auch im Rahmen von Special Lectures, Symposien, Konferenzen erfolgen. Im Mittelpunkt stehen als Adressaten die G20 Gipfel in Brasilien (November 2024) und Südafrika (2025) sowie die Zukunftskonferenz der UNO.
Vieles gab es bereits vor den LLM in der Textverarbeitung, den Such- und Sprachübersetzungsmaschinen, den Hilfsprogrammen für Internet Publikationen. Neu ist daher auch für das INST nicht LLM, sondern eine neue Öffentlichkeitsstrategie, die neu umgesetzt werden kann. Anders freilich als bei der Marketing Einführung der Digitalität in die Finanzwelt, wird es bei einem falschen Verständnis von LLM nicht bei einer Weltfinanzkrise bleiben, in deren Kontext Millionen starben, Billionen vernichtet wurden. Die Experimente, die mit der Gründung das INST 1994 begannen, werden in neuer Weise fortgesetzt, indem sie sich auch zu den neuen Technologien ins Verhältnis setzen. Die Zukunft freilich ist keine durch Numerik geprägte Zukunft, eine Zukunft die von Maschinen beherrscht wird. Die Zukunft der Menschheit ist die kulturelle Kontrolle über die Maschinenwelt so wie die Zukunft der Menschheit immer auf Kultur basierte.
Herbert Arlt
Wissenschaftlicher Direktor