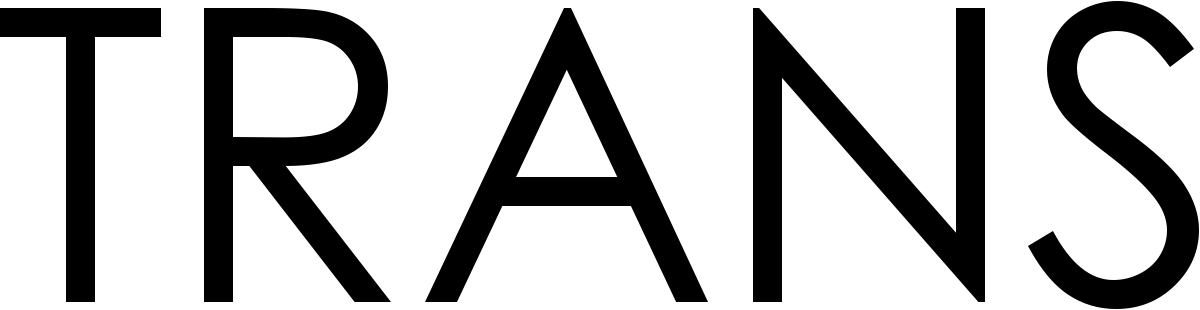Herbert Arlt*
Polylogzentrum (Österreich, Wien)
Abstract: The founders of the Polylogue Centre in Vienna see within the 21st century new challenges and new possibilities (digitization, Internet, Mobility, transnational cooperation). This is the background for the Polylogue project with 10.000 participants from more than 120 countries in 2016. The purpose of the Polylogue centre is, to get a real influence of the arts, science, research on the globalisation. And this means also a new education to enable the students to get subjects within regional and transnational processes. This means also for example the self-empowerment of people in Africa. The platform for this is an interactive homepage – by now in German and English, but will include within 2016 more languages. (1)
Wesentlichen Faktoren gesellschaftlicher Entwicklung im 21. Jahrhundert sind im Kontext der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen (2) die Mobilität und die neue gesellschaftliche Bedeutung von Virtualität. (3) Sie sind wesentliche Faktoren zur Umgestaltung der traditionellen Agrarproduktion, aber auch der traditionellen Industrieproduktion sowie der Dienstleistungen, zu denen auch die Distribution zu zählen ist. Sie sind das Rückgrat der neuen Bürokratisierungen sowie der Finanzflüsse, die sich weitgehend nur mehr auf sich selbst beziehen.
Mobilität
Die Mobilität erhielt mit der Industrialisierung eine neue gesellschaftliche Qualität. Es sind nicht mehr nur die „Vagabunden“ (4), die durch die Länder ziehen, um Wissen zu erwerben. Es sind Menschen, die auf der Suche nach einer Existenzgrundlage sind.
Das lässt sich anhand von Städten wie Yaounde (5) oder Wien (6) beispielhaft zeigen. Insgesamt führte diese neue Mobilität dazu, dass im 21. Jahrhundert bereits über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt. (7)
Derzeit aber gibt es laut UNO zudem bis zu 60 Millionen Schutzsuchende, die laut medialer Öffentlichkeit in Europa die Mobilen zu sein scheinen. Andere Faktoren kommen in dieser Öffentlichkeit nur mehr marginal vor.
Ausgelöst wurde diese Fluchtbewegung durch Kriege vor allem in Afghanistan, Libyen, Syrien und verschiedenen afrikanischen Ländern. (8) Dazu kommen Probleme mit dem Klimawandel sowie einer Produktions- und Handelspolitik, die ganze Regionen devastiert. (9)
Ohne diese Mobilität wäre der heutige Reichtum nicht denkbar. Denn die „Kultur des Abendlandes“ ist eine Kultur der Einschränkung, des Krieges. Und auch die militärischen Siege, der Raub, der damit verbunden war, haben den Alltag nur bedingt bereichert. Die Kenntnisse in Küche, Medizin etc. gingen weitgehend verloren, wie zum Beispiel die Fakten zeigen, nachdem der militärische Sieg über die „Mauren“ 1492 errungen worden war. (10)
Virtualität
Ein weiterer wesentlicher Faktor für die gesellschaftlichen Entwicklungen ist die neue Bedeutung der Virtualität, die bisher in ihrer gesellschaftlichen Potentialität erst im Ansatz erkannt wurde. (11) Denn in Europa wurde im Prinzip versucht, die traditionelle Welt digital zu reproduzieren so wie auch die Produktion weitgehend durch Reproduktion bestimmt war und ist. Alles wird der Reproduktion untergeordnet, während die Innovation – sofern sie nicht technischer Natur ist – unter Kontrolle genommen anstatt entfaltet wird.
Als weiteres Problem kommt die unreflektierte Strukturierung des Denkens und Handelns durch die Binarität dazu, die ebenfalls nur eine Reproduktion ist – in diesem Fall der technischen Hilfsmittel. Deshalb kommt es darauf an, alternativen Erkenntnisgewinnungen wie durch die Künste, die Annäherungsverfahren der Wissenschaften etc. auch strukturell-gesellschaftlich eine andere Position einzuräumen.
Aus den Fehlentwicklungen erklären sich hauptsächlich die hohen Arbeitslosenzahlen sowie die Tatsache, dass zum Beispiel die Europäische Union die Infrastruktur zur Verfügung stellt, aber US-Konzerne den Gewinn machen, den sie nach Möglichkeit auch nicht versteuern wollen. Und daraus erklärt sich weiters eine völlig falsche Form der Forschungsförderung, die sich auf Industrieproduktion in ihrer Reproduktivität konzentriert, während Kultur ein Teil der Parteipolitik war oder – wie in Österreich nach dem Aufbruch in der Kreisky-Ära – wieder geworden ist.
Wenn also eine Konferenz zur Kulturwissenschaft in Yaounde auf transdisziplinärer Basis an einer Vorstellungsbildung arbeitet, ist dies von grundsätzlicher Bedeutung für die Entwicklung in Afrika. Die Potentialität zeigt sich anhand des Programms, des Interviews mit dem Organisator der Konferenz, aber auch den Beiträgen – alles auf dem Weg zur Dokumentierung in TRANS 20.
Ziel der traditionellen Art von Kunst-, Kultur- und Forschungspolitik ist es, die unmittelbare Produktion zu „verbessern“. Es bedarf aber eben nicht nur der Entwicklung der Produktion von landwirtschaftlichen Produkten, von Autos, Flugzeugen, Computerelementen, sondern vor allem auch Einsichten in das Grundlegende – die Existenz an und für sich. Nur diese Erkenntnisse ermöglichen einen gesellschaftlichen Fortschritt, der kein „Fortschritt“ in der Erweiterung der Destruktion, der Kriege ist. Aber gerade diese Fehlentwicklung soll nun wieder unter dem Stichwort „Sicherheit“ zum Beispiel in Afrika forciert werden.
Bereits in den 1970er Jahren gab es Widerstand gegen eine Entwicklung, die erinnerungslos die militärische Forschung bevorzugte. Die Gründung der Jura Soyfer Gesellschaft am 30.6.1988 zeigte, dass die Erinnerung an gesellschaftliche Gewalt (Austrofaschismus 1933-1938, Nationalsozialismus 1938-1945) und Krieg gesellschaftlich durchaus eine zentrale Bedeutung beigemessen werden kann. Diese Gründung steht im Kontext einer Europäischen Union als Friedensunion im Gegensatz zu jenen Konzeptionen, die sich die Europäische Union als Festung, Militärunion etc. vorstellen. Doch gerade diese Vorstellungen der Krieger von der Europäischen Union sind gescheitert. So folgten den militärischen Aktionen in Libyen die Destabilisierung eines Landes, Flüchtlingsströme, Tote und eine massive militärische Aufrüstung sowie eine Polarisierung in Europa, mit der viele Möglichkeiten vertan wurden, die sich Ende der 1980er Jahre eröffnet hatten.
Der gemeinnützige Verein Jura Soyfer Gesellschaft aber wurde Teil einer Bewegung, die in den 1970er Jahren entstanden war und von KünstlerInnen, StudentInnen, aber auch einigen HochschullehrerInnen getragen worden war. Es war die Zeit, als StudentInnen im Rahmen von Streiks ihre eigenen demokratischen Universitäten organisierten und dazu beitrugen, dass Forschung und Lehre geändert wurden. Es war die Zeit, in der gesellschaftliche Erinnerung eine breite Öffentlichkeit fand. Es war eine Zeit, in der Sprache, Künste, Wissensproduktionen entfaltet wurden, ohne aber dass diese Anstrengungen auch im Bildungsbereich Folgen gehabt hätte. Denn seit den 1970er Jahren wird eine Bildungsreform blockiert, die nicht nur eine Chancengleichheit gewährleisten könnte, sondern die unabdingbare Basis für einen gesellschaftlichen Reichtum ist.
Das war die Zeit, in der die Verarmung der Wissensproduktion durch die Gewaltpolitik entdeckt wurde, die ursächlich – ebenso wie zum Beispiel der „Sieg“ über die „Mauren“ bzw. das Alhambra-Edikt zur Verarmung beitrugen.
Auch der „Sieg“ im 20. Jahrhundert war ein Pyrrhus-Sieg. Tausende WissenschafterInnen, KünstlerInnen konnten sich seit den 1930er Jahren ins Ausland retten. Aber Zehntausende starben, wurden in Mitteleuropa zum Teil systematisch ermordet – wie zum Beispiel die tschechische oder polnische Intelligenz. Darunter Jura Soyfer, der mit 26 Jahren am 16. Februar 1939 im Konzentrationslager Buchenwald ums Leben kam.
Daran sollte erinnert werden. Die Jura Soyfer Gesellschaft gab von 1989 bis 2007 eine eigene Zeitschrift heraus. In diesem Zeitraum organisierte sie Symposien in Wien (1989), in Saarbrücken (1991), in Paris und an der University of California at Riverside (beide: 1992), in Prag (1993), in Florenz (1994), in Bergen in Norwegen (1995), in Wien/ Buchenwald/ Weimar/ Jena (1996), Izmir (1999), Novi Sad (2000), Landestheater Schwaben/ Memmingen (2007), Tbilissi (2008), Buenos Aires (2009), Charkiv/ Kharkow (2012) und immer wieder in Wien (1997, 1998, 2001, 2006, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Wichtig war in all den Jahren aber auch die Zusammenarbeit mit KollegInnen aus so unterschiedlichen afrikanischen Regionen wie Südafrika, Zentralafrika und Nordafrika. Es ist daher kein Zufall, dass bei der Konferenz zu den Kulturwissenschaften in Yaounde eine Ausstellung zu Jura Soyfer gezeigt wurde.
Diese Veranstaltungsorte, die Kooperationen hatten unmittelbar mit Soyfer, seinem Werk, der Verbreitung seines Werkes zu tun. Die Symposien waren mit einer Vielfalt von Projekten verbunden, die Soyfer weltweit ein Millionenpublikum sicherten – mit Ausstellungen, Büchern, Theateraufführungen, Radiohörspielen, Filmen und vor allem dann über die Internetplattformen.
Mittlerweile wurde Soyfer nicht zufällig in über 50 Sprachen übersetzt. In mehr Ländern noch fanden Veranstaltungen statt, wurden Stücke aufgeführt, Radio-Hörspiele gesendet, Filme gedreht. Daher entstehen derzeit Versionen der Homepage der Jura Soyfer Gesellschaft in zwei Dutzend Sprachen. Basis dafür sind File-Books. Denn das Werk Soyfers steht im Mittelpunkt. Bis zum Jahre 2032 soll das Angebot auf über 50 Sprachen und damit Kommunikationsplattformen erweitert werden – auch in Verbindung mit einem vielsprachigen Virtuellen Soyfer Archiv.
Das Projekt „Jura Soyfer“ in seiner Komplexität (12) ist eine völlig neue Form der Organisation von Kommunikation und ein Beispiel dafür, wie eine komplexe Öffentlichkeit organisiert werden kann. Immer wieder war dies auch verbunden mit Lehrveranstaltungen an Universitäten – darunter von Gabrielle Pfeiffer, Aleya Khattab, Herbert Arlt, Elisabeth Grabenweger und anderen. (13)
Im Jahre 1994 wurde aus diesem Kreis heraus das INST (14) gegründet. Mit dem INST beginnt das Polylogprojekt. Denn in diesem Rahmen wird der Begriff Polylog (15) geprägt, mit TRANS (16) eine wichtige Kommunikationsplattform geschaffen und 8 Weltkonferenzen organisiert – die erste Weltkonferenz fand 1999 in der UNESCO-Zentrale in Paris statt. (17)
Wie im Falle der Jura Soyfer Gesellschaft gibt es eine Öffentlichkeit mit Hilfe von Publikationen – zunächst in Druckform und dann weitgehend interaktiv über Internet. (18) Aber von zentraler Bedeutung waren und sind auch die persönlichen Begegnungen. Das zeigen Foren mit bis zu 7.000 TeilnehmerInnen aus über 120 Ländern. (19)
Beide Vereine – Jura Soyfer Gesellschaft und INST – waren Teil einer freien Wissenschaftsszene, die bis 2011 aus rund 320 Einrichtungen bzw. Vereinen in Österreich bestand. Doch diese Form der offenen Wissenschaft wurde in Österreich von den Rechtskräften nicht geduldet. Die etwa 320 wissenschaftlichen Vereine, die seit der Kreisky-Ära entstanden, wurden an den Rand gedrängt, verstaatlicht, zerstört, womit schwerwiegende gesellschaftliche Folgen und unmittelbare Schäden in Milliardenhöhe verbunden waren. Aber nicht nur für die WissenschafterInnen, sondern auch für diejenigen, die diese Destruktion zu verantworten haben.
Mittlerweile ist die Partei des Irrationalismus zu einer Kleinpartei geschrumpft – insbesonders wenn die Wahlergebnisse zur Bundespräsidentenwahl am 24.4. bzw. 22.5.2016 herangezogen werden. Die Öffentlichkeit ist bestimmt von „Stimmungen“, die Universitäten hingegen von Bürokratismus, Markt (zum Beispiel Handel mit den eigenen Räumlichkeiten), die wissenschaftliche Arbeiten behindern. Nicht zufällig ist dies auch weitgehend mit Geschichtslosigkeit verbunden.
Als Reaktion darauf ist nun von einem Neustart der Regierung die Rede, der aber nur gelingen kann, wenn in Forschung, Künsten, Bildung, Vereinswesen die Konsequenzen gezogen werden. Der neuerliche Versuch, Reproduktion als Innovation zu verkaufen, wird wohl die entsprechenden Parteien verschwinden lassen, so wie sie auch in anderen Ländern verschwunden sind. Der gleiche Effekt ergibt sich auch auf dem Beharren der Binarität als herrschender Denkform.
Um die Herausforderungen in Österreich, aber auch im Rahmen der Globalisierung in den Ländern dieser Welt richtig zu verstehen, muss daher zunächst analysiert werden, welches die Folgen der Digitalisierung bzw. des Internets sind.
In der Geschichtsschreibung, der Bildung wird meist so getan, als ginge es um die Herrscher. Aber kein Mächtiger hatte jemals die Bedeutung für die Entwicklung einer Gesellschaft und deren Möglichkeiten wie zum Beispiel die Einführungen der Kartoffel oder des Buchdrucks. Vielmehr wurden Herrschaftsstrukturen über kurz oder lang über derartige Innovationen geprägt. Und nicht anders ist es mit der Digitalisierung bzw. dem Internet. Denn im Zentrum der Herausbildung des Reichtums stand und steht die Kommunikation in ihrer Vielfältigkeit.
Freilich unterscheidet sich die Öffentlichkeit, die durch Bücher, Zeitschriften, Flugblätter, Film, Radio, Fernsehen geschaffen wird, von der Öffentlichkeit des Internets. Auf den ersten Blick wird dies nicht wirklich evident, weil Pornographie, Kontaktbörsen, Spiele, Vertriebssysteme aller Art im Vordergrund zu stehen scheinen. Auch das Finanzkapital hat nur wenig mit Produktion zu tun. Und die 3D-Drucker scheinen sich dem Austausch zu entziehen und damit einen wesentlichen Faktor der gesellschaftlichen Entwicklung zu eliminieren. Wissensproduktionen, Bildung konzentrieren sich darauf, Zulieferer zu sein, womit ein Abfall in der technologisch basierten Produktivität verbunden ist, dagegen der Alltag aber durchaus bereichert wird. (20)
Dennoch sind Menschen diesen Gegebenheiten nicht einfach ausgeliefert. Es kam darauf an, ob der Buchdruck für die Verbreitung des Wissens genutzt wurde oder für die Vorbereitung und Durchführung von Kriegen.
Das Internet bietet für beides einmalige Möglichkeiten. Aber es stellt sich zudem die Frage nach dem Faktor der Produktion für die gesellschaftliche Entwicklung. Der Industrie 4.0 bezeichnet in diesem Kontext ein Programm, das reproduktiv ist und trotz aller Zukunftsrhetorik nicht in die Zukunft verweist. (21) Denn mit dieser Bezeichnung und der Darstellung des Konzepts wird gezeigt, dass nicht wirklich verstanden wird, um was es geht, weil es – selbst bei einer industriellen Produktion – nicht einfach um eine neue Form der Reproduktion geht, sondern im Kern um ein neues Verhältnis von Innovation und Reproduktion. Dieses neue Verhältnis stellt auch alle Unterrichtsmethoden in Frage, die sich bloß auf die künftige Beteiligung von SchülerInnen an der Reproduktion beziehen. Damit war und ist auch die Universitätsreform in Österreich zum Scheitern verurteilt, die in den 1960er Jahren von der Industriellenvereinigung angeregt und in den 1980er Jahren im Wesentlichen umgesetzt worden war. Ergänzt wurde diese durch die Entwicklung eines „Marktes“ an den Universitäten (z.B. Handel mit Räumlichkeiten) und einer Bürokratisierung, die vor allem Arbeitsplätze für jene schuf, die Rahmenbedingungen schaffen sollten, aber ihre Tätigkeit offenbar als Selbstzweck verstanden und verstehen.
Diese Strukturen behindern die Entwicklung, weil sie öffentlichkeitsfeindlich sind, nicht auf Innovation, sondern auf Kontrolle zielen.
Virtualität ist aber mit öffentlichen Vorstellungsbildungen und damit mit Sprachen, Bildern, Tönen, Wissenschaft, Forschung, Künsten verbunden, die sich nicht wirklich in autoritären Systemen entfalten können. Selbst die Zahlen, Formeln sind in diesem Kontext nur Hilfsmittel, die sich – wie alles – auch auf sich selbst reduzieren kann. (22) Die Sprache zur Darstellung der Mathematik, des Internets, der Ökonomie und selbst der Autoproduktion etc. ist die Sprache der Künste – sind Bilder, Metaphern etc. (23) Also die Sprache jener gesellschaftlichen Bereiche, die immer wieder an den Rand gedrängt wurden, womit die jeweilige Gesellschaft der Ausgrenzung verarmte. Ein Prozess, der bedauerlicherweise die Europäische Union charakterisiert, der aber auch für einzelne Länder der Union wie Österreich in Eigenverantwortung prägend geworden ist.
Schlussendlich verweist die Verwendung der Sprache der Künste aber auf nichts anderes als die Abbildung realer Widersprüche. Und das ist auch für die Logik und ihre Regeln bzw. die Grammatik etc. nicht anders.
Damit aber zeigt sich, welch grundlegender Fehler begangen wird, wenn – wie in Österreich – die Kulturwissenschaften unterworfen, sogar zerstört werden. Die unmittelbare Folge davon ist die Herabsetzung der Produktivität, Arbeitslosigkeit, Verarmung des Alltags, Verrohung und Irrationalismus. Gerade die Wahl zum Bundespräsidenten 2016 hat dies evident gemacht.
Die Arbeit des INST seit seiner Gründung im Jahre 1994, die Gründung des Polylogzentrums 2014 stellen sich dem nicht nur regional entgegen. Und in diesem Sinne ist auch das Polylogprojekt zu verstehen – als ein Projekt der Zusammenarbeit, der Erkenntnisgewinnung, einer Öffentlichkeit, die sich auf Daten, Fakten, Thesen bezieht und nicht auf Stimmungen. Die „Politik der Gefühle“ hat sich vielmehr als Irrweg erwiesen. Und keineswegs sind die „Gefühle“ ein Gegenpol zur Binarität wie auch das Projekt zu Zelko Wiener mit dem Titel Zwischen 0 und 1 zeigt.
Im Kern geht es mit dem Polylogprojekt daher darum, zunächst zwei Bereiche zu etablieren: die Polylogforen und das Weltprojekt der Berge. (24) Insgesamt aber geht es – über diese beiden Projekte hinaus – um die Etablierung eines Zentrums, das eine Plattform neuer Qualität der öffentlichen Vorstellungsbildung werden soll.
Die Polylogforen folgen den 8 INST-Weltkonferenzen nach. Neu sind nicht nur die angestrebte Quantität, sondern auch die Rahmenbedingungen, für die nun die notwendigen Finanzierungen möglich erscheinen.
Das Weltprojekt der Berge wurde deshalb als erstes Polylogprojekt ausgesucht, weil es einen Vorlauf seit dem Jahre 1998 gibt. Exemplarisch kann anhand dieses Projektes gezeigt werden, was möglich ist. (25)
Einerseits prägen die Berge für viele Menschen den Alltag. Immerhin ist ein Drittel der Welt mit Bergen bedeckt. Andererseits sind die Berge eben nicht das Trennende, sondern sagen viel über die gemeinschaftliche menschliche Praxis aus. Daher war es erfreulich, dass es dem INST gelang, mit Hilfe des Generalsekretärs der österreichischen UNESCO-Kommission, Dr. Harald Gardos, sowie des seinerzeitigen Sektionschefs im Wissenschaftsministerium, Dr. Raoul Kneucker bei der Generalversammlung der UNESCO im Herbst 2001 eine Resolution zu initiieren, mit der unterstützt wurde, dass im UN-Jahr der Berge 2002 nicht nur auf die Bedeutung der Berge für Wasser, Landwirtschaft, Tourismus verwiesen wurde, sondern dass unbedingt die kulturelle Dimension der Berge beachtet werden sollte. Denn es war auch ausschließlich die kulturelle Dimension, deren Beachtung es ermöglichte, Berge zu besteigen.
Die Ergebnisse des Projektes sollten 2002 im Rahmen eines Weltmuseums der Berge in der Ramsau am Dachstein präsentiert werden. Die Realisierung des Projektes scheiterte jedoch an der Rechtsregierung.
Ein zweiter Anlauf wurde 2009 genommen. Ein Weltmuseum der Berge sollte 2014 im Rahmen der Olympiade am Fuße des Elbrus präsentiert werden. Aber die Gewalt im Elbrus-Gebiet verhinderte das ebenso wie sie die Entfaltung des Kaukasus-Gebietes behinderte, das – im Kontext der Präsentation der Prinzipien für das Weltmuseum der Berge im Elbrus-Gebiet – entstanden war. (Damals wurden auch von der EU prinzipielle Chancen in der Kooperation mit der Europäischen Union nicht genutzt, die eine andere Entwicklung in Europa ermöglicht hätten.)
Nun wird ein dritter Anlauf unternommen – eine Realisierung des Projektes als digitales Weltmuseum, dessen digitale Objekte in realen Museen präsentiert werden sollen. Darunter besteht die Möglichkeit der Präsentation im Weltmuseum (26) in der Hofburg in Wien, aber es wird auch andere PartnerInnen geben.
Weltweit einmalig ist, dass es eben nicht um eine Reproduktion eines real existierenden Museums geht, sondern um digitale Objekte in einem digitalen Museum.
Im Netz ist ein solches Weltmuseum leichter zu realisieren als in Regionen, in denen die Zerstörung im Vordergrund steht, die Krieger den Ton angeben. Freilich ist auch das Internet keine politikfreie Zone oder gar eine Welt des Friedens. Längst wird auch das Internet dazu genutzt, Krieg zu führen. Und in den letzten Jahren ist massiv aufgerüstet worden.
Es wird also nicht nur darum gehen, einzelne Projekte zu realisieren, die bisher meist an den Gegebenheiten scheiterten. Es wird auch darum gehen, die Rahmenbedingungen zu verändern, nachdem die Strategie der Krieger evident fehlgeschlagen ist. Anstatt friedliche Veränderungen wie 1989 zu ermöglichen, wurde der Terror entfacht, Hunderttausende getötet und Millionen zu Flucht gezwungen.
Für neue Rahmenbedingungen weltweit sollen die Polylogforen sorgen. Wie bereits mit den INST-Weltkonferenzen (27) wird versucht, Subjekt in der Globalisierung zu sein. Das ist aber perspektivisch gesellschaftlich nur möglich, wenn auch die Bildung bzw. die Vorstellungsbildung über die Fähigkeiten hinausgehen, an einer Reproduktion teilzunehmen. Basis dafür ist, was ursprünglich für alle Künste und Wissensproduktionen relevant war: sich auf die Gewinnung grundlegender Erkenntnis zu konzentrieren und mit anderen auszutauschen und so zu neuem Wissen zu gelangen.
Die Entwicklung dieser Art von Wissen kann anhand der Homepage des Polylogzentrums nachvollzogen werden. Im großen Stil wird dies aber erst möglich sein, wenn es nun – nach vielen Jahren – gelingt, die notwendigen Finanzierungen zu erhalten. Die Entscheidung darüber wird im Jahre 2017 fallen.
Viele WissenschafterInnen haben sich aber bereits seit Jahren bzw. Jahrzehnten entschieden, den Weg des Polylogs zu gehen – wie immer derartige Entscheidungen ausfallen.
* Arlt-Homepage mit Kurzbiographie, Bibliographien, Texten, Bildern: www.arltherbert.at
(1) Die Homepage des Polylogzentrums ist seit 2015 im Netz und wird ständig erweitert. Die wichtigsten Elemente in der derzeitigen Entwicklung sind das Weltprojekt der Berge sowie die Polylogforen.
(2) Titel einer der 8 Weltkonferenzen, mit denen die Gründung des Polylogzentrums vorbereitet wurde. Die Beiträge dazu im Internet: http://www.inst.at/trans/14Nr/inhalt14.htm
(3) Siehe dazu die Dokumentation des EU-Projekts Virtualität und neue Wissensstrukturen: http://www.inst.at/burei/CBand6.htm
(4) Vgl. dazu das Projekt zum „Vagabundenlied“ von Jura Soyfer in: http://www.inst.at/burei/CBand9.htm Es sind dort nicht nur die Übersetzungen und die Kommentare zu den Übersetzungen in 34 Sprachen des Vagabundenliedes von Jura Soyfer enthalten, sondern auch eine Einführung zur gesellschaftlichen Bedeutung.
(5) Zur Industrialisierung und Bevölkerungsentwicklung in Yaounde siehe: http://analegeo.ro/the-industries-insertion-and-spatial-extension-of-yaounde-urban-city-in-cameroon/ Die Schreibweise „Yaounde“ wird hier deshalb verwendet, weil die Stadt nach dem Yawonde- oder Ewondo-Volk benannt wurde: https://de.wikipedia.org/wiki/Etymologische_Liste_der_Hauptstadtnamen Nähere etymologische Erklärungen sind zu finden unter http://anthony1956.blogspot.co.at/2015/11/cameroon-and-its-place-names.html:
Founded as Jeundo by German explorers in the 1880s, the German botanist August Zenker recorded the name as Jaunde, itself a German spelling of the name of the local Yaunde people who took their name from their agrarian lifestyle with the name translating as simply ‚groundnut‘.
(6) Zur demographischen Entwicklung in Wien siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Demografie_Wiens
(7) Die Zahlen und Analysen der UN zur Urbanisierung der Welt: http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html
(8) Die UN-Zahlen und deren Begründung siehe unter: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52859#.V0um1eRf05s
(9) Dazu die Seite der UN im Internet: http://www.un.org/climatechange/
(10) Zu Krieg und Alltagskultur siehe auch die Homepage des Polylogzentrums im Internet: http://www.polylogzentrum.at/ Sie wird laufend ausgebaut. – In der Literatur wird seit dem 19. Jahrhundert auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Zum Beispiel im Stück „Die Jüdin von Toledo“ von Franz Grillparzer.
(11) Basis jeglicher gesellschaftlicher Entwicklungen ist die Vorstellungsbildung. Deren Erarbeitung erfolgt im 21. Jahrhundert im Kontext einer hochgradigen Arbeitsteilung auf der Basis einer Datenmenge, die von Einzelnen schon seit dem 19. Jahrhundert auch nicht im Ansatz übersehen werden kann. Daher wurde bereits mit den INST-Weltkonferenzen, der Internet-Zeitschrift TRANS, mit diversen Veranstaltungen, Publikationen, Projekten versucht, Synergien zu entwickeln. Von Beginn an diente das Internet als Basis für diese Bemühungen. Seine Strukturen und Potentialitäten wurden seit den 1980er Jahren studiert und auch etliche Vorschläge zur Entwicklung vorgetragen.
(12) Siehe: http://www.soyfer.at/at/
(13) Die erste Lehrveranstaltung zur österreichischen Literatur der 1930er Jahre fand Ende der 1970er Jahre in Salzburg statt. Einer der AutorInnen, die Gegenstand der Lehrveranstaltung waren, war Jura Soyfer. Es folgten Lehrveranstaltungen von Schmidt-Dengler an der Universität in Wien sowie an anderen österreichischen Universitäten, um wissenschaftlich die Konflikte, Destruktionen, Kriege des 20. Jahrhunderts aufzuarbeiten.
(14) Die Adresse der siebensprachigen Homepage (6 UN-Sprachen und Deutsch): www.inst.at Die umfangreichsten Informationen befinden sich im deutschsprachigen Teil: http://www.inst.at/deutsch/index.htm Die Informationen in den anderen Sprachen sollen nach Maßgabe der Möglichkeiten 2016/ 2017 auf den neuesten Stand gebracht werden. Und gerade auf diesen Seiten findet sich die umfangreiche Kooperation mit KollegInnen aus dutzenden afrikanischen Ländern dokumentiert. Ein Höhepunkt war die Kulturexpedition auf den Uhuru Peak – der höchste Gipfel des Kilimanjaro Massivs (Uhuru = die Freiheit).
(15) Siehe dazu die Enzyklopädie vielsprachiger Kulturwissenschaften: http://www.inst.at/ausstellung/enzy/polylog/polylog.htm Eingeführt in die INST-Diskussionen hatte den Begriff Anil Bhatti (New Delhi), der sich dabei auf Wimmer bezog.
(16) Die erste Dokumentation von TRANS beinhaltet bereits den Begriff Polylog: TRANS. Dokumentation eines kulturwissenschaftlichen Polylogversuchs im WWW (1997–2002). Siehe dazu: http://www.inst.at/burei/ABand17.htm
(17) Siehe dazu die Dokumentationen zu den Weltkonferenzen: http://www.inst.at/trans/trans-dokumentationen/
(18) Zu den Publikationen siehe: http://www.inst.at/burei/index.htm
(19) Zur KCTOS-Konferenz kamen 7.000 TeilnehmerInnen aus rund 120 Ländern. Das Programm im WWW: http://www.inst.at/kctos/programm/eroeffnung.htm
(20) Vgl. dazu Robert Gordon: The Rise and Fall of American Growth. http://press.princeton.edu/titles/10544.html Freilich bezieht sich Gordon ebenfalls im Kern auf die Reproduktion.
(21) http://www.fraunhofer.at/de/pl/leistungsspektrum/industrie_4_0.html
(22) Um ein Beispiel aus den Forschungen zur Ökonomie zu benennen: Noch bei Marx war die Literatur von Sophokles bis Shakespeare Teil eines Instrumentariums zur Entdeckung der Welt. Bei Thomas Piketty (Das Kapital im 21. Jahrhundert, Verlag C.H.Beck: München 2014) ist Literatur (Balzac, Diderot, Proust etc.) nur ein Mittel zur Illustration.
(23) Herbert Arlt: Konzeptuelle Metaphern und gesellschaftliche Prozesse. In: http://www.inst.at/trans/13Nr/arlt13.htm
(24) Siehe: http://www.polylogzentrum.at/ Dort auch die Ausführungen zu den Projektelementen „Polylogforen“ und „Weltprojekt der Berge“.
(25) Siehe zum Projekt und dessen Entwicklung: http://www.polylogzentrum.at/weltprojekt-der-berge/
(26) Weltmuseum in Wien: http://www.weltmuseumwien.at/
(27) Dokumentationen: http://www.inst.at/trans/trans-dokumentationen/